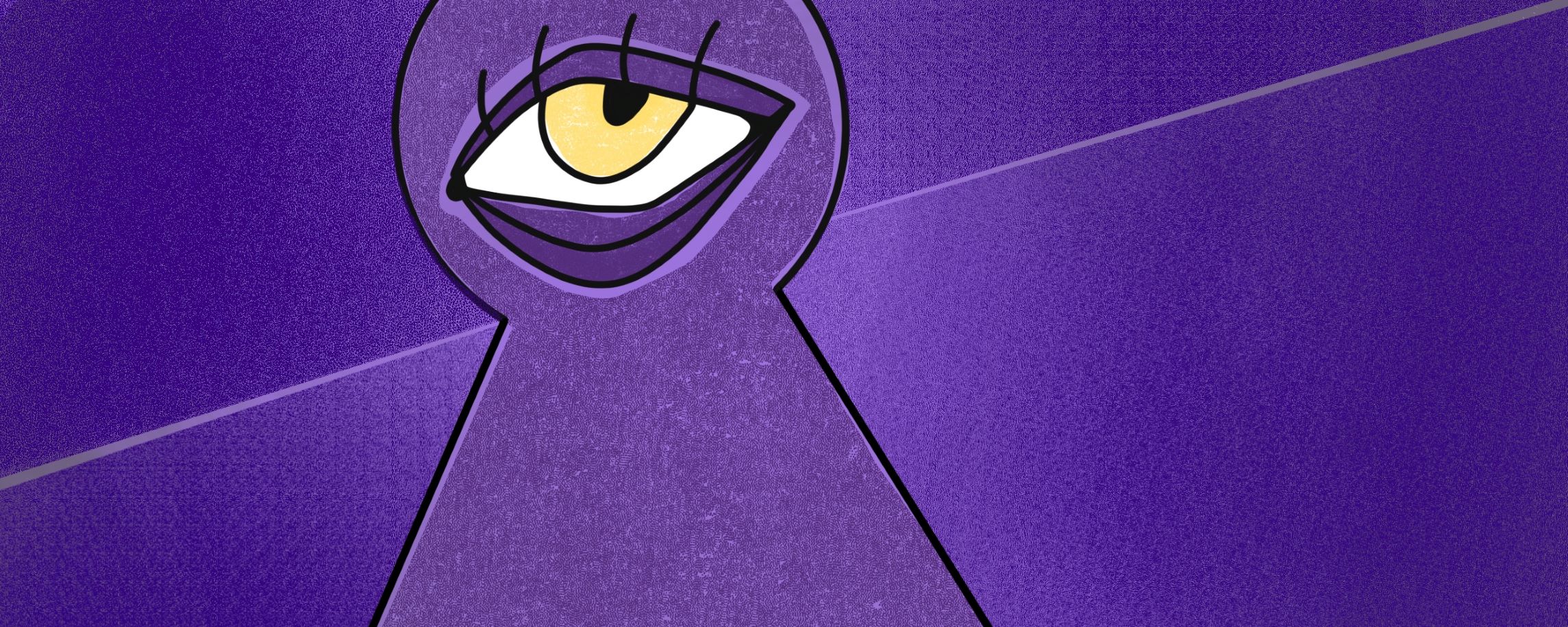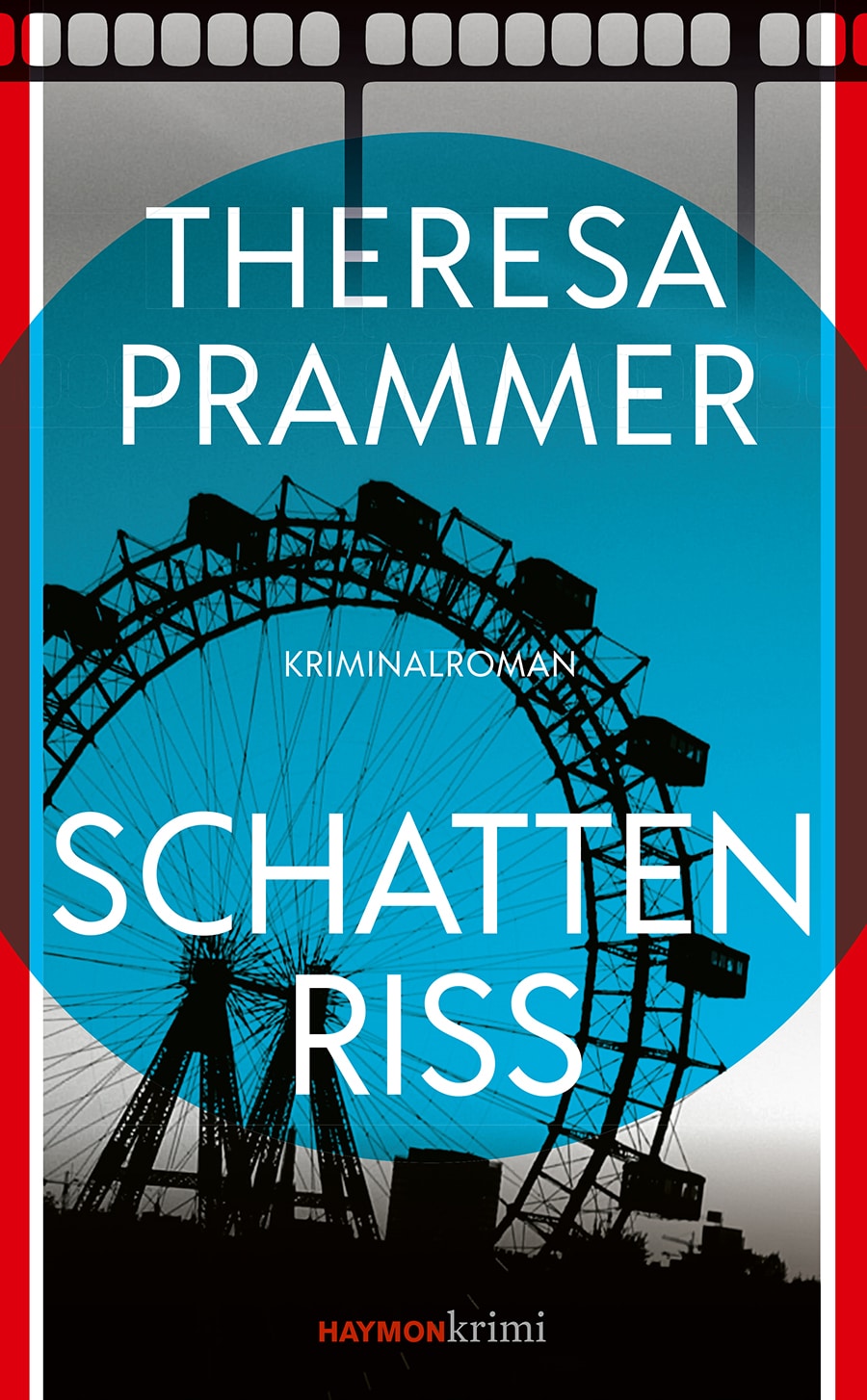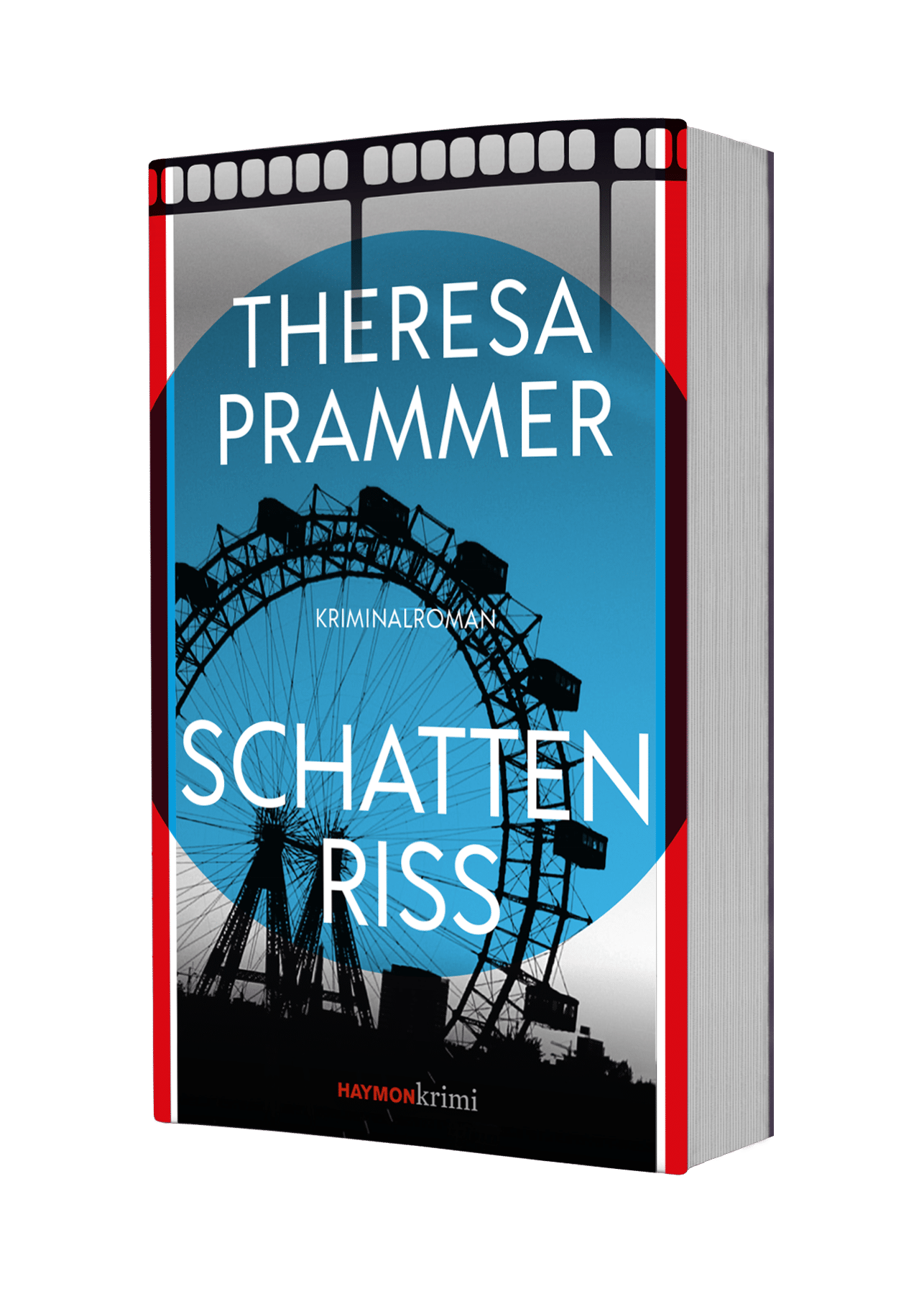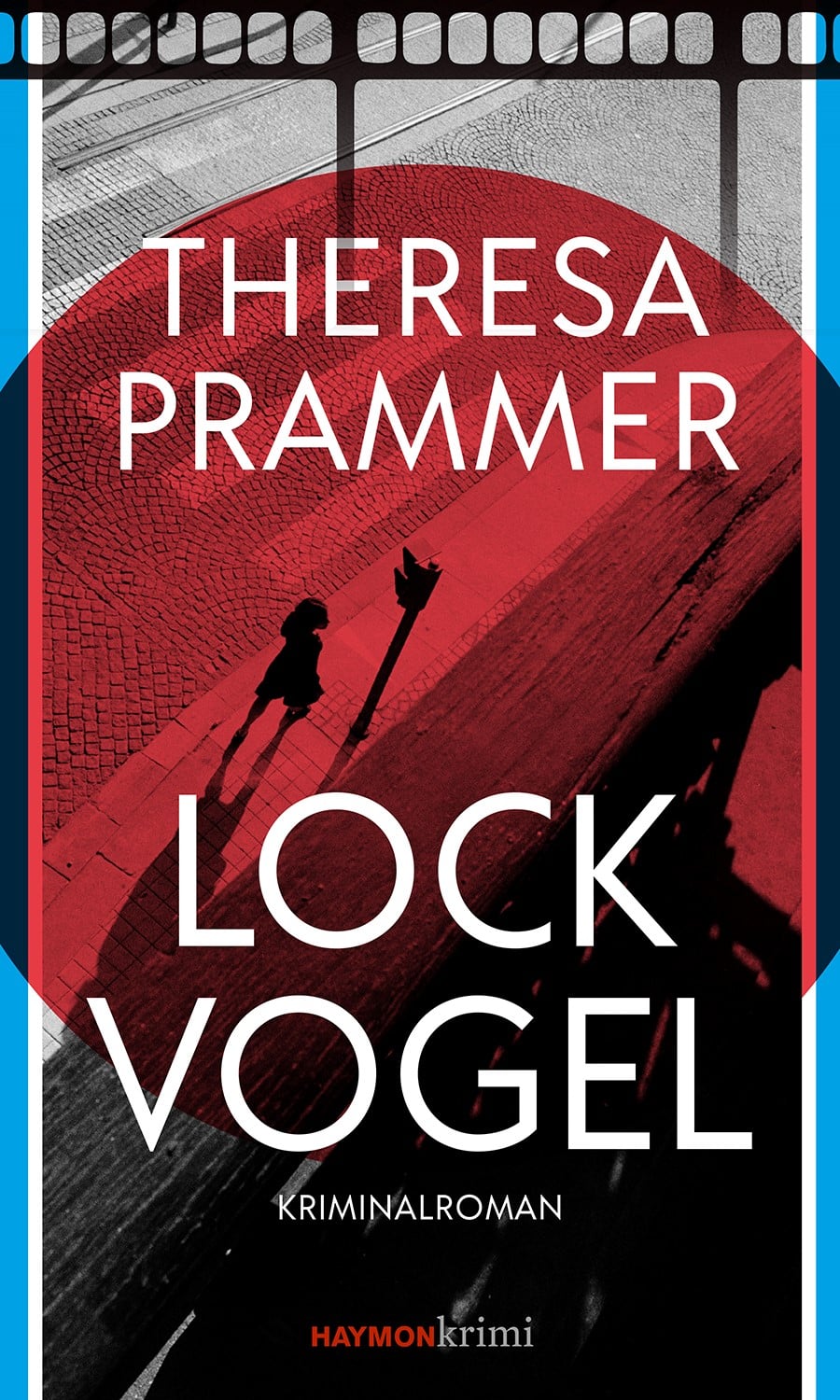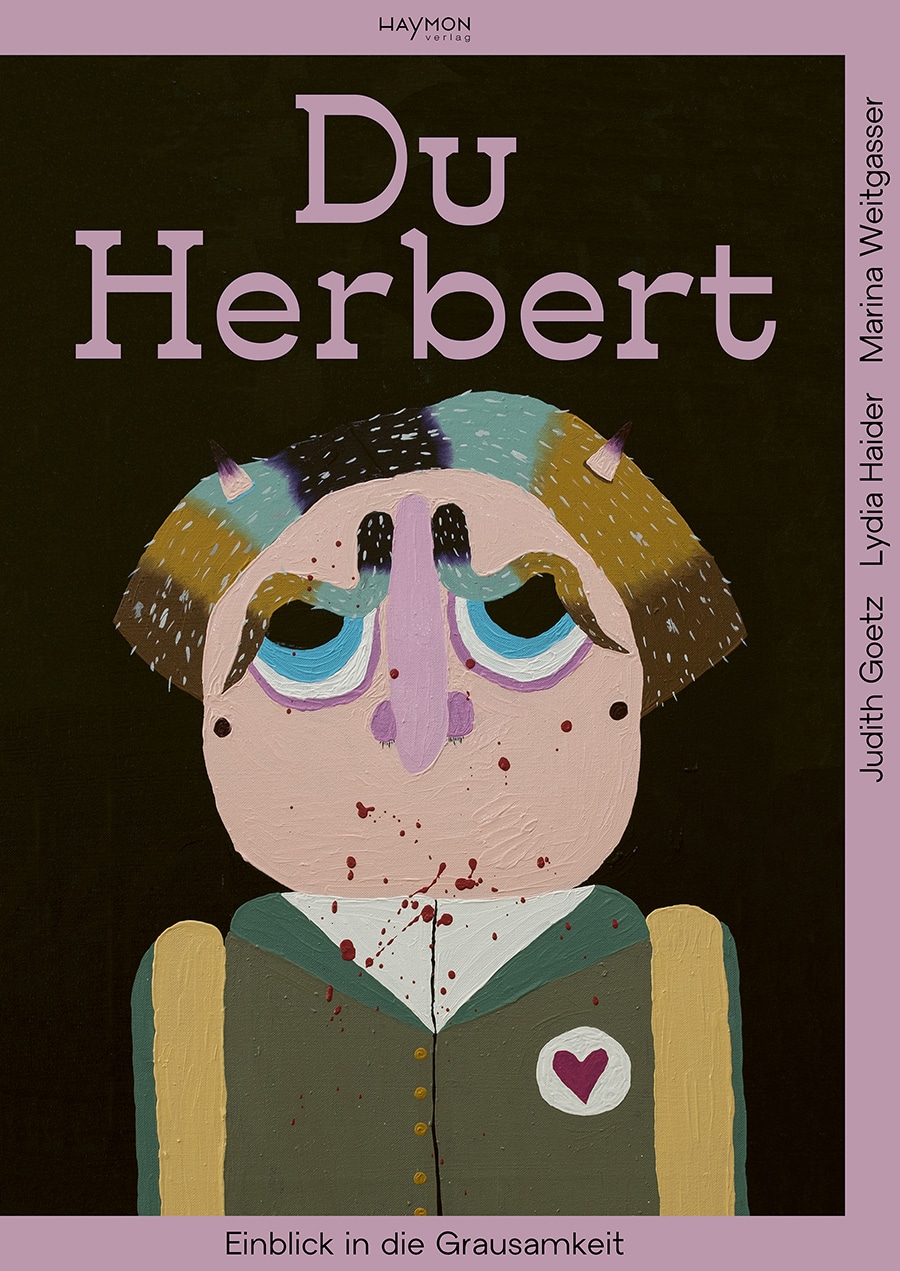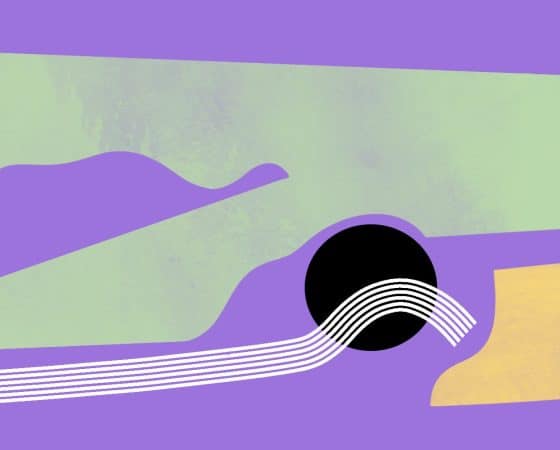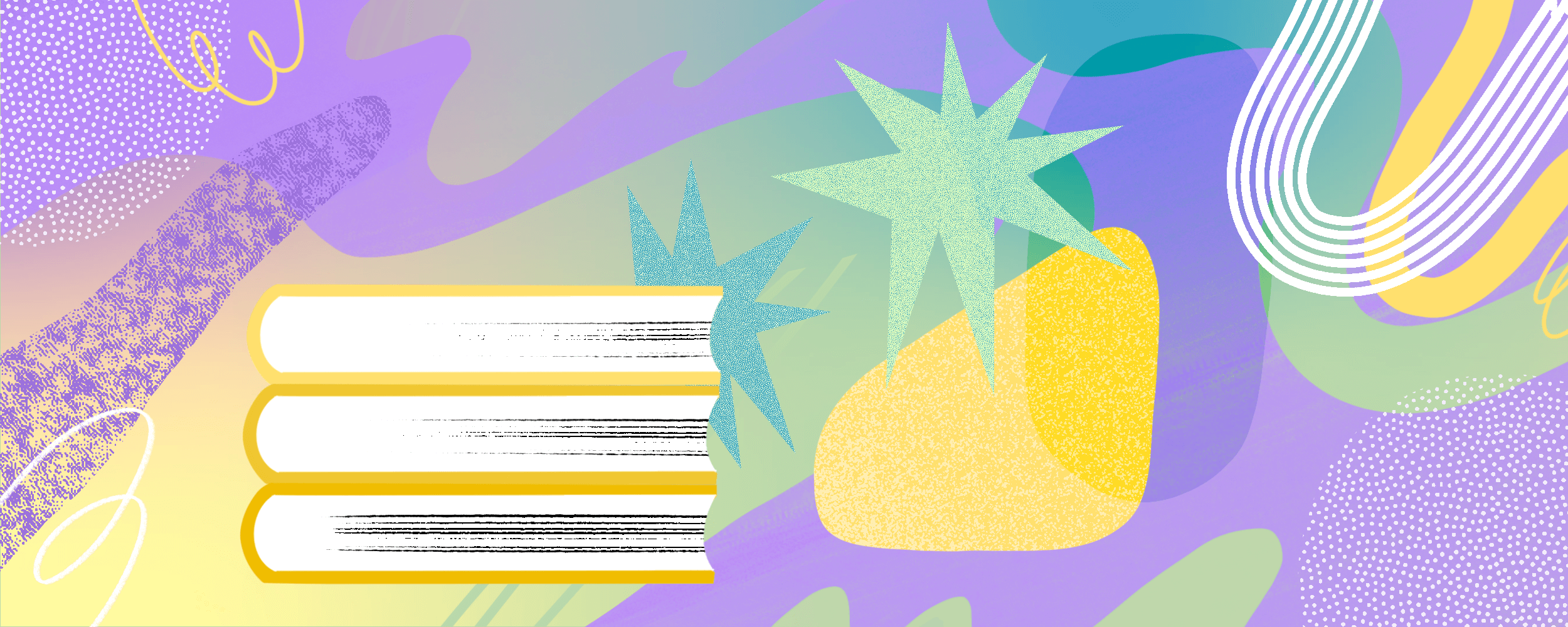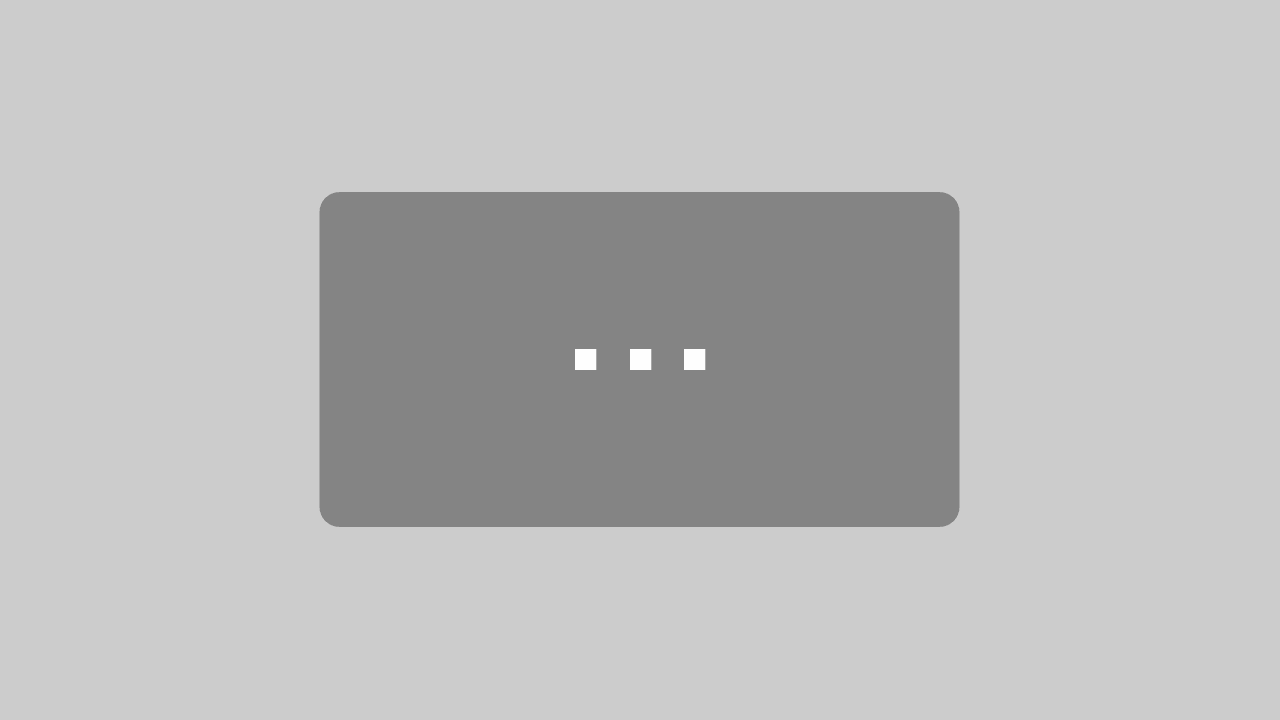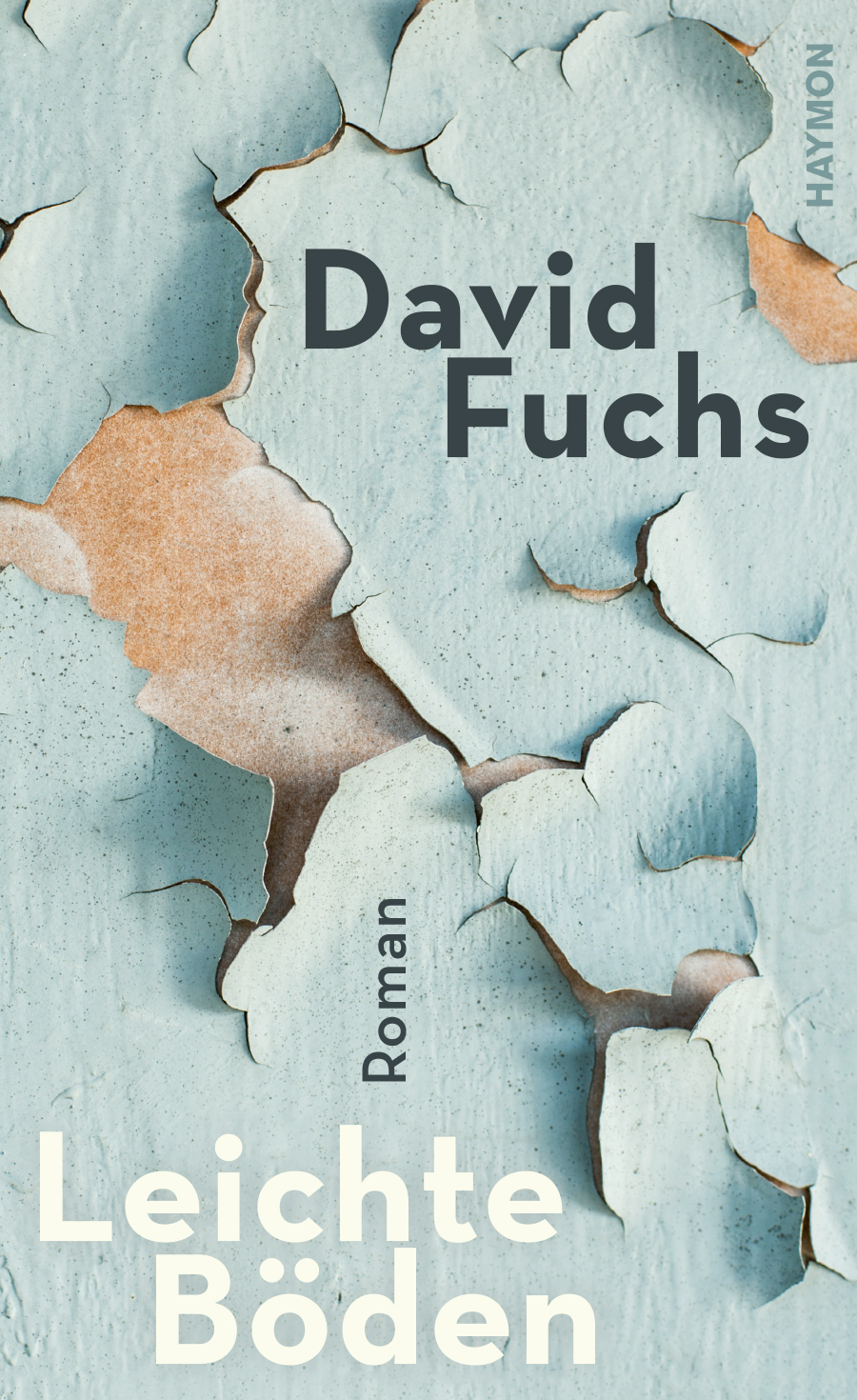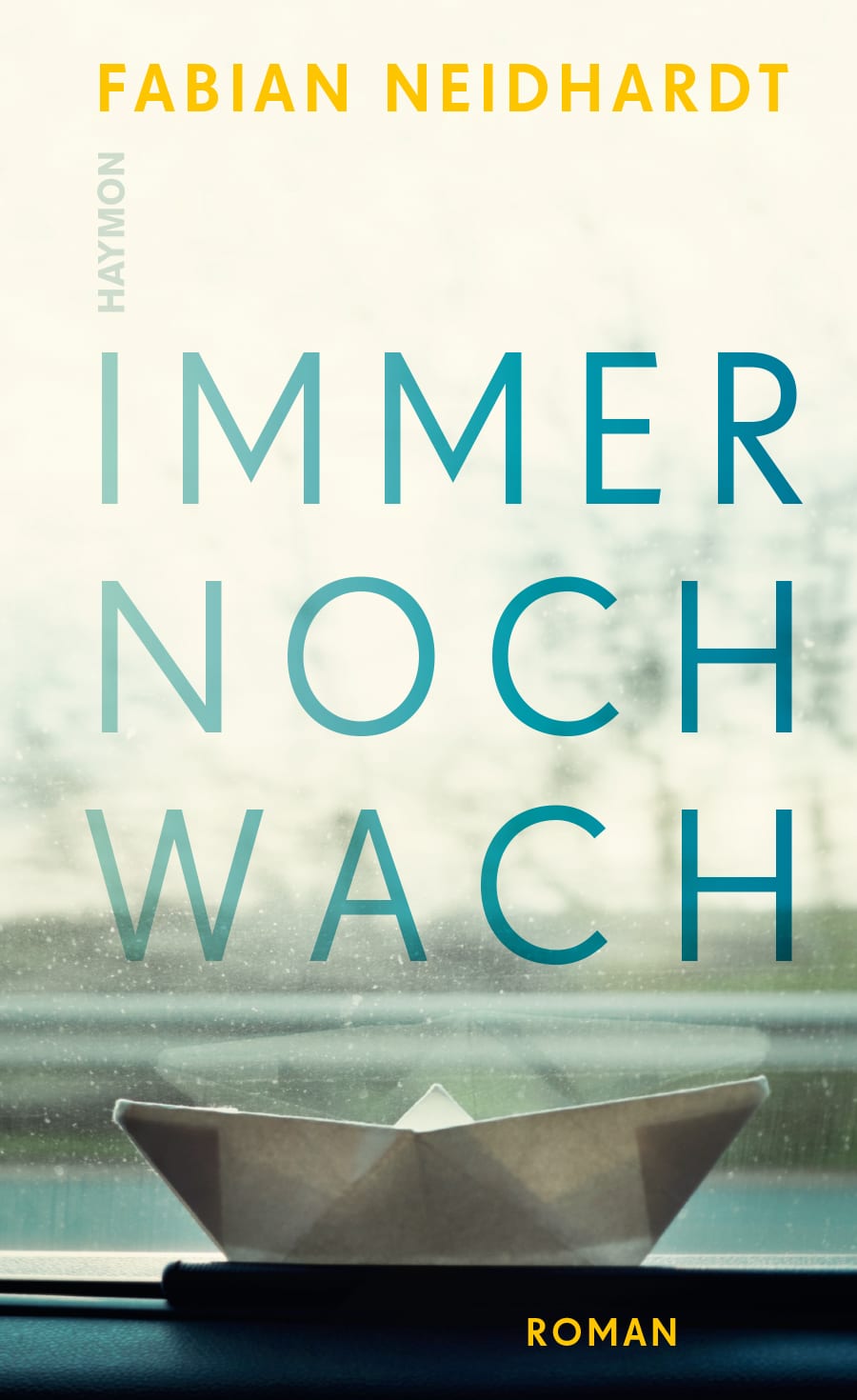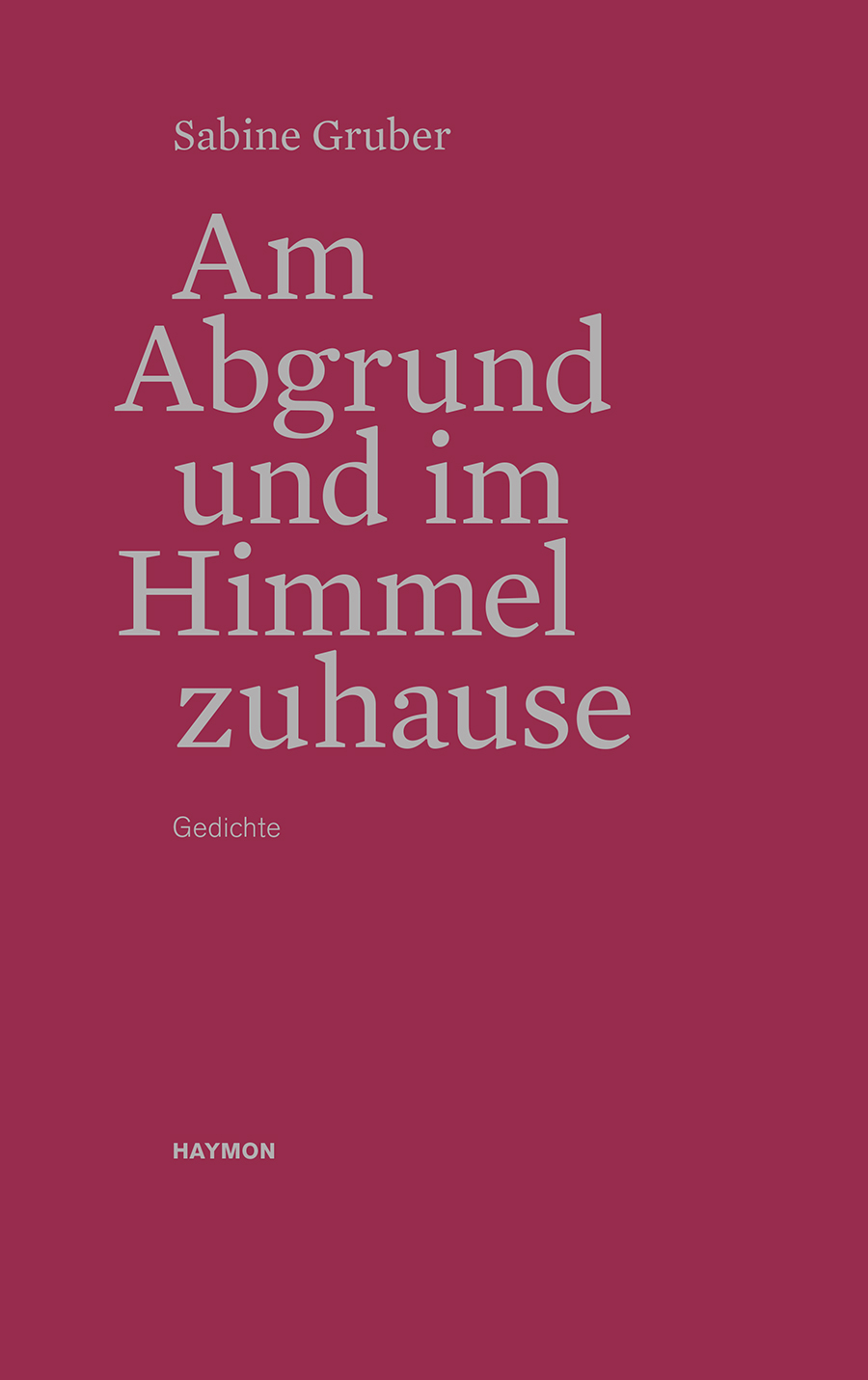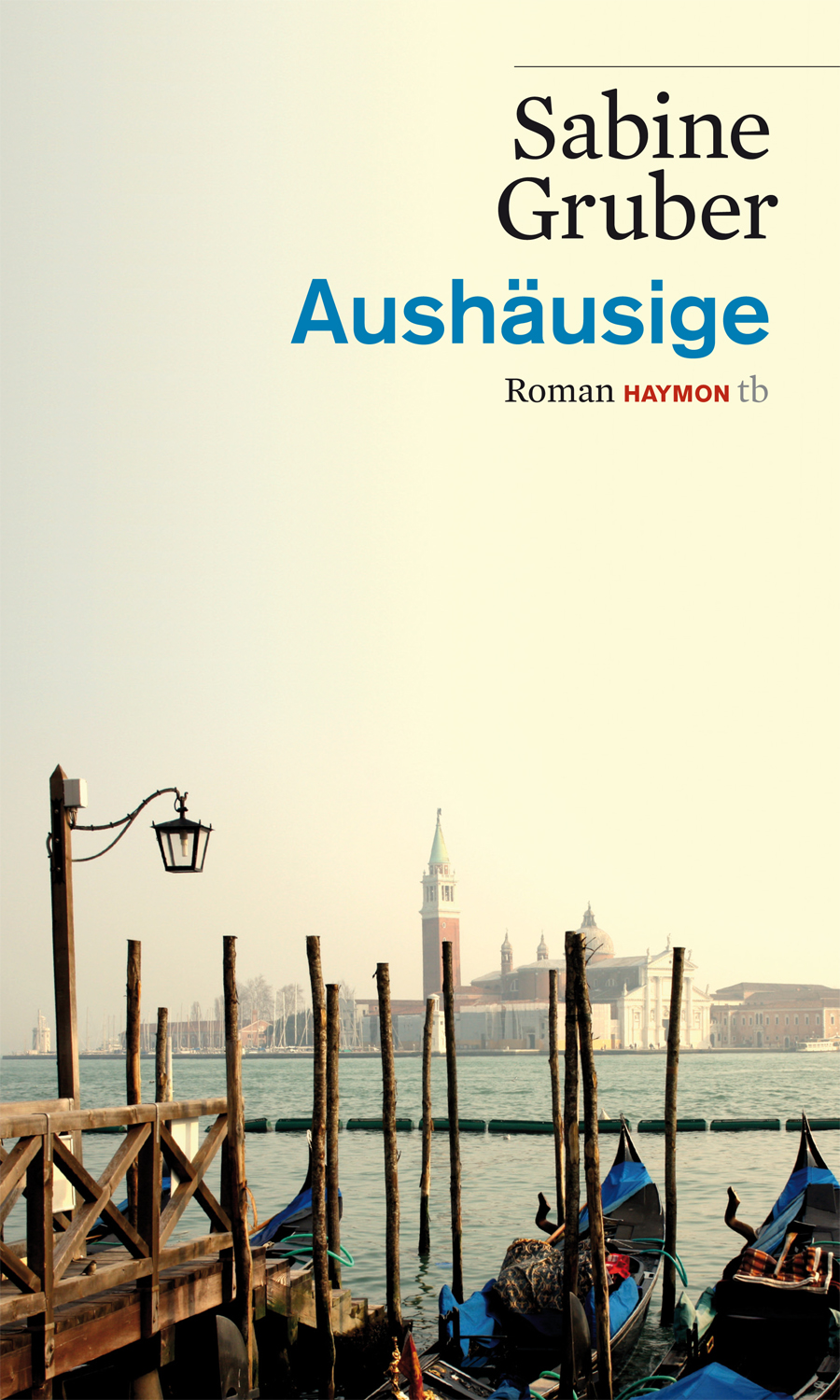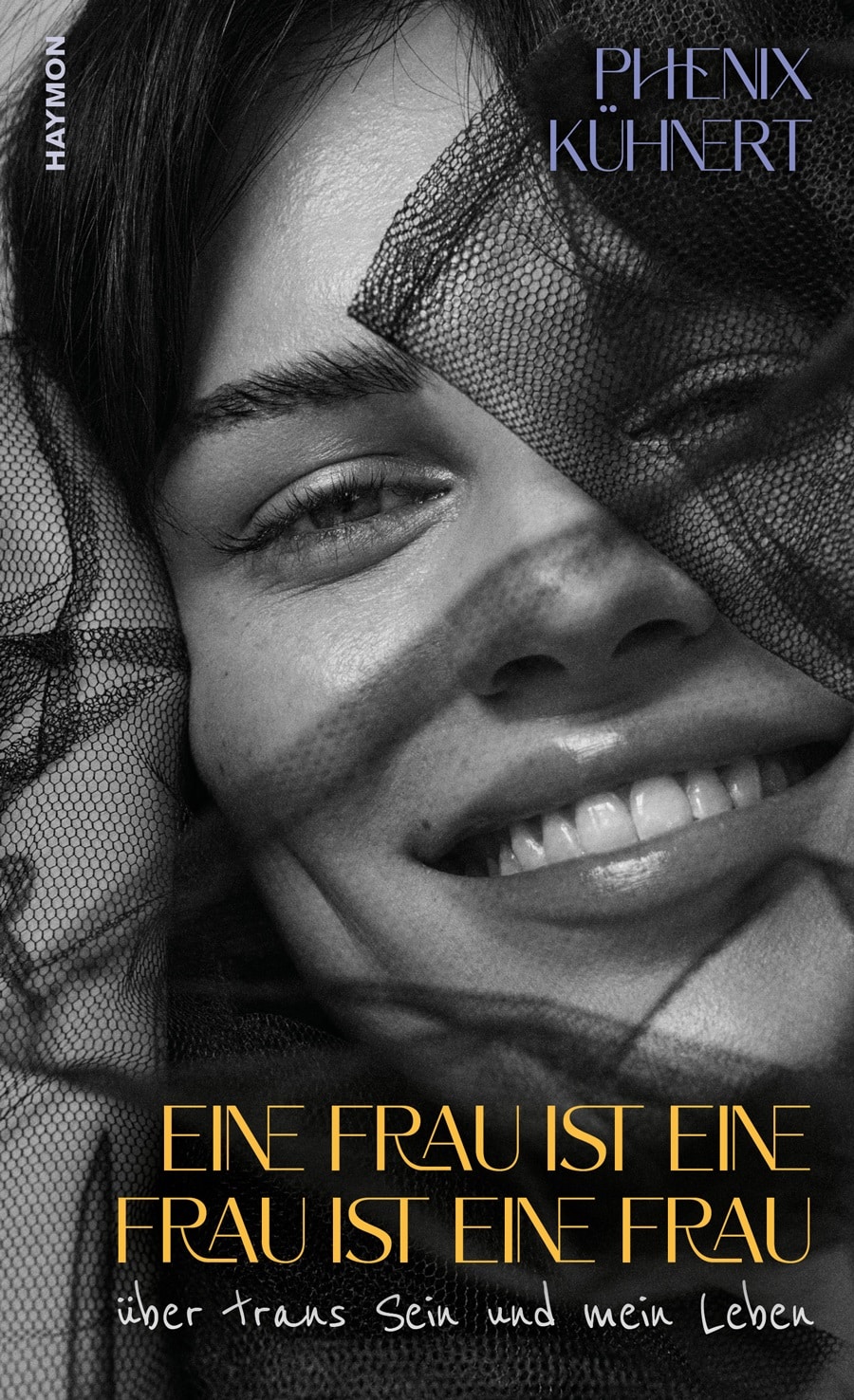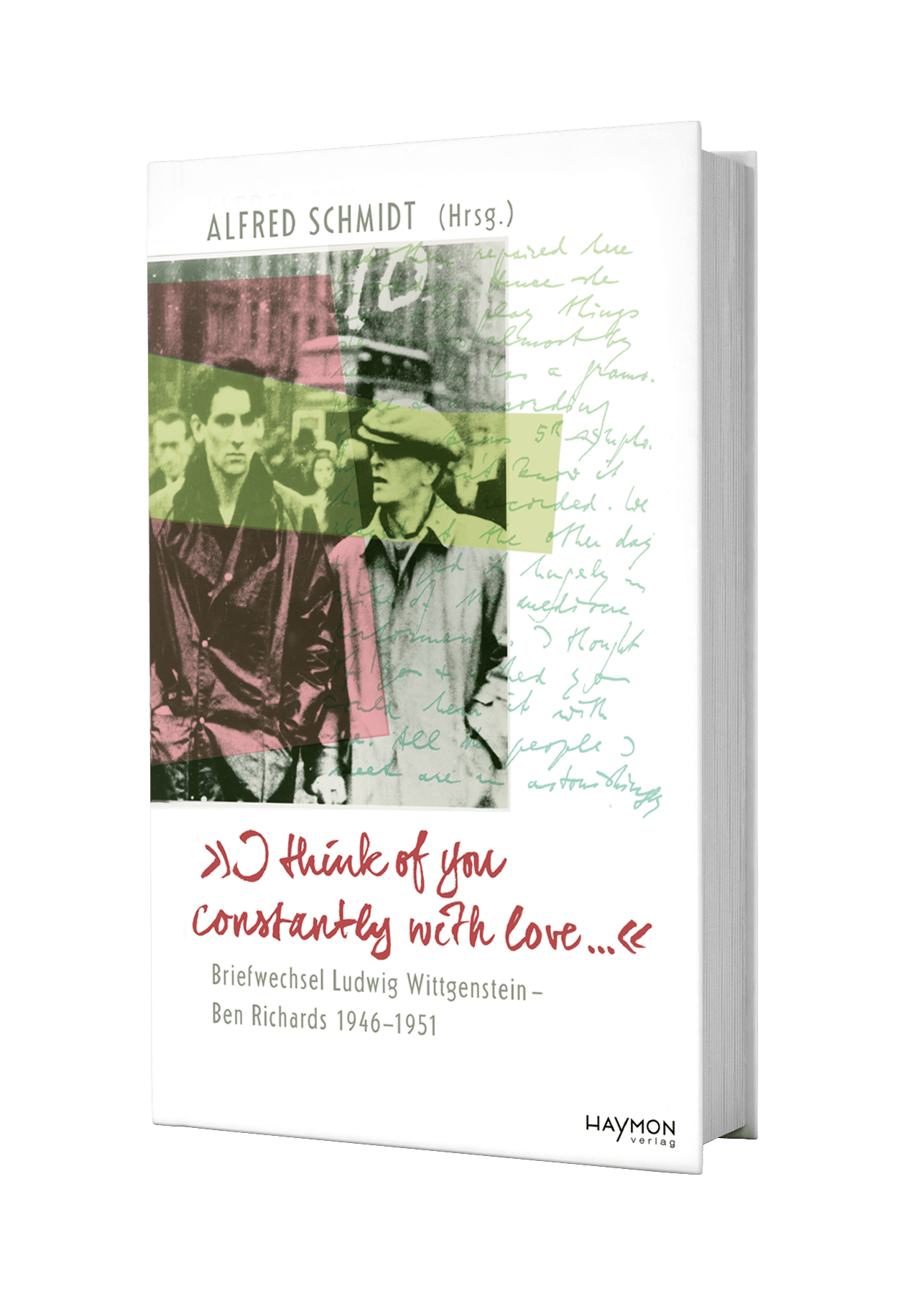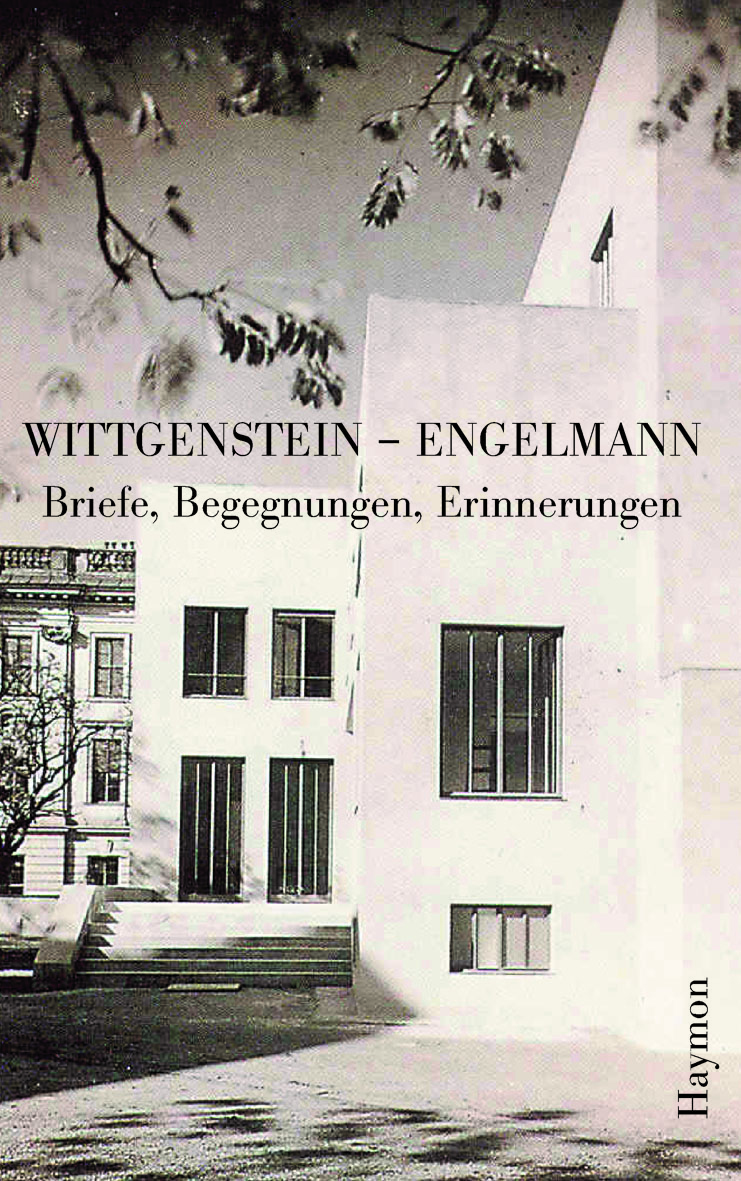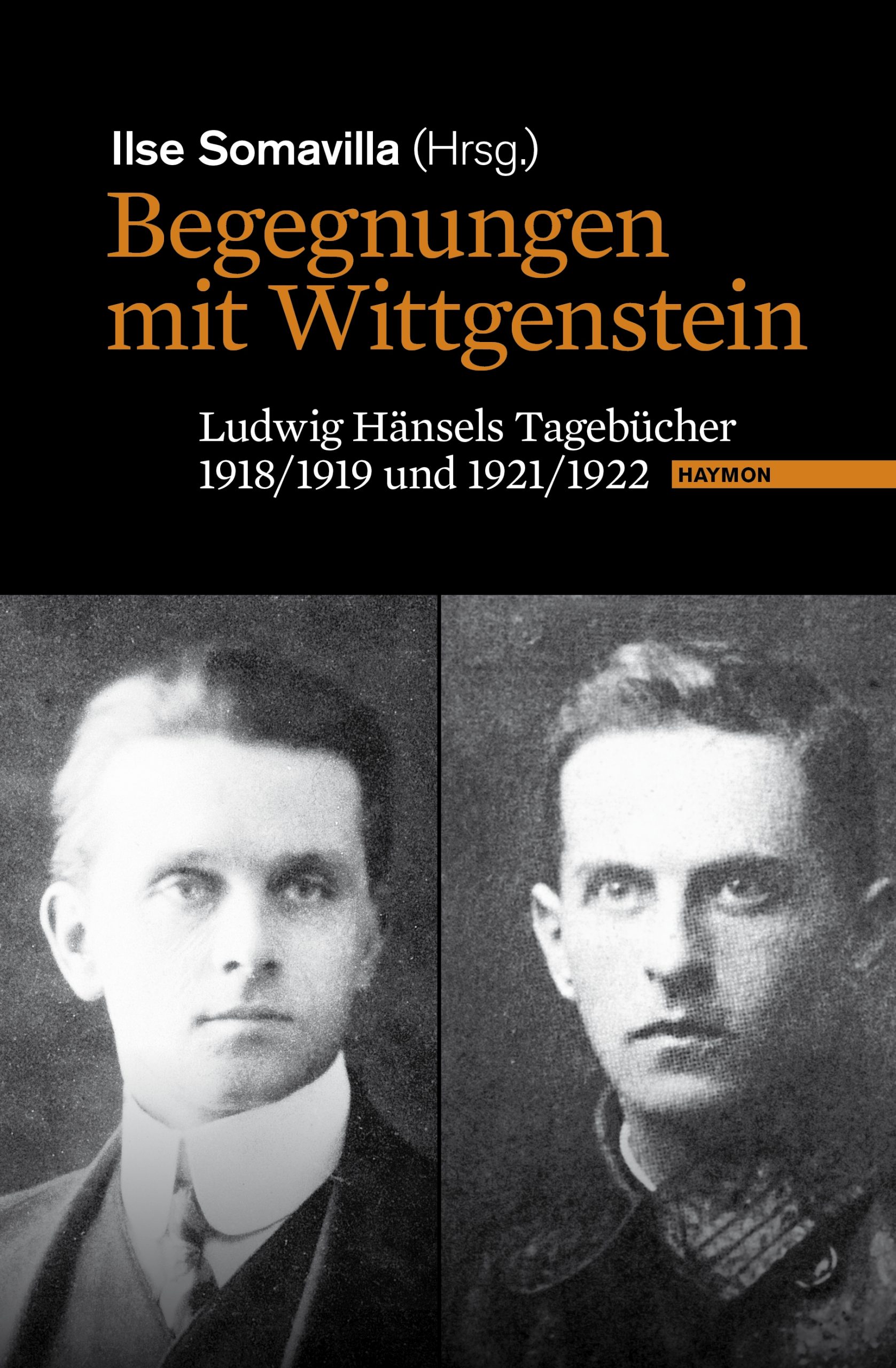Eure Arbeit erstreckt sich von der Frauenhelpline über Aufklärungsarbeit in verschiedensten Formen bis hin zur Umsetzung von EU-weiten Projekten und Kampagnen. All dies eint das Ziel, über das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder zu informieren und dafür zu sensibilisieren. Diese angesprochene Gewalt ist dabei sehr vielschichtig und komplex und wirkt sich auf das ganze Leben der Betroffenen aus. Könnt ihr uns erklären, was es für Frauen und auch Kinder bedeutet, häuslicher Gewalt ausgesetzt zu sein?
Frauen sind vielen verschiedenen Formen von Gewalt ausgesetzt: körperlicher, sexueller, psychischer und ökonomischer Gewalt sowie Gewalt im Internet, die natürlich auch in vielen Fällen ineinandergreifen. Sich in einer gewalttätigen Beziehung wiederzufinden ist ein schleichender Prozess, die Gewalt nimmt oft mit der Zeit an Häufigkeit und Schwere zu. In dieser Gewaltspirale wechseln sich Phasen der Kontrolle, Einschüchterung, emotionaler Erpressung/Missbrauch und Aggression mit Phasen von Entschuldigungen und Versprechung von Wiedergutmachung seitens des Täters ab. Den Betroffenen wird auch durch teilweise subtile Manipulationen des Täters die Schuld an seinem Verhalten zugeschoben. Besonderer Gefahr sind Frauen in der Trennungsphase ausgesetzt, in dieser Zeit finden besonders häufig auch Femizide und Fälle von schwerer Gewalt statt. Betroffene Frauen befinden sich oftmals in prekären Abhängigkeitsverhältnissen, vor allem auch, wenn gemeinsame Kinder da sind und es kaum Zugang zu leistbarem Wohnen gibt. All das lässt die Aussage, sich doch „einfach zu trennen“, nicht legitimieren, die schmerzhafte Realität gewaltbetroffener Frauen wird dadurch verharmlost. Die Trennung von einem gewalttätigen Partner ist ein langwieriger, belastender Prozess, sowohl in ökonomischer, juristischer, emotionaler und psychischer Hinsicht. Darüber hinaus ist die Trennung die gefährlichste Phase für eine gewaltbetroffene Frau – zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Morde an Frauen durch einen gewalttätigen Partner begangen. Kinder sind bei häuslicher Gewalt immer mit betroffen – entweder direkt, indem sie selbst Misshandlungen ausgesetzt sind, oder indirekt, weil sie die Gewalt, die ihre Mutter erleiden muss, hautnah mitbekommen.
Häufig wird betont, dass Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem ist, bei dem gerade auch staatliche Institutionen nicht genug sensibilisiert sind oder sogar an der Reproduktion von Strukturen beteiligt sind, in denen diese Gewalt möglich ist. Welche strukturellen und politischen Veränderungen müssen stattfinden, um Frauen vor Gewalt zu schützen?
Eigentlich haben wir in Österreich gute Gesetze zum Schutz vor Gewalt, jedoch werden diese oft nicht wirksam angewendet oder ausgeschöpft, z.B. werden gefährliche und polizeibekannte Gewalttäter oft nur auf freiem Fuß angezeigt oder sogar freigesprochen, was oft zu schwereren Gewalttaten bis zu Femiziden führt. Obwohl immer mehr Frauen den Mut aufbringen, Anzeige gegen ihre Misshandler zu erstatten, bleibt die Tat für die Gewaltausübenden leider nach wie vor oft ohne ernsthafte Konsequenzen.
Für eine echte Gleichstellungs- und Gewaltschutzpolitik wäre das Wichtigste eine langfristige und gesicherte Finanzierung. Das Budget des Frauenministeriums und spezifisch der Bereich für Gewaltprävention ist grundsätzlich (auch im Vergleich zu anderen Ressorts und Ministerien) viel zu niedrig. Angesichts der immens hohen Folgekosten von Gewalt braucht es eine Erhöhung der Mittel für das Frauenministerium. Dringend finanziert werden müsste z.B. auch eine langfristige österreichweite Bewusstseinskampagne gegen Gewalt an Frauen, besonders auch für die breitere Bekanntwerdung der Nummer der Frauenhelpline (0800 222 555). Darüber hinaus benötigt es 3000 neue Vollzeitstellen im Gewaltschutzbereich und für Betreuung und Begleitung der betroffenen Frauen und ihrer Kinder.
Frauen werden in unserer Gesellschaft strukturell abgewertet – frauenspezifische Tätigkeiten wie Care-Arbeit, also Kindererziehung, Haushalt oder die Pflege kranker oder älterer Angehöriger, werden schlecht bis gar nicht entlohnt. Oft sind diese Tätigkeiten unsichtbar und werden als selbstverständlich hingenommen. Es findet eine Ausbeutung dieser reproduktiven Tätigkeiten statt, die oft rund um die Uhr geleistet werden. An diesen Ausbeutungsverhältnissen gilt es anzusetzen, es muss eine gerechte Entlohnung, z.B. in Pflegeberufen, gewährleistet werden und eine gesellschaftliche Aufwertung dieser Tätigkeiten stattfinden.
Um betroffenen Frauen wirkungsvoll helfen zu können, braucht es Wissen – Wissen um diese strukturellen Probleme und um die Faktoren, die Gewalt gegen Frauen begünstigen. Wann sind Frauen, wann bin ich selbst besonders gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden?
Gewalt an Frauen passiert überall auf der Welt und ist ein weltweites Problem. Sie kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor und hängt weder mit Einkommen oder Bildung, noch mit der Herkunft oder Staatszugehörigkeit zusammen – Frauen bzw. Migrantinnen aus anderen Herkunftsländern sind also generell nicht häufiger von Gewalt betroffen, jedoch haben es gewaltbetroffene Migrantinnen aufgrund von prekären Lebensumständen (Flucht, etc.) besonders schwer, sich aus einer Situation häuslicher Gewalt zu befreien. Diese Faktoren bzw. Hindernisse machen die Situation von gewaltbetroffenen Migrantinnen im Vergleich zu betroffenen Österreicherinnen schwieriger.
Ein besonders wichtiger Faktor, um der Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken bzw. sie zu verhindern, ist die Prävention gegen Gewaltbereitschaft. Was sind eurer Meinung nach sinnvolle Präventionsmaßnahmen?
Wie in anderen Ländern leben wir auch in der österreichischen Gesellschaft in einem Patriarchat. Gewalt ist ein Mittel, um Frauen auf die ihnen zugeschriebene Rolle zu verweisen.
Es fehlen langanhaltende, flächendeckende und umfassende Kampagnen zum Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, um das Bewusstsein und das Wissen in der breiten Bevölkerung zu erhöhen. Eine gute und effektive Maßnahme, um patriarchalen und frauenverachtenden Einstellungen in der Gesellschaft entgegenzuwirken, sind möglichst flächendeckende Präventionsworkshops und Seminare in Schulen zu häuslicher Gewalt und Geschlechtergerechtigkeit, besonders auch für Burschen zu den Themen toxische Männlichkeit und stereotypische Frauen- und Männerbilder, um Gewalt schon im Vorhinein zu verhindern.
Viele betroffene Frauen schämen sich für das, was ihnen passiert, oft kommt es zu einer Täter-Opfer-Umkehr und sie sind gesellschaftlichen Verurteilungen ausgesetzt. Wie kommt es zu den vielen Vorurteilen, mit denen dieses Thema behaftet ist, und wo muss hier ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden? Wie kann das am besten gelingen?
Trotz aller Fortschritte seit den 1970er Jahren ist das Thema geschlechtsspezifische Gewalt leider immer noch mit Scham assoziiert. Es wird selten darüber gesprochen und oft bekommen die Betroffenen vom Umfeld keinen Rückhalt, sie werden noch immer für die Tat des Mannes verantwortlich gemacht (sogenanntes victim blaming). Das hat leider oft zur Folge, dass sich gewaltbetroffene Frauen keine Hilfe holen.
Patriarchale Vorstellungen von Geschlecht spielen dabei ebenfalls eine große Rolle. Wir haben in Österreich seit Jahren Regierungen mit Beteiligung (rechts-)konservativer Parteien – im rechten bzw. konservativen politischen Spektrum wird Gewalt an Frauen verharmlost und oft als ein „importiertes Problem“ dargestellt. Gewalt von Männern gegenüber Frauen wird immer noch viel zu oft im Sinne eines patriarchalen Männlichkeitsbildes mit „Männer sind halt so“ abgetan und verharmlost und diese Männer werden auf diese Weise nicht zur Verantwortung für ihr eigenes Verhalten gezogen.
Auch verbale Gewalt an Frauen wird oft gesellschaftlich toleriert und Hass im Netz hat sich in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Hierbei hat die Verrohung der Sprache im Umgang und Diskurs deutlich zugenommen. Gewalt durch Worte ist auch psychische Gewalt und der Weg von der psychischen Gewalt zur körperlichen Gewalt ist oft ein kurzer.
In der Berichterstattung der Medien über Gewalt an Frauen, besonders im Boulevard, werden leider nach wie vor immer wieder patriarchale Klischees reproduziert. Immer noch werden Fälle von Gewalt von Männern an Frauen als „Familientragödie“, „Beziehungsdrama“ oder „Einzelfall“ verharmlost sowie der Täter entschuldigt. Von den Medien wünschen wir uns, dass Journalist*innen sich über verantwortungsvolle und sensible Berichterstattung zum Thema Gewalt an Frauen und Kindern informieren – z.B. über den vom Verein AÖF erstellten Leitfaden zu verantwortungsvoller Berichterstattung – und diese auch anwenden.
Gemeinsam mit diesem Umdenken muss auch das Gespür dafür geschärft werden, wo jede*r einzelne aktiv werden kann. Wie übernimmt man als Einzelperson Verantwortung und kann betroffenen Frauen am besten helfen?
Um gesellschaftliche Veränderungen zu schaffen, braucht es flächendeckende langfristige Bewusstseinsarbeit. Das kann u.a. durch Projekte, wie das Nachbarschaftsprojekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ erreicht werden, das der Verein AÖF aktuell in mehreren Wiener Bezirken und an insgesamt 25 Standorten in ganz Österreich durchführt.
„StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ ist ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Gesamtpaket in der Gewaltprävention, das alle Menschen, insbesondere Nachbar*innen einlädt und befähigt, sich aktiv gegen Femizide und gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kindern zu engagieren. Es richtet sich explizit und direkt an die Zivilgesellschaft, bindet diese aktiv ein und weist ihnen konkrete und anwendbare Handlungsmöglichkeiten auf, um sie zu involvieren und zu zeigen, was jede*r Einzelne*r beitragen kann. Durch das Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten klärt StoP auf, was bei Verdacht auf Partnergewalt zu tun ist, wie sich Nachbar*innen selbst schützen und wie sie Gewalt verhindern können. Nachbar*innen können z.B. die Gewalthandlung unterbrechen, indem sie anläuten und nach etwas Unverfänglichem fragen (z.B. Zucker ausleihen). Auf diese Weise wird dem Täter signalisiert, dass die Nachbarschaft mithört und der Betroffenen wird signalisiert, dass sie nicht allein ist. Nachbar*innen verbünden sich mit anderen Personen, wie Familie und Freund*innen, informieren sich und überlegen, wie sie helfen können. Zudem können Nachbar*innen betroffene Frauen und Kinder niederschwellig über wichtige Notrufnummern, wie z.B. die Frauenhelpline 0800 222 555, Anlaufstellen, etc. informieren. StoP ermutigt Personen, eine klare Haltung gegen (häusliche) Gewalt/Partnergewalt einzunehmen, genau hinzuschauen und zivilcouragiert zu handeln. Entsprechend ist StoP auch ein Appell an die österreichische Zivilgesellschaft, sich aktiv einzusetzen und sich eindeutig und klar gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu positionieren. Mehr Informationen auf stop-partnergewalt.at.