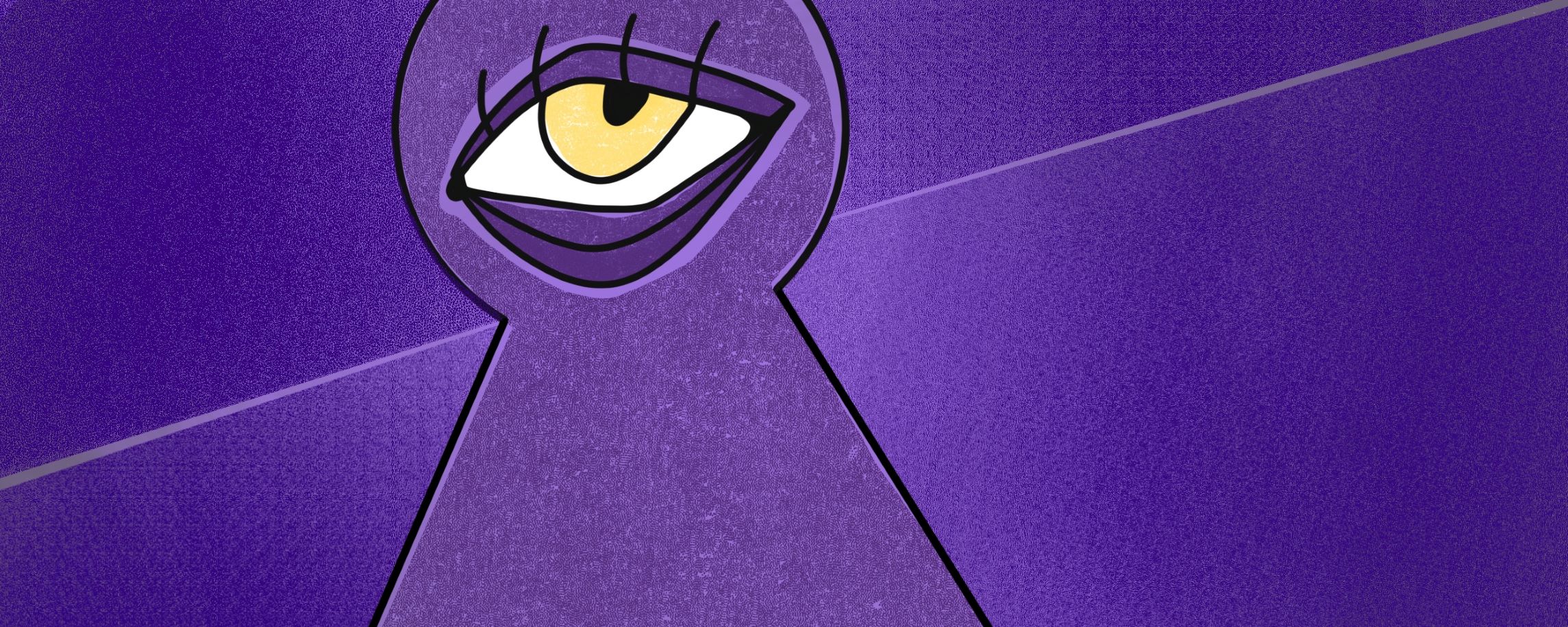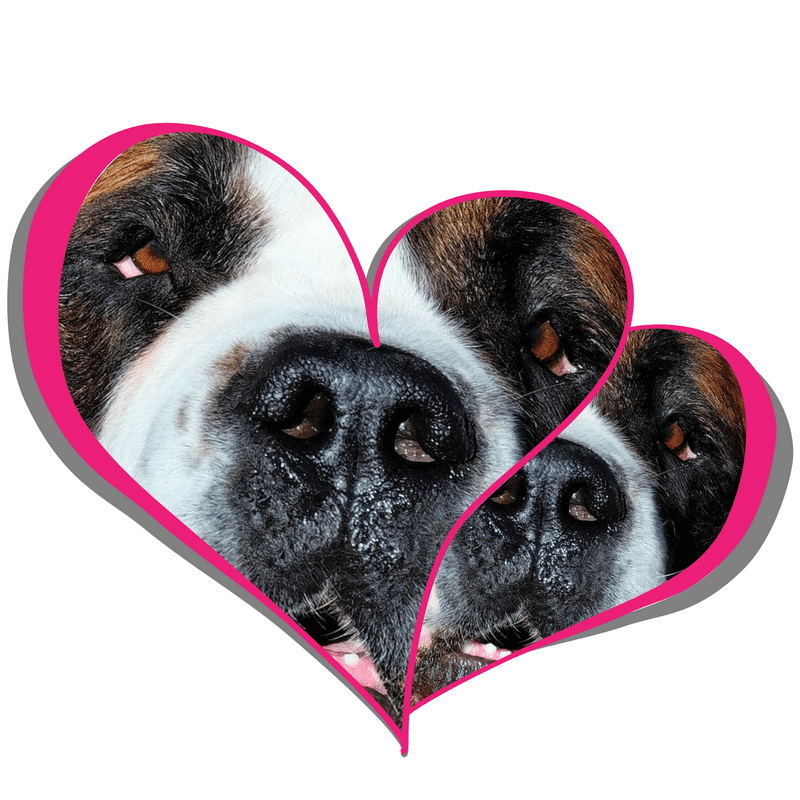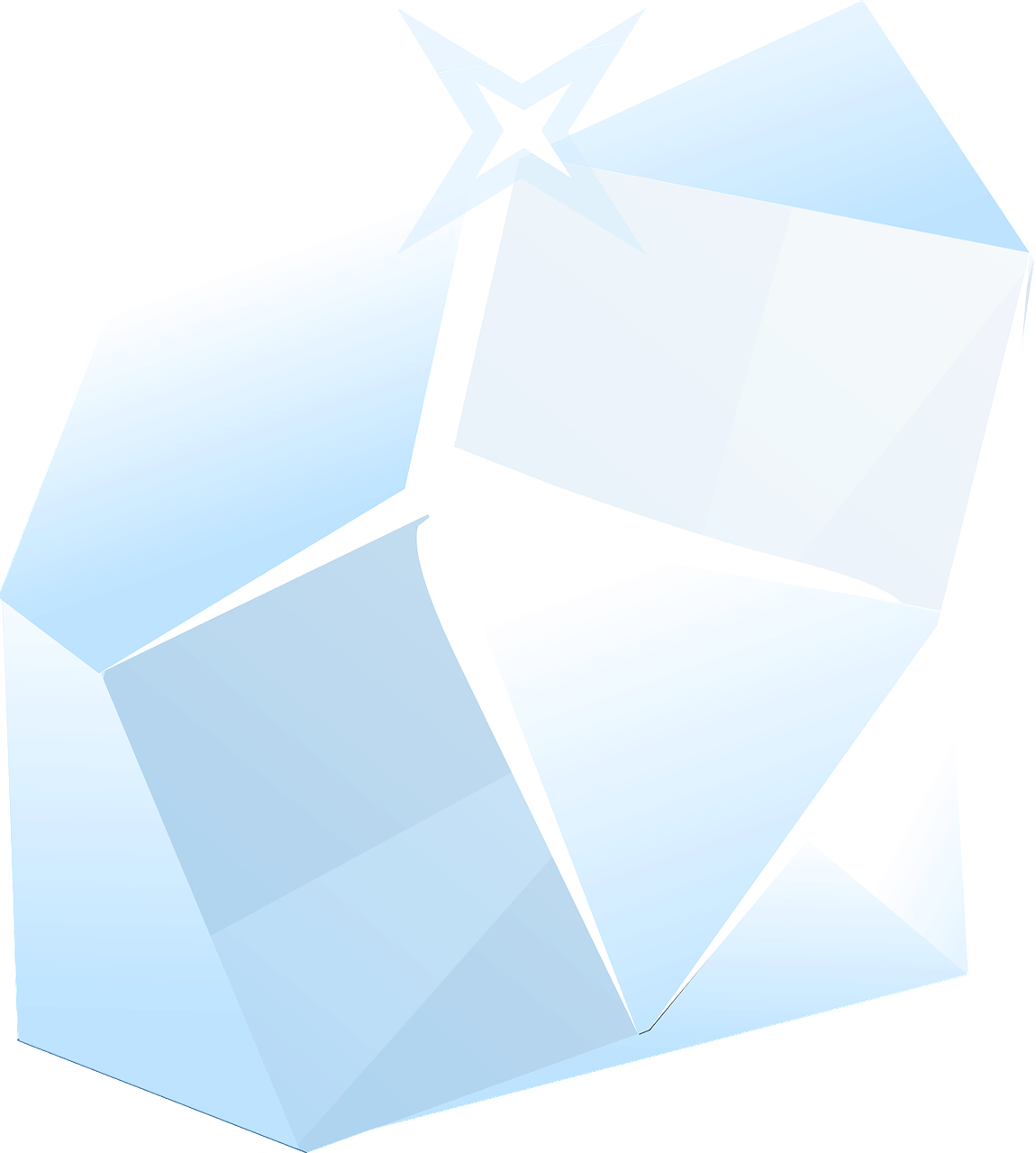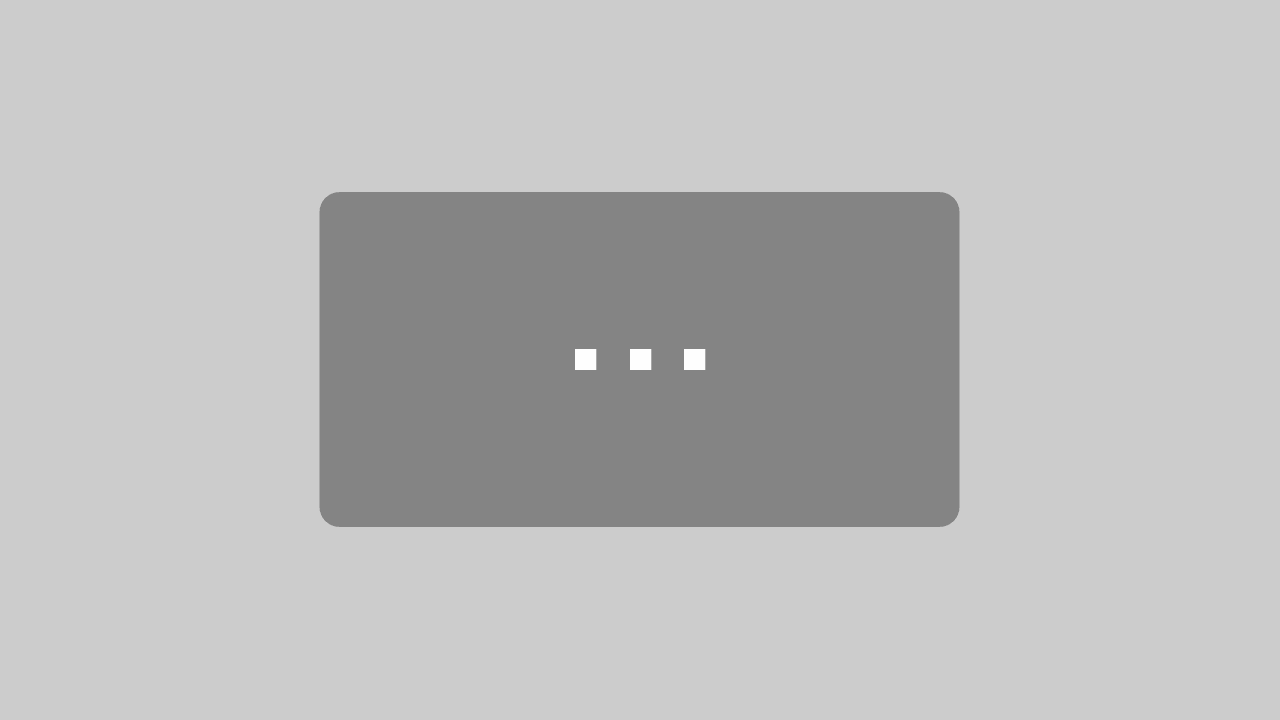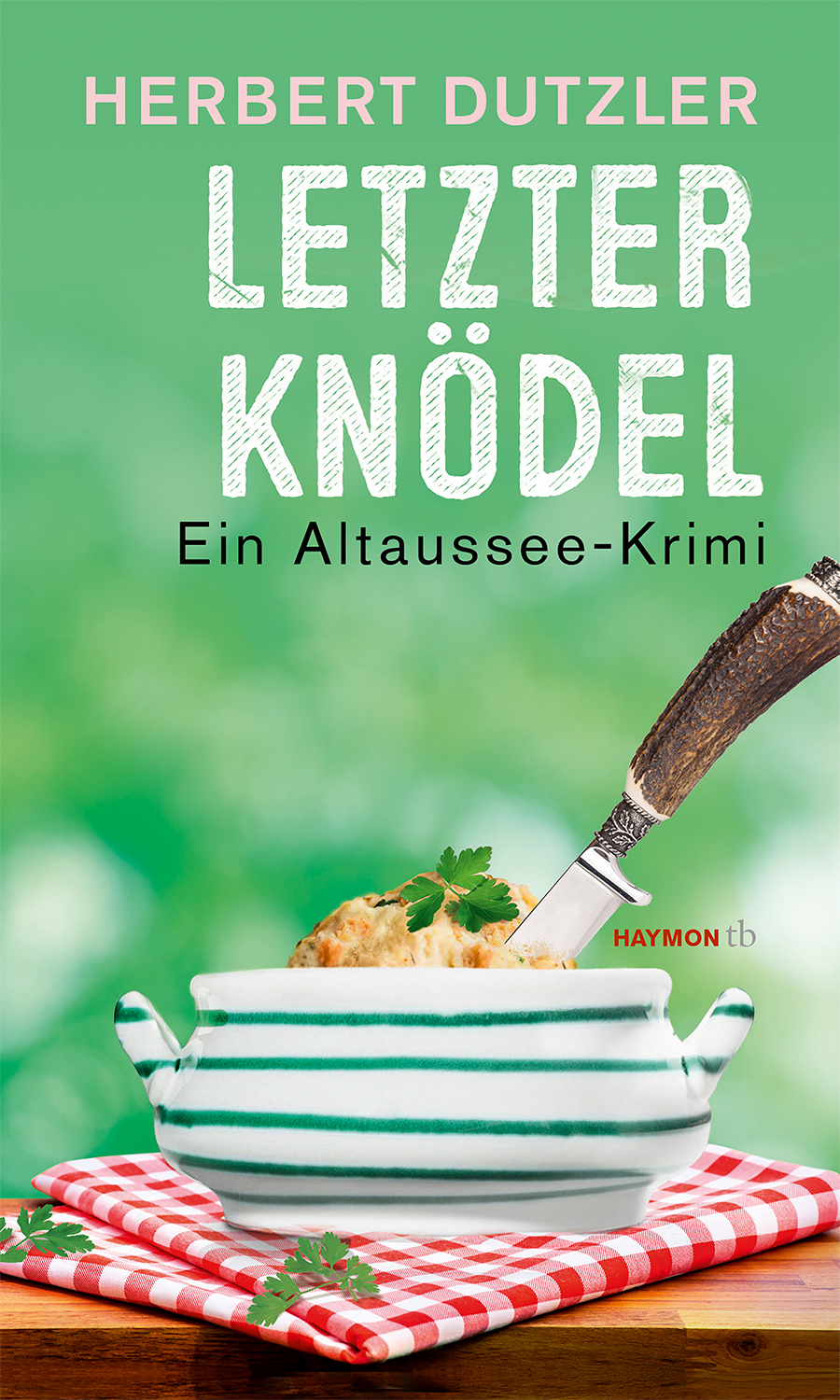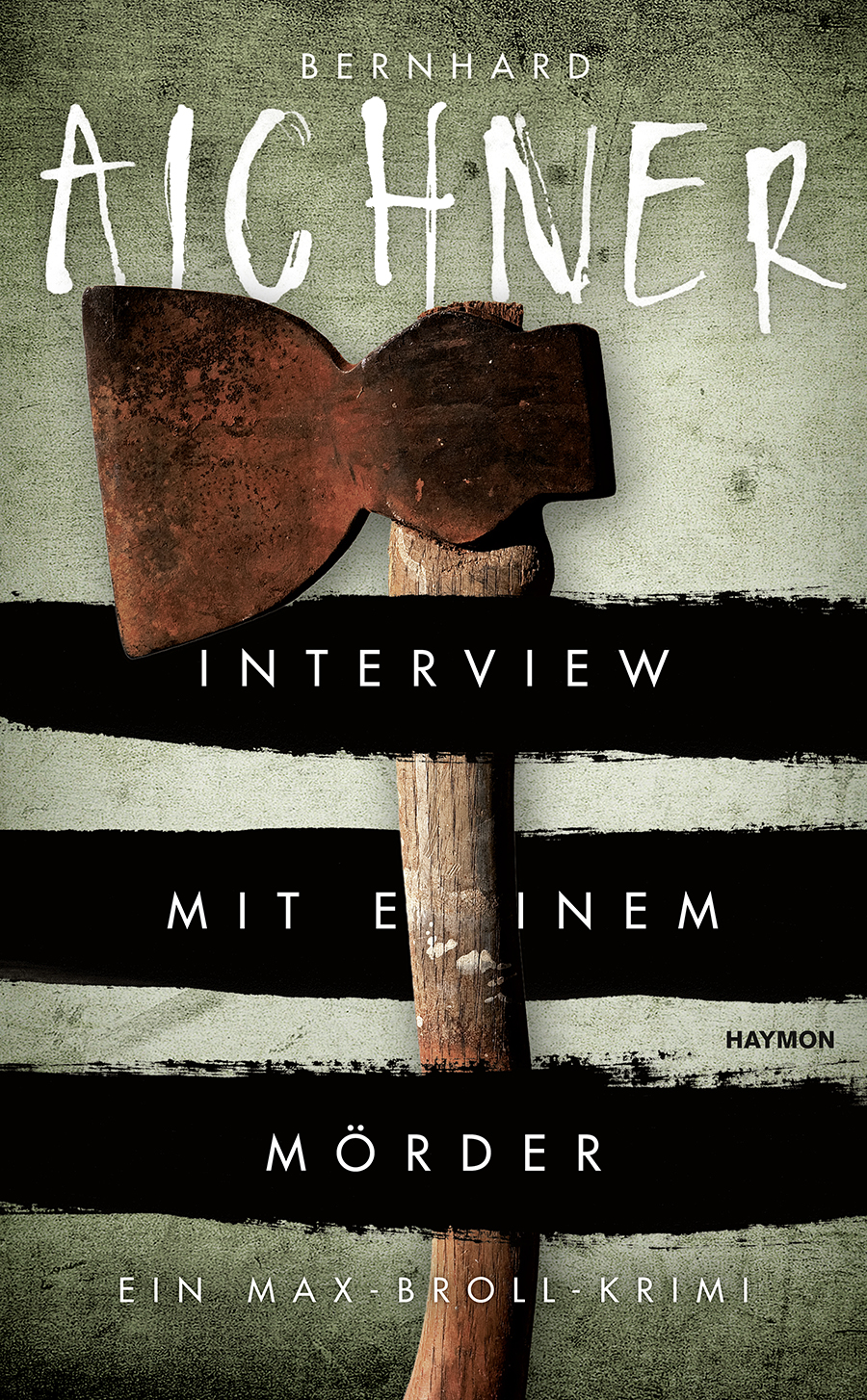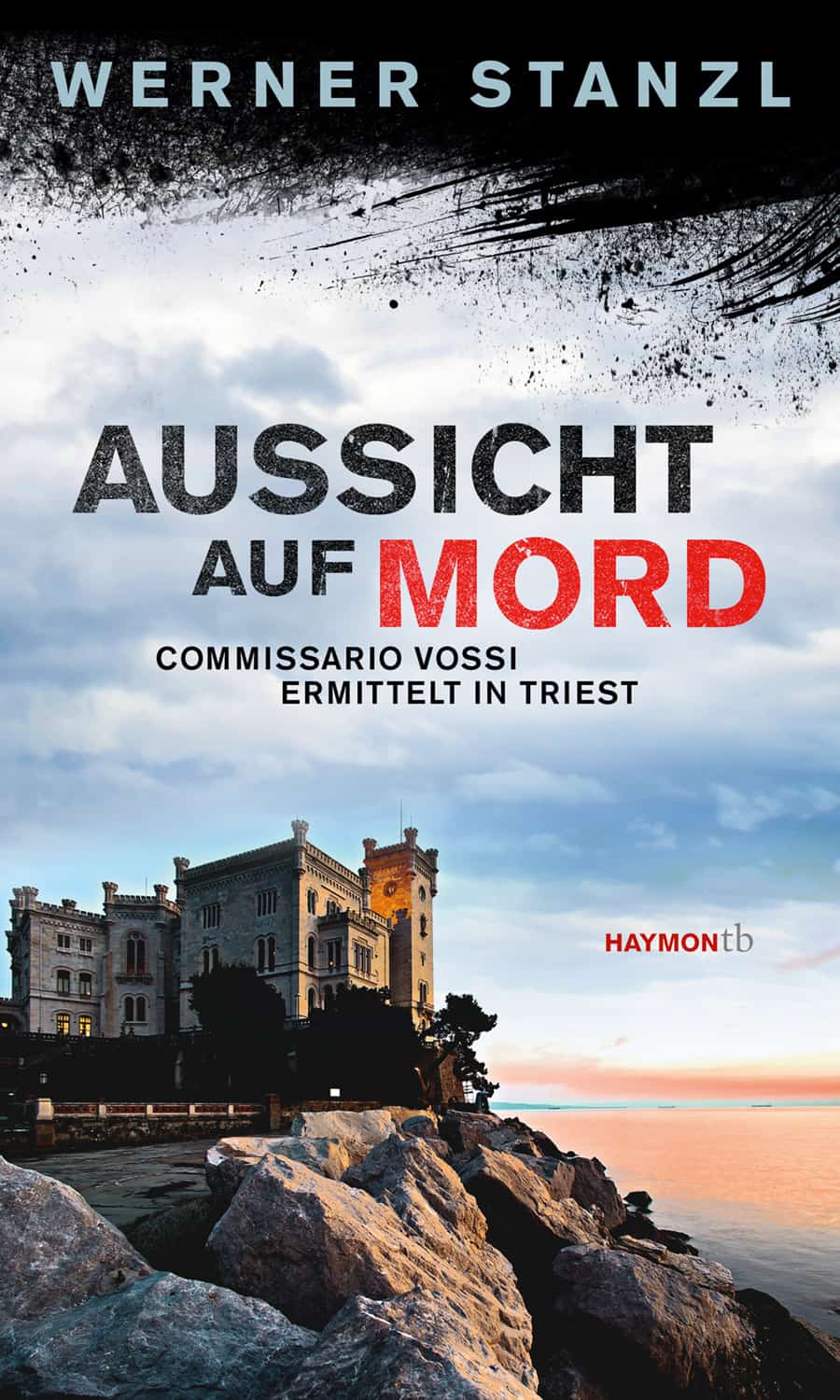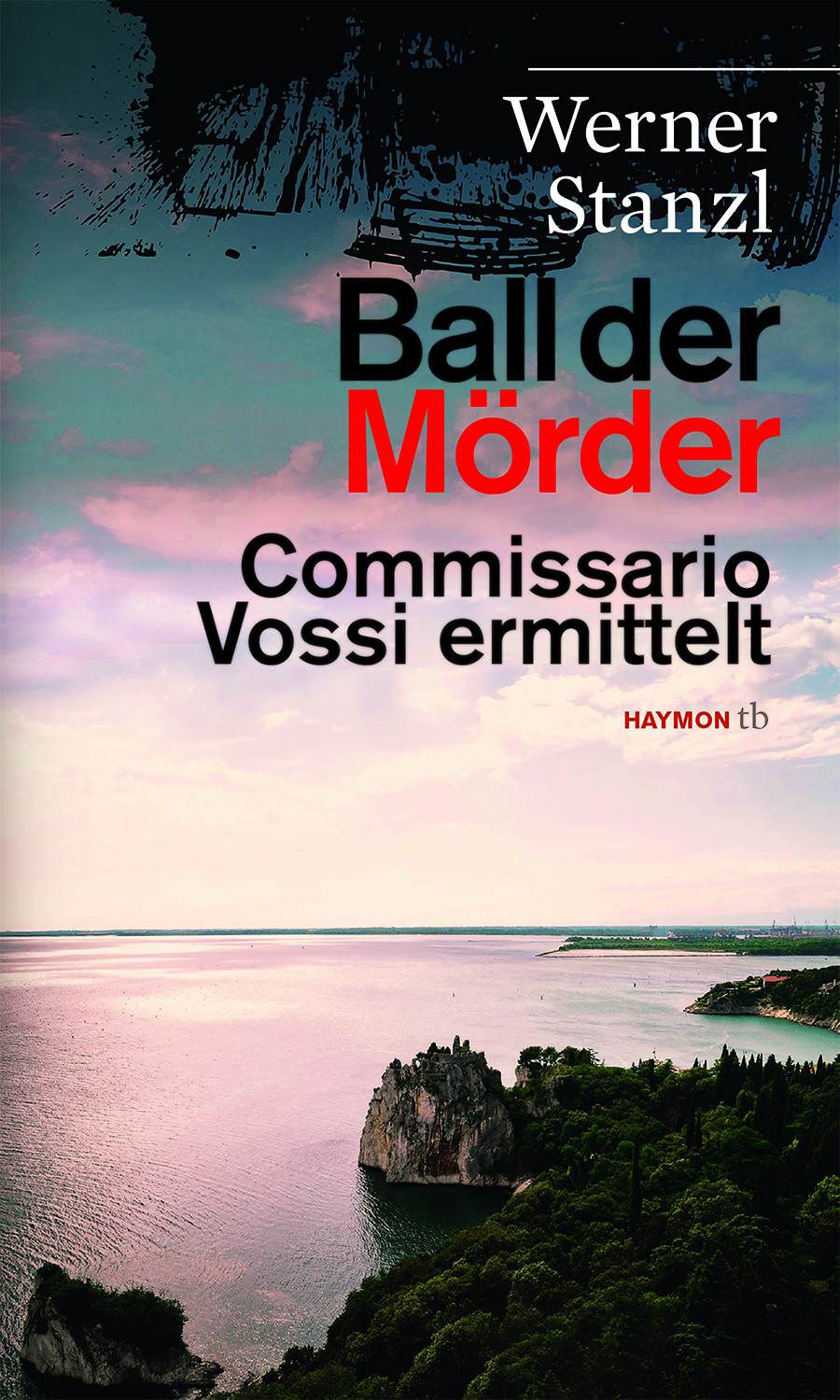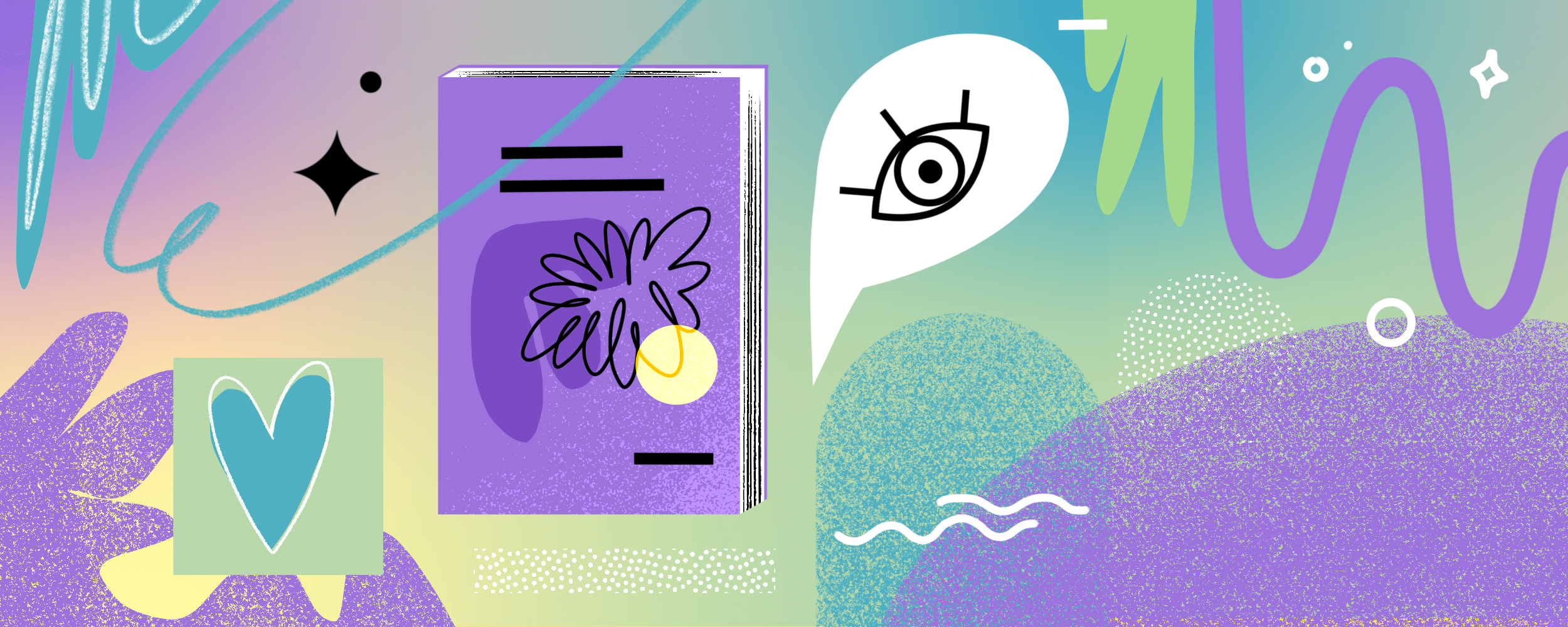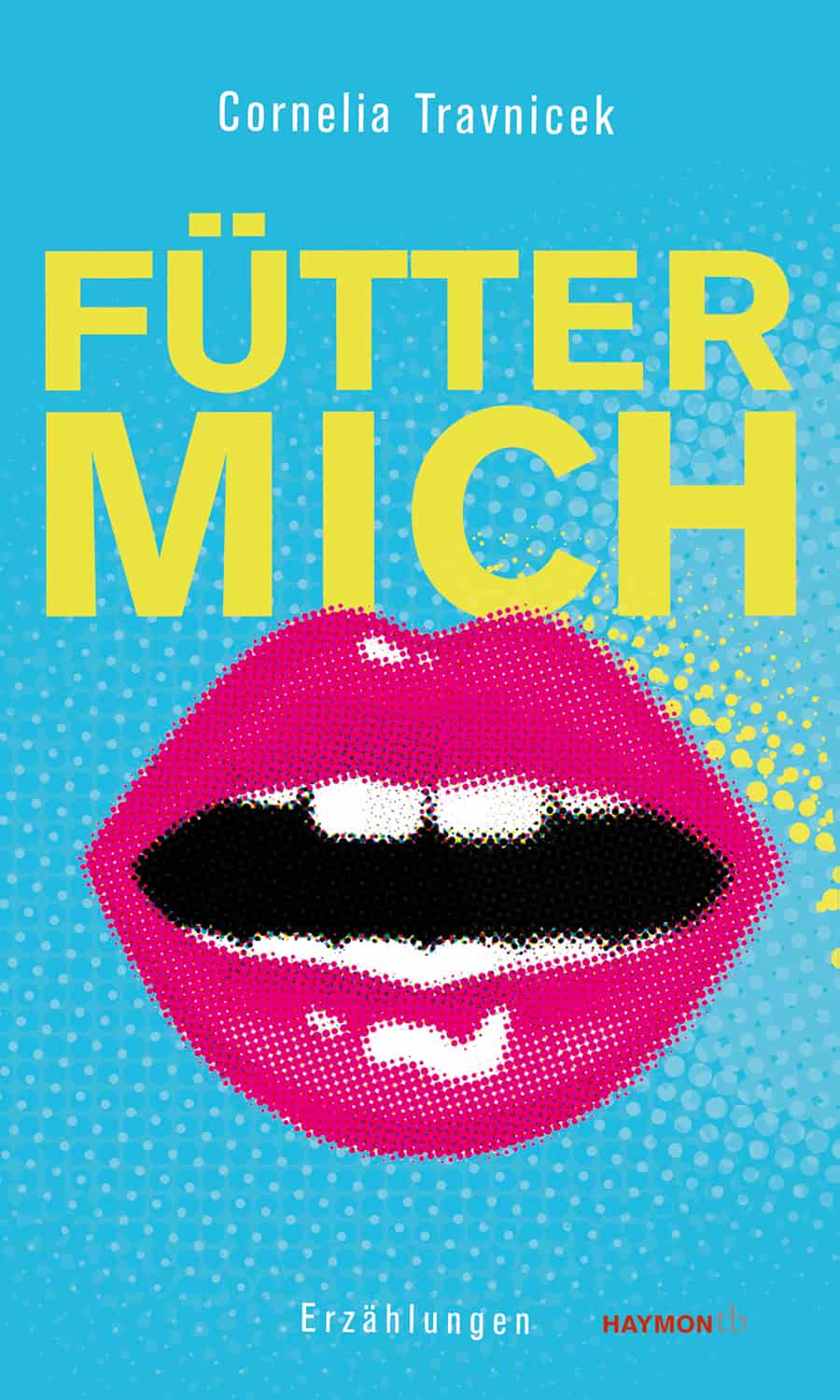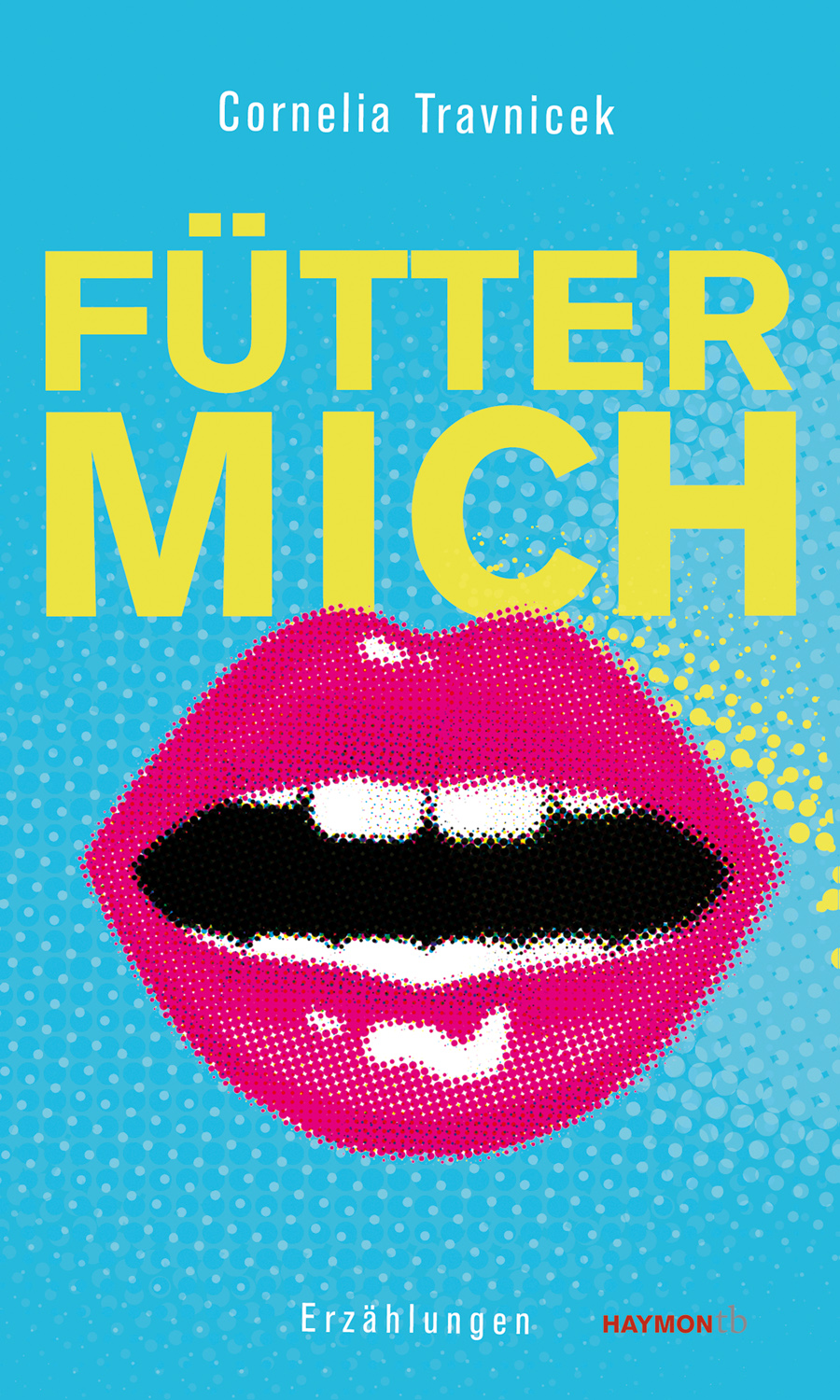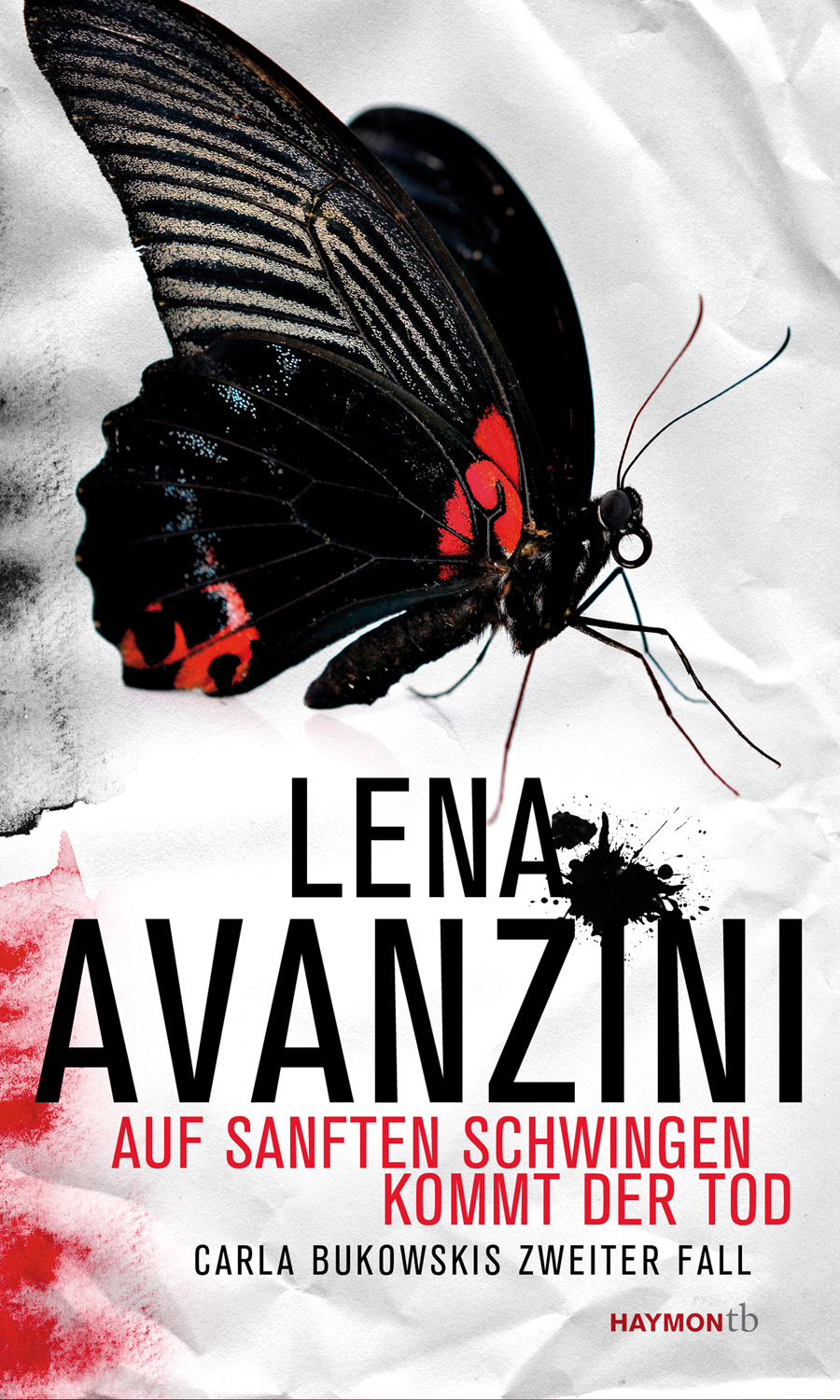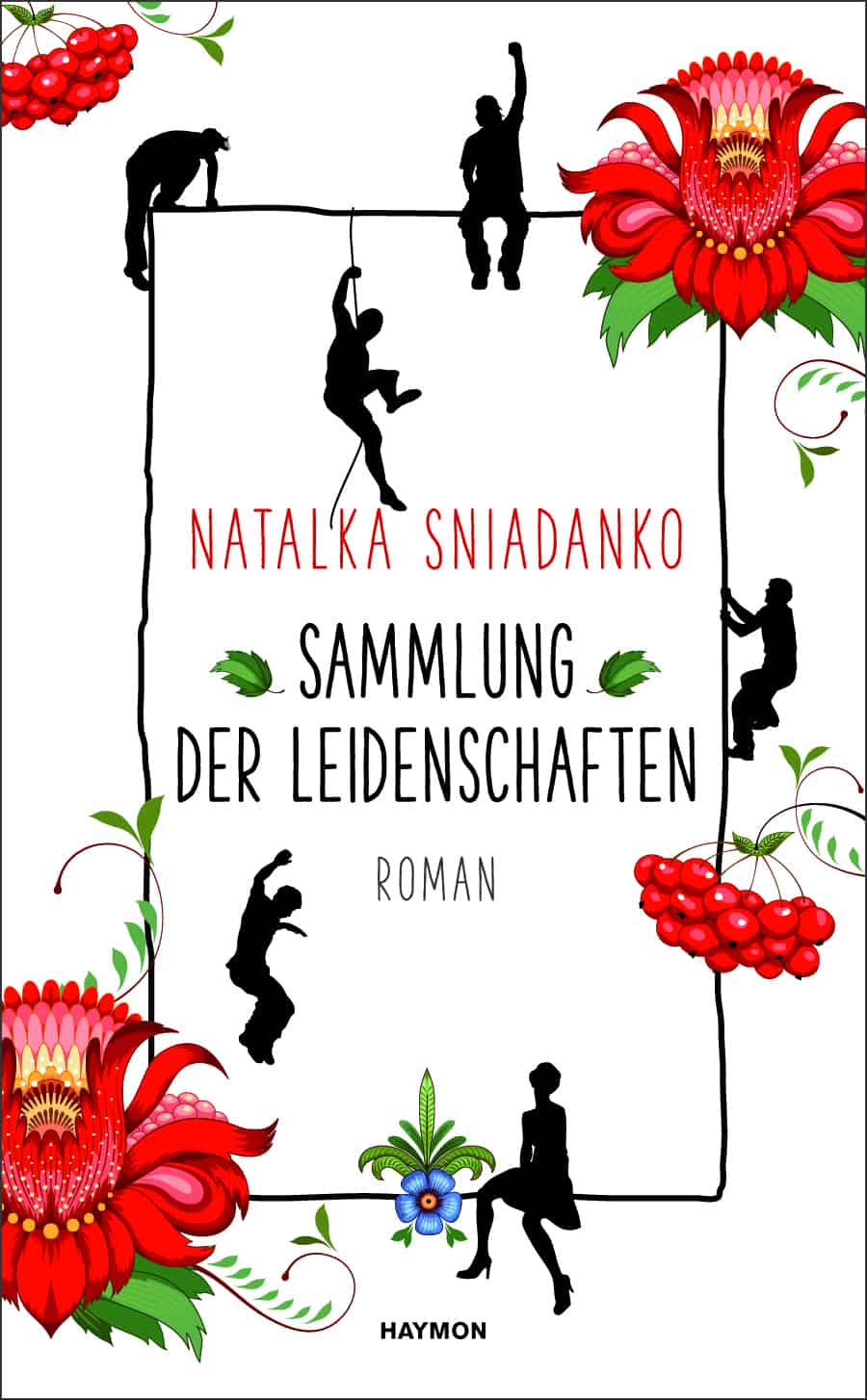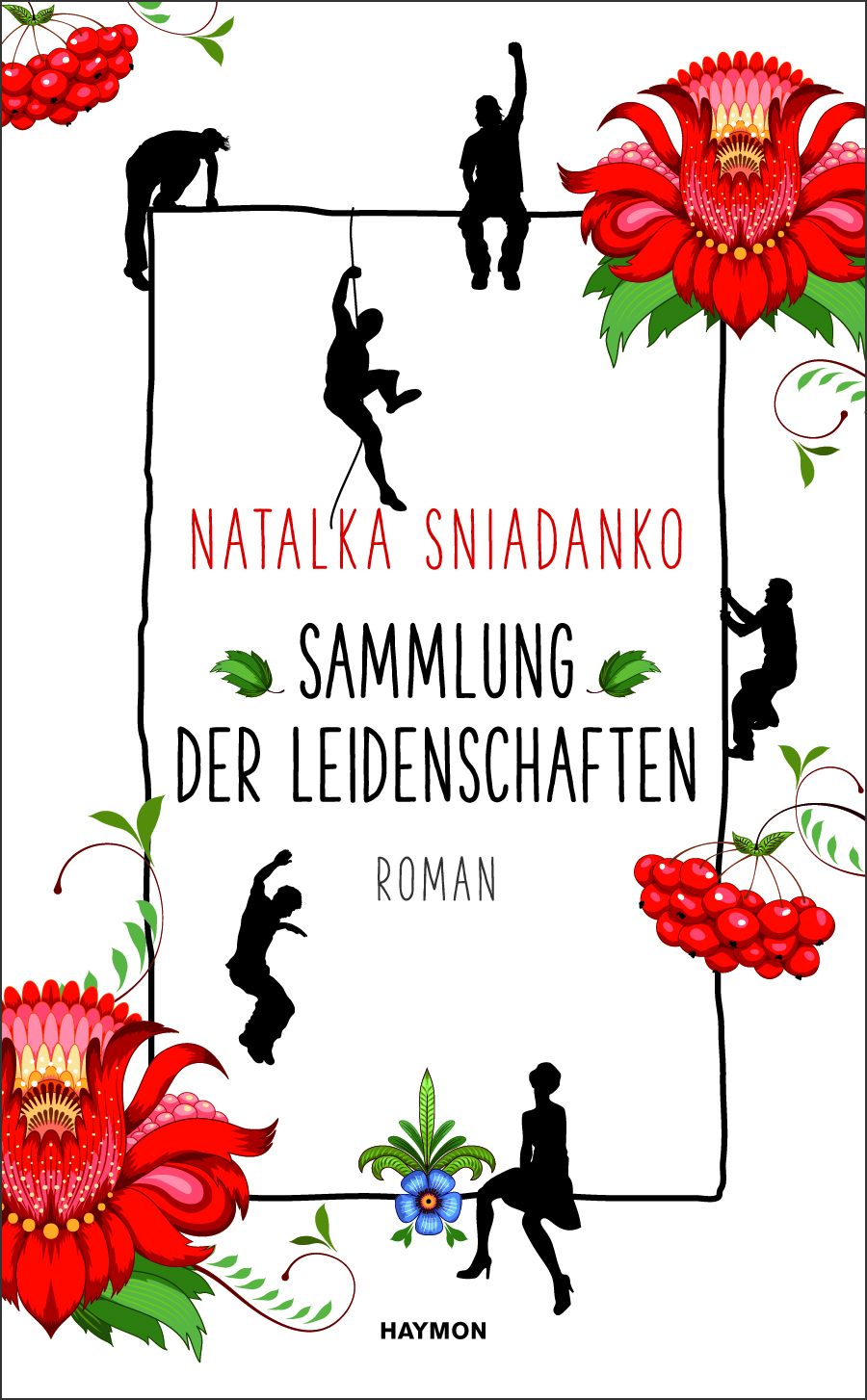„Heimat sind für mich Menschen, Literatur und Musik” – ein Gespräch mit Selim Özdogan

Selim Özdogan. Foto: Tim Bruening
Nach den Romanerfolgen Die Tochter des Schmieds und Heimstraße 52 erzählt Selim Özdoğan die Geschichte seiner Protagonistin Gül weiter, mit der er bereits einen großen Leserkreis in seinen Bann gezogen hat. Eine einfache Frau mit wenig Bildung, aber mit einem guten und weisen Herzen, voller Lebenserfahrung. Sie erfährt, was es bedeutet, Heimat zu verlieren und neue Heimat zu finden – nicht nur durch die Migrationserfahrung, auch durch die Entfremdung von der Familie und von der Welt der Kindheit. Mit der Zeit jedoch lernt sie umzugehen mit den Schmerzen, die einem das Leben zufügt. Denn da ist das Licht, das immer noch brennt, nämlich im eigenen Herzen.
Wir haben mit Selim Özdogan über Zerrissenheit, Identität und über Sprache gesprochen. Kann ein Buch die öffentliche Wahrnehmung einer Bevölkerungsgruppe beeinflussen? Kann ein Roman die Art und Weise verändern, wie wir über Themen wie Heimat sprechen? Oder sind Geschichten in erster Linie Geschichten und sollten nicht für politische Erklärungen vereinnahmt werden?
Sehen Sie selbst – ein aufschlussreiches Interview zu einem lesenswerten Buch:
„Es gibt zwei große Fehler, die man in seinem Leben machen kann: Der erste ist, die Heimat zu verlassen, der zweite ist zurückzukehren.“
Yılmaz spricht in „Wo noch Licht brennt“ ein universelles Dilemma an, das den allermeisten bekannt sein dürfte, die ihr Zuhause zurückließen und in der Ferne von der alten Heimat träumen. Es ist kein einfaches Verhältnis, das man zu seinem „Vaterland“ und zur „neuen Heimat“ unterhält, oder?
Das ist eine Aussage, die erstmal gut klingt, aber in dem Roman ja ein paar Sätze später wieder gebrochen wird, weil Yılmaz selbst merkt, dass er da romantisiert.
Da ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, wie sich dieses Spannungsfeld von alter und neuer Heimat anfühlt, aber ich glaube, die Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit ist eine menschliche Konstante, die sich mal mehr und mal weniger bemerkbar macht, abhängig von den eigenen Veranlagungen und der eigenen Biographie.
Reichen die ständig wiederkehrenden Schlagworte wie Integration, Inklusion oder das vielzitierte „Zwischen-den-Kulturen-Sein“, um die komplexen Gefühle zu beschreiben, die auch die Figuren in deinem Roman umtreiben?
Ich empfinde Wo noch Licht brennt nicht als einen Roman, der sich mit kulturellen Unterschieden und den daraus resultierenden Problemen und Möglichkeiten beschäftigt, sondern als ein Buch, das einfach nur versucht, möglichst nah bei seiner Hauptfigur zu bleiben.
Brauchen wir eine neue Sprache, neue Narrative, um das zu beschreiben, begreifbar zu machen?
Ich glaube nicht, dass es eine neue Sprache braucht. Sprachgebrauch hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Aus Gastarbeitern sind Ausländer geworden, aus Ausländern Migranten, aus Migranten Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn wir heute ein Wort wie Parallelgesellschaft benutzen ist klar, dass wir damit nicht die Welt des Literaturbetriebs mit seinen eigenen Gesetzen und Regeln meinen. Mir scheint, man findet schneller eher neutral klingende Wort, als sich das Bewusstsein für bestimmte Dinge ändert.
Das, was wir neuerdings gerne Narrativ nennen, also eine Geschichte, die wir auf die Wirklichkeit legen, um Ursachen und Folgen sichtbar zu machen, bleibt immer das: eine Geschichte. Ich glaube, es würde helfen, wenn diese Geschichte sich verschiebt, weg davon kulturelle Unterschiede zur Abgrenzung heranzuziehen, hin dazu menschliche Gemeinsamkeiten greifbarer zu machen.
Fuat scheint im Roman immer unzufrieden zu sein: In Deutschland stört er sich an der Mentalität seiner Umgebung, in der Türkei sehnt er sich nach deutscher Gründlichkeit:
„Gibt es denn kein Maßband und keinen Zollstock in diesem Land? Kann es sein, dass mir ein erwachsener Mann erzählt, bei einer Treppe könnten halt nicht alle Stufen gleich hoch sein, die letzte würde nie hinkommen? Ich bin von Idioten umgeben, seitdem wir dieses Haus renovieren, bin ich nur von Idioten umgeben“.
Fuat ist ein Mensch, der gerne zetert. Seine Unzufriedenheit betrachte ich nicht als in erster Linie von einem Mangel geprägt, den er empfindet, sondern von dem Wunsch sich selber als klüger, besser, geschickter, gerechter zu sehen.
Kann ein Roman die Probleme, Gedanken, Erlebnisse von Menschen wie Gül oder Fuat von einer anderen Seite beleuchten, als dies in der tagtäglichen medialen Repräsentation geschieht?
Ja, einerseits kann ein Roman schon aufgrund seiner Länge ganz anders arbeiten, genauer, differenzierter darstellen, andererseits darf man sich aber nichts vormachen. In der Regel prägt selbst ein Bestseller das öffentliche Bewusstsein weniger als die allgegenwärtige Medienlandschaft.
Kann uns ein Roman in Zeiten der wachsenden politischen Spannungen zwischen Ankara und Berlin Erklärungen liefern? Vielen Menschen war es zum Beispiel angesichts der Volksabstimmung über Erdoğans Präsidialsystem vollkommen unerklärlich, wie so viele ExiltürkInnen entschieden haben.
Ein großes interkulturelles Missverständnis?
In erster Linie gibt es Verkürzungen und Dekontextualisierungen. So sind es in Deutschland, wenn wir uns die Zahlen genauer anschauen, etwas mehr als 10% der Türkeistämmigen, die für das Präsidialsystem gestimmt haben, denn die Wahlbeteiligung war eher gering. Diese Menschen sind in den Schlagzeilen und werden als „die Türken in Deutschland“ betitelt. Als Zahl wird 60% genannt. Was stimmt, es geht um 60% der abgegebenen Stimmen, aber das ist halt nicht respräsentativ für „den Türken”. Man kann diese Wahlentscheidung nicht nachvollziehbar finden und problematisch, aber darum geht es in der Berichterstattung meistens nicht. Es haben auch Menschen in Frankreich und in den USA in den letzten Monaten so gewählt, dass man das problematisch finden kann. Und auch dort wird nach Antworten gesucht, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht darum geht, diese Menschen wirklich zu verstehen, sondern darum klug klingende Theorien zum Warum zu haben.
Der Roman scheint mir nicht der richtige Ort, um diese Art von Fragen und Problematiken zu behandeln, aber wenn jemand etwas anderes behauptet, würde ich auch nicht widersprechen. Literatur lebt von Vielfalt.

„Medien bilden den Teil der Realität ab, der Leser/Klickzahlen bringt. Menschen wie Gül gehören nicht dazu.”
Bei der Lektüre von Wo noch Licht brennt wird einem vor Augen geführt, dass die kopftuchtragenden türkischen Mütterchen, die uns tagtäglich in den Öffis über den Weg laufen, die wir im Supermarkt, im Kindergarten oder im Park treffen, selbstverständlich handelnde, selbstbestimmte Menschen mit Überzeugungen sind, die über ihr Schicksal verfügen, die Entscheidungen treffen, die erzählenswerte, spannende Sachen erleben usw.
Warum treten Frauen wie Gül, die uns in unserem Alltag ständig begegnen, so selten in unserer medialen Wahrnehmung in Erscheinung?
Sie fallen nicht negativ auf. Sie bringen niemanden um, sie hinterziehen keine Steuern, sie prollen nicht herum, sie werden nicht geschlagen, sie wählen möglicherweise nicht mal Erdoğan. Medien bilden den Teil der Realität ab, der Leser/Klickzahlen bringt. Menschen wie Gül gehören nicht dazu.
Sprachen eröffnen neue Welten, hinter Sprachen verbergen sich Denksysteme mit jeweils ganz eigenen Selbstverständlichkeiten, eigenen Regeln. Kann eine Sprache auch Heimat bedeuten?
Ja, Sprache kann auf jeden Fall auch Heimat sein. Die Figur Suzan verbringt in dem Buch die meiste Zeit ihres Lebens in Italien ohne die Türkei zu vermissen. Doch dann sehnt sie sich im hohen Alter zurück nach der Sprache.
Deine Kinder wachsen mehrsprachig auf, oder? Was bedeutet das in Hinblick auf das Thema „Heimat“?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe das immer als Gewinn empfunden. Ein Gewinn, den ich versuche an meine Kinder weiterzugeben, indem ich konsequent türkisch mit ihnen spreche, obwohl sie in einer fast ausschließlich deutschsprachigen Umgebung aufwachsen. Ich weiß nicht, ob und wie meine Kinder den Heimatbegriff eines Tages für sich selbst füllen werden. Heimat sind für mich Menschen, Literatur und Musik. Aber das ist nur etwas, was ich für mich gefunden habe, und nicht etwas, das ich bewusst meinen Kindern vermitteln möchte. Sprache aber schon.
Ein türkisches Sprichwort besagt: „Eine Sprache, ein Mensch. Zwei Sprachen, zwei Menschen.” – („Bir lisan, bir insan. Iki lisan, iki insan.”). Inwiefern trifft das auch auf dich zu?
Es ist ein Sprichwort das zu leicht im Themenfeld von Zerissenheit gedeutet werden kann, zusammen mit den kulturellen Differenzen, dem Zwischen-Seiten-Stehen usw.
Eine Sprache ist eine Perspektive auf die Welt, und je mehr Perspektiven man einnehmen kann, desto größer wird das eigene Verständnis. Aber die Fähigkeit, Perspektiven zu verstehen, ist nicht allein auf Sprachkenntnisse beschränkt.
Gibt es Dinge, die man etwa in türkischer Sprache treffender ausdrücken kann als auf Deutsch?
Ich glaube, man kann sich in jeder Sprache etwa gleich gut bestimmten Dingen annähern. Mal schneller, mal langsamer. Ich empfinde Türkisch als die emotional präzisere Sprache. Es gibt drei verschiedene Worte für Herz, abhängig davon, ob wir das Organ meinen, ob wir eher einen Gemütszustand meinen oder eine emotionale Bewegung Richtung Angst oder Mut. Das heißt aber nicht, dass man diese Dinge auf Deutsch nicht ausdrücken kann, man braucht aber halt mehr als ein Wort, man muss einen Kontext schaffen oder man muss den Kontext nehmen, der schon vorgefertigt ist. Bei „mir ist ganz schwer ums Herz“ meint man etwas anderes als bei „sich ein Herz nehmen“. Im Türkischen würde man zwei verschiedene Worte gebrauchen. Einerseits sind die Wörter genauer, andererseits geht es eben auch ohne diese Unterscheidung.
Was dennoch verloren geht ist eine Art von Haltung dem Leben gegenüber, die zu dieser Unterscheidung geführt hat. Das kann aber Sprache nicht allein transportieren, dafür braucht man auch den kulturellen Kontext, der sich wiederum nie ganz von der Sprache trennen lässt.
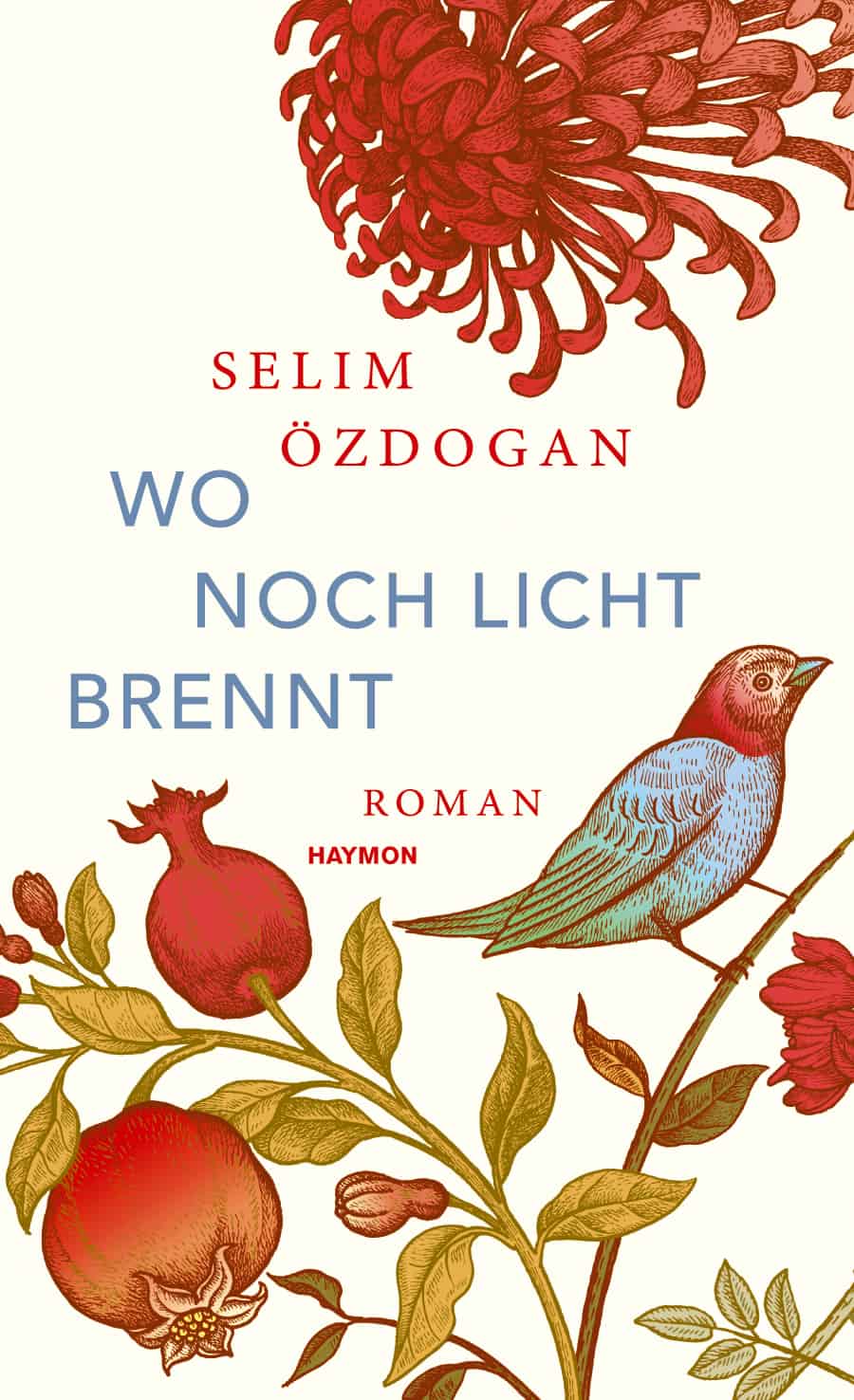
Werfen Sie hier einen Blick in Selim Özdogans einfühlsamen Roman über Heimat, kulturelle Identität und das Leben zwischen zwei Welten.
„Özdoğan (…) hat mit diesem Roman ein wichtiges Buch geschrieben, denn es erzählt uns vom Innenleben einer fremden Lebenswelt. Von Heimat und Fremde und Zukunft auch. Ohne Sentiment und ohne Schwafelei. Einfach gelungen!“
Buchkultur, Horst Steinfelt