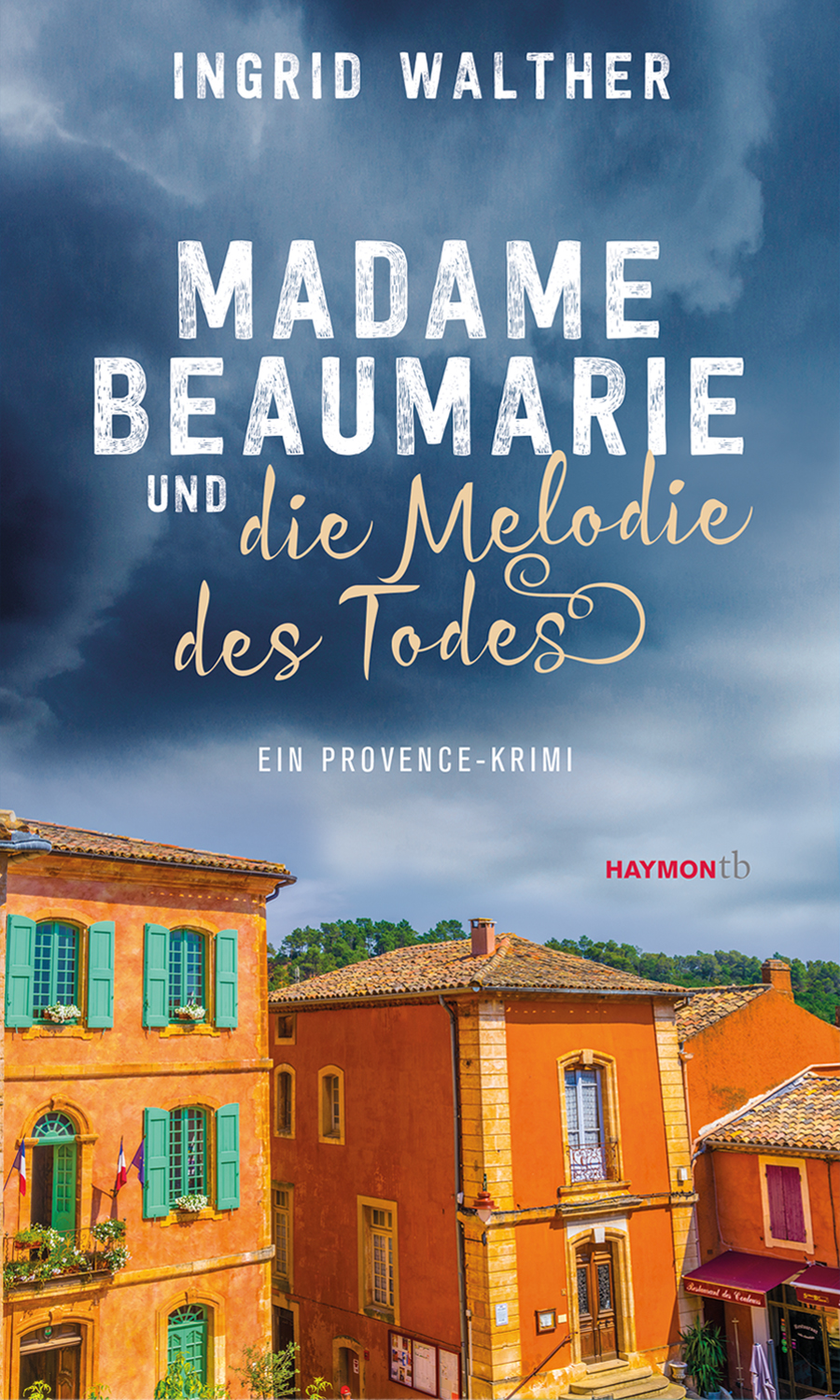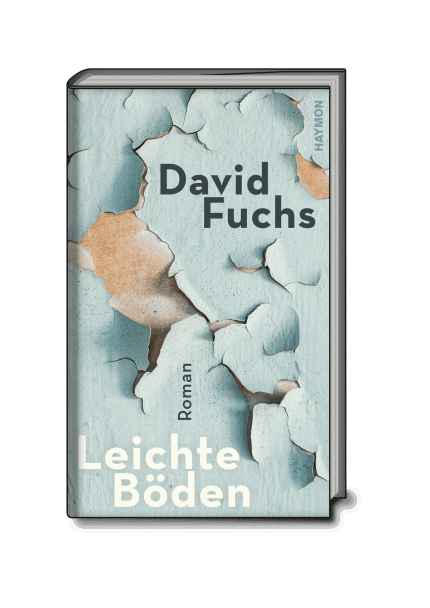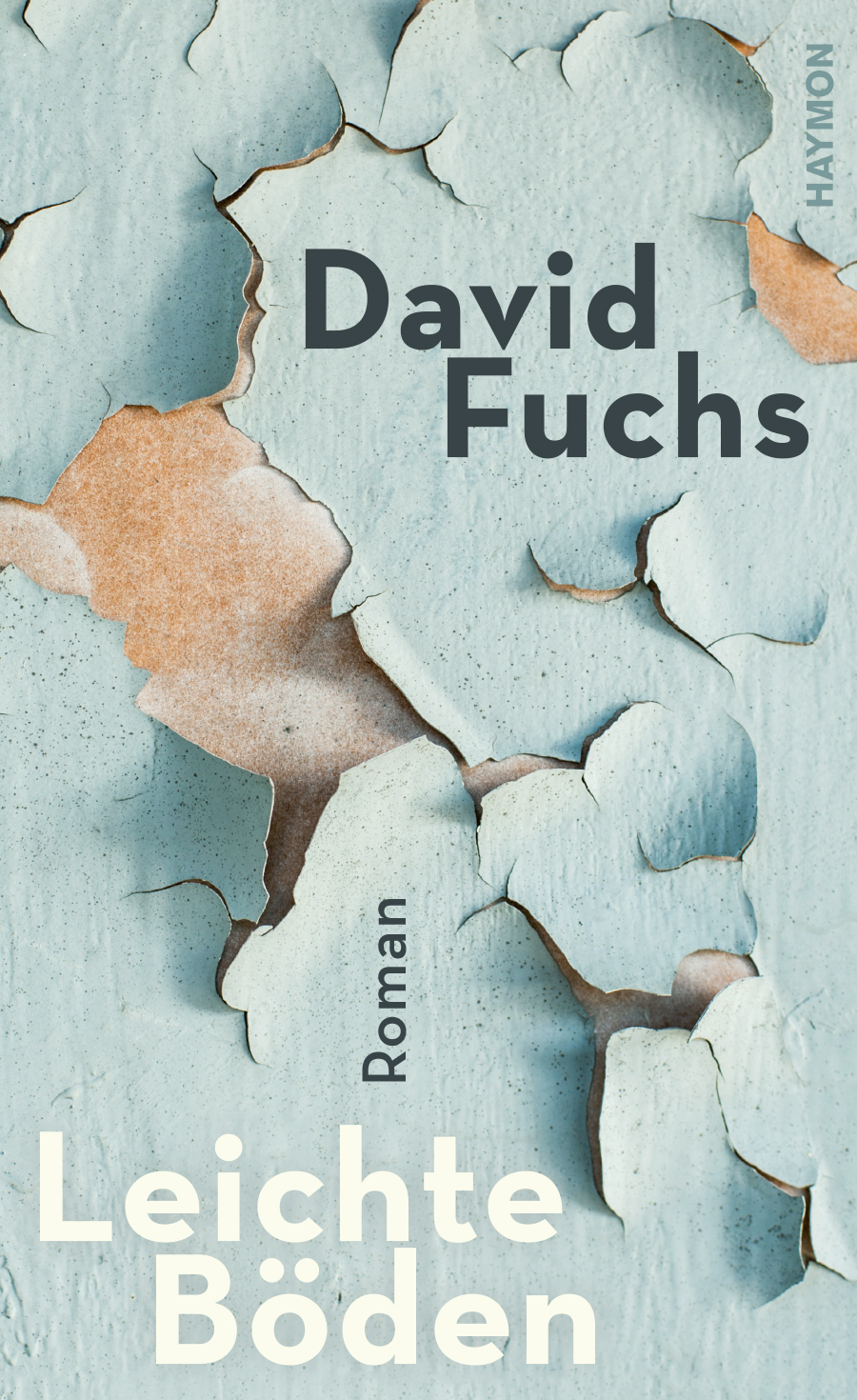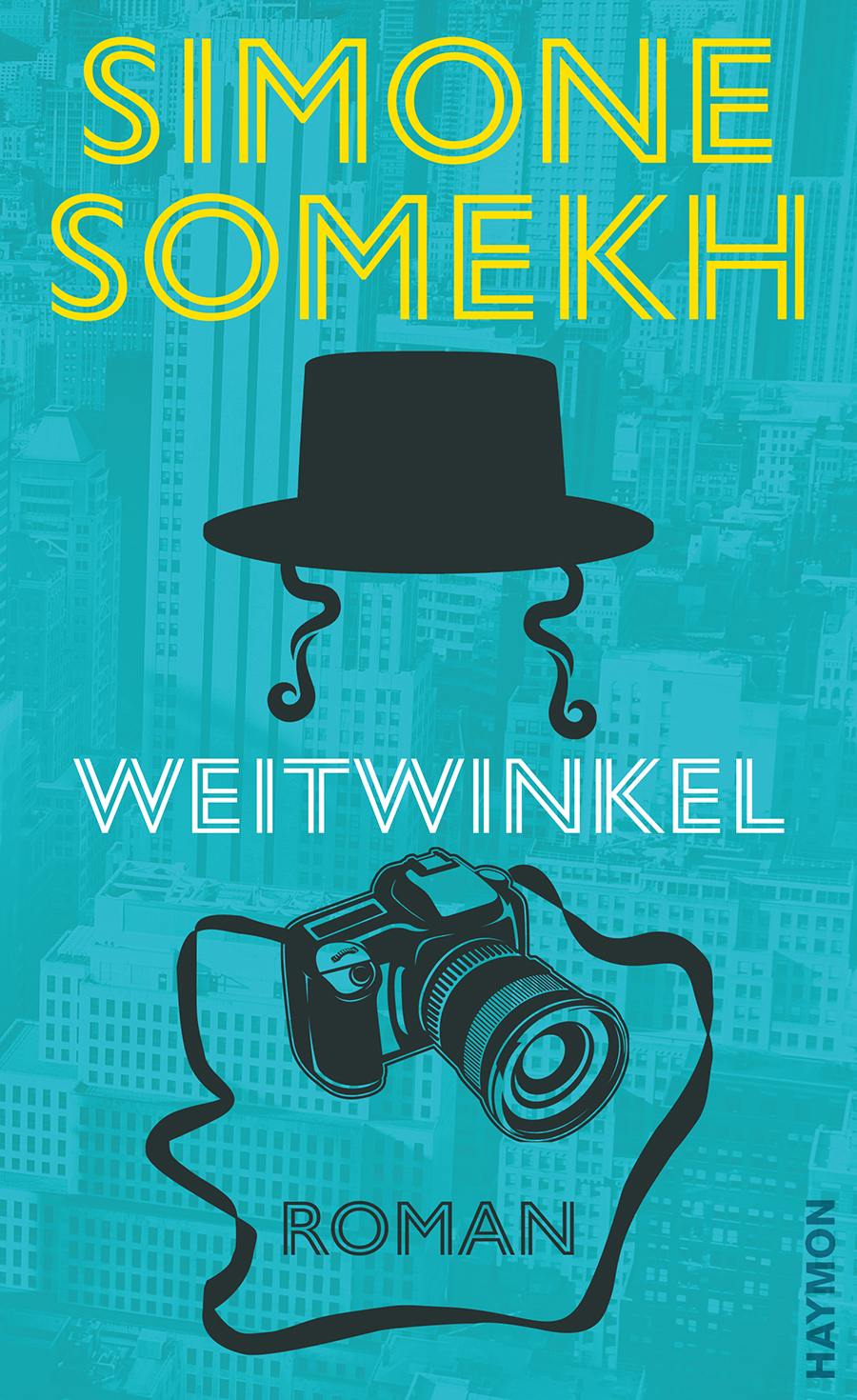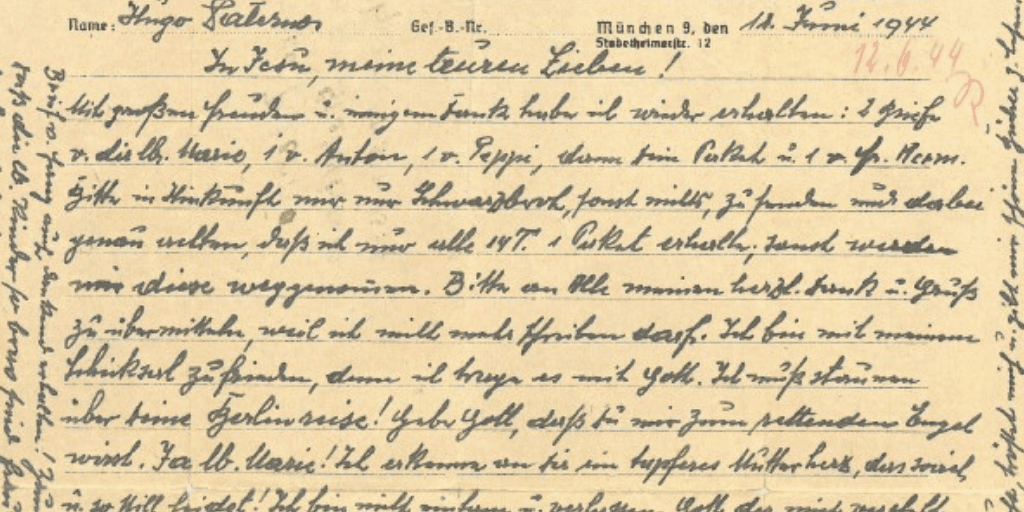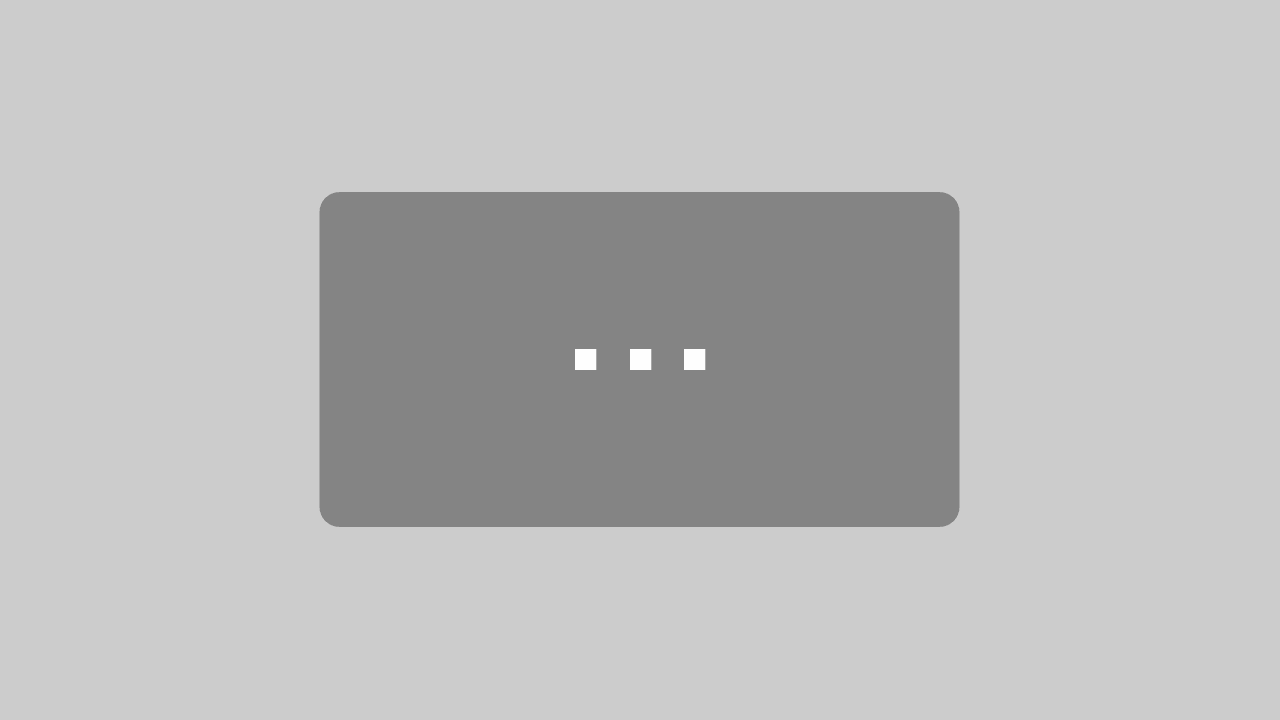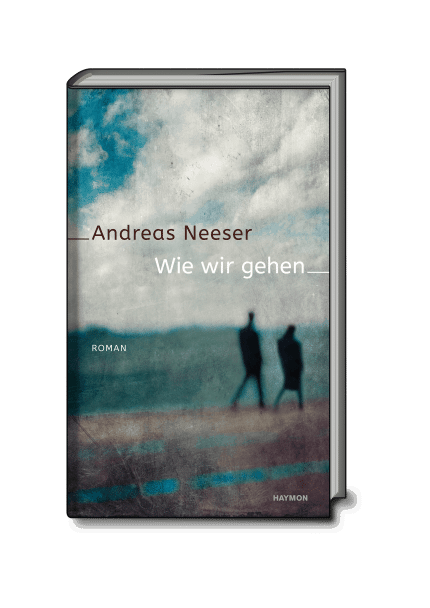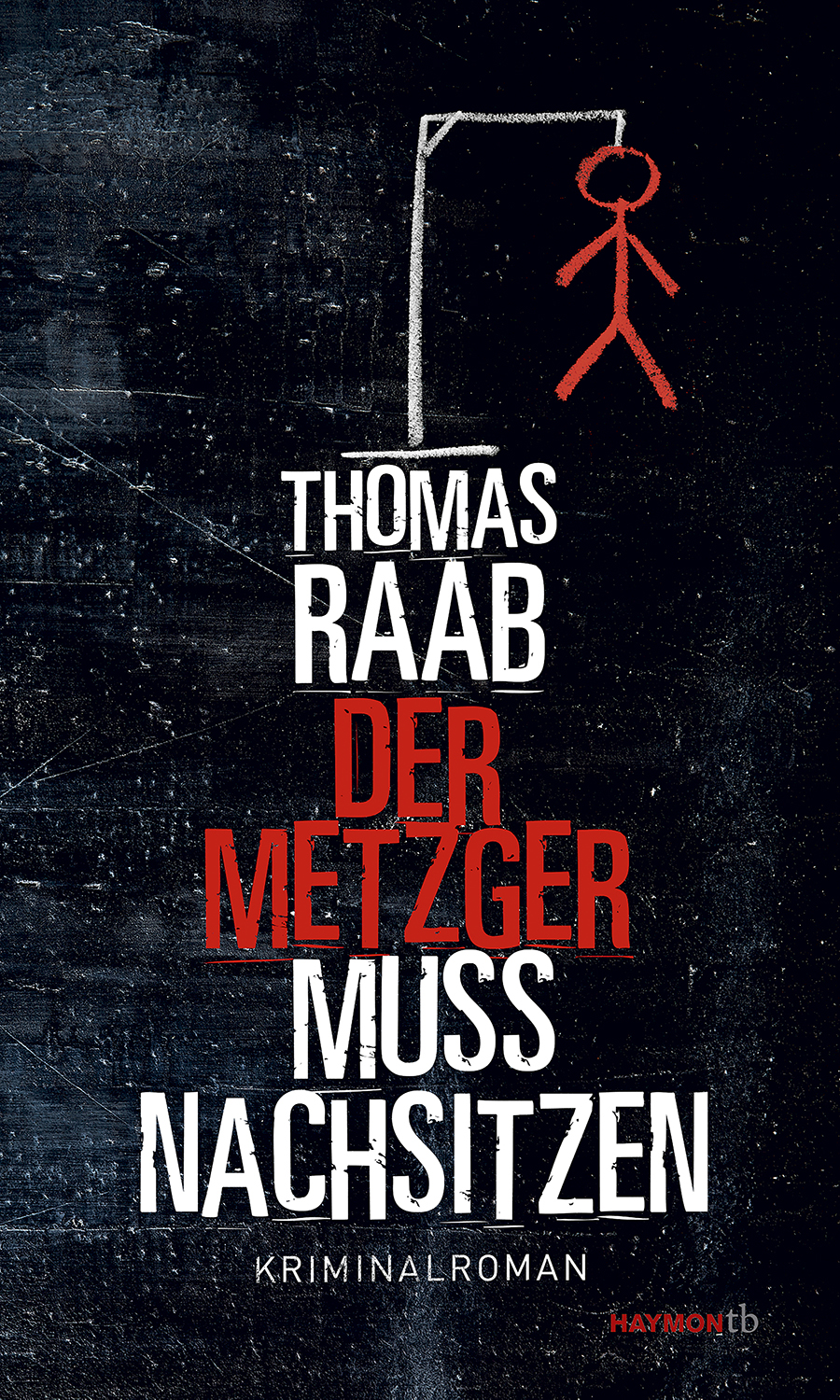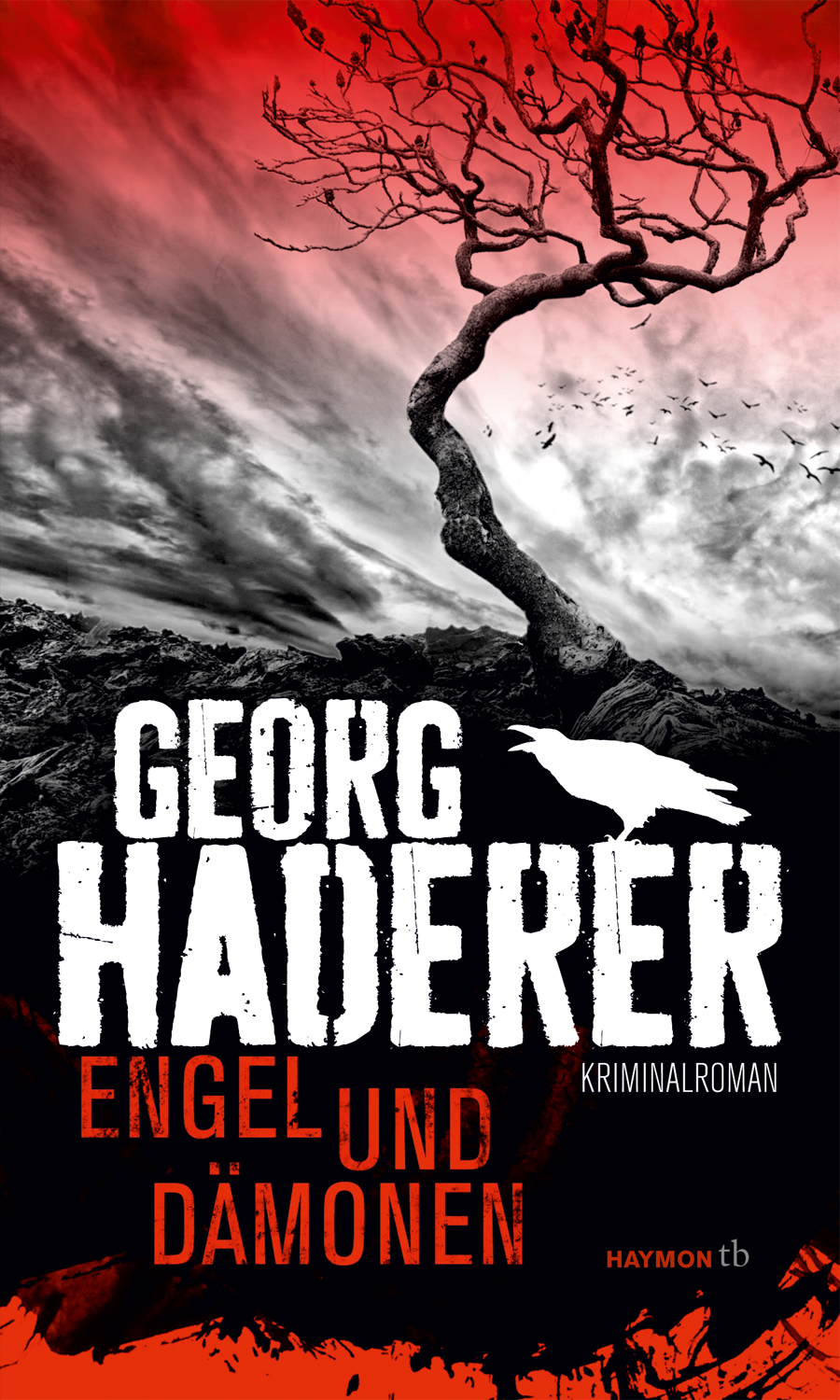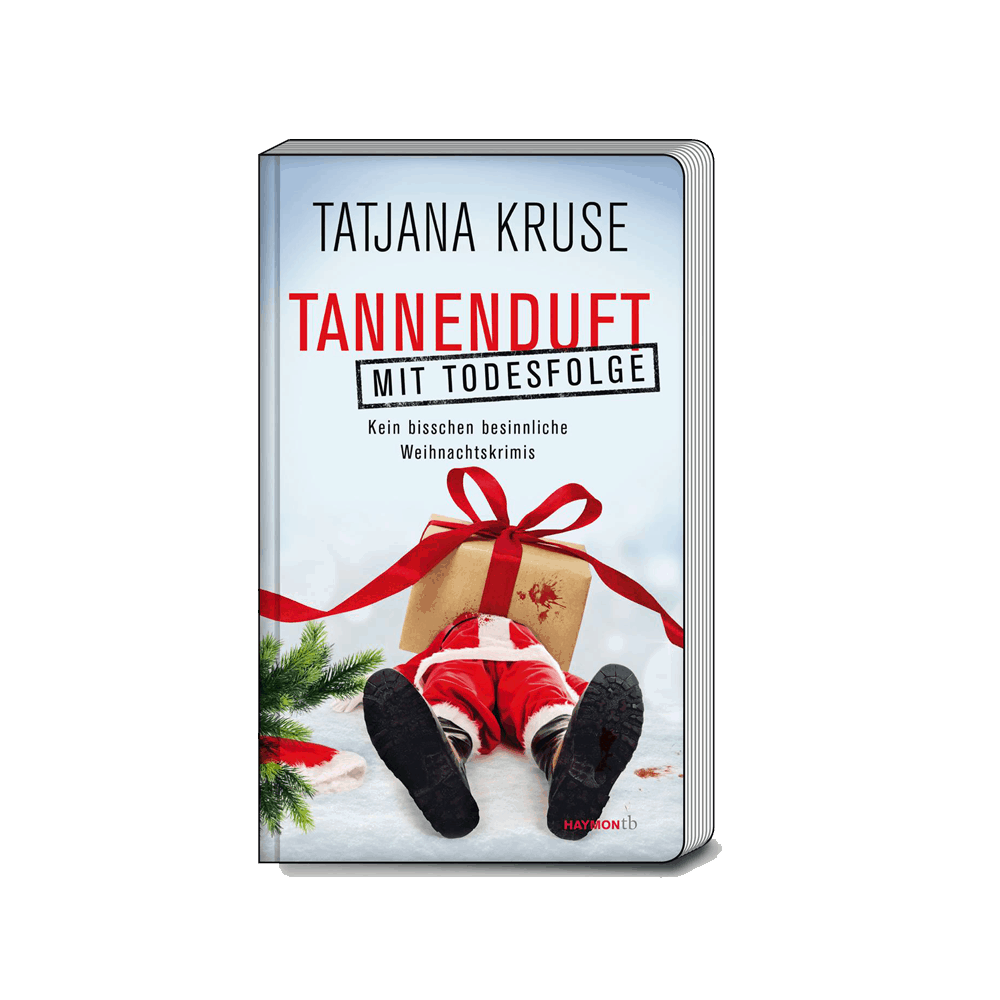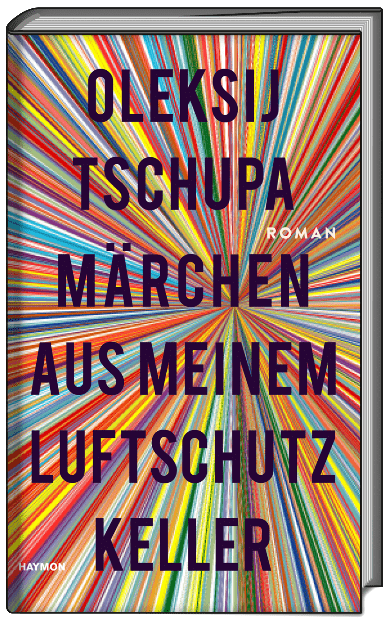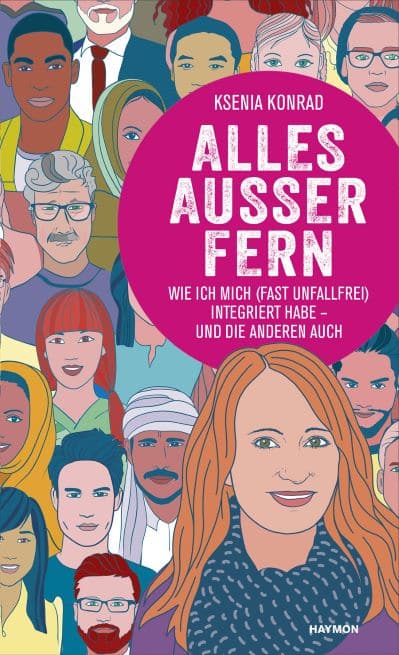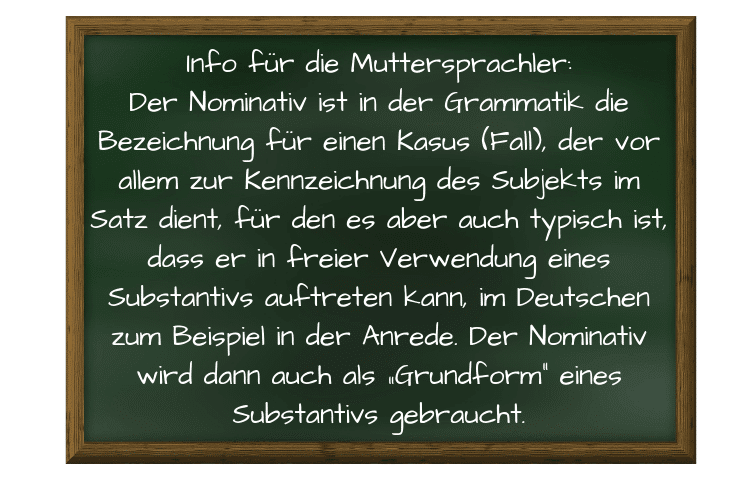Intrigen, illegale Geschäfte und tödliche Geheimnisse – „Wellengrab“ von Edith Kneifl (Leseprobe)
Gefahr im griechischen Paradies: Auf einer Schifffahrt lernt Laura Mars den gutaussehenden Griechen Alexander kennen – und ahnt nichts von seinem mörderischen Auftrag. Sie verliebt sich in ihn und begibt sich dadurch in Lebensgefahr … kann sie Alexander vertrauen, oder riskiert sie leichtfertig ihr Leben? Inmitten von idyllischen Inselträumen und bedrohlichen Immobilienhaien kommt es zum spektakulären Showdown!
Lies dich hier rein und begib dich mit der Wiener Krimi-Queen auf ein mörderisches Reisevergnügen:
Nach dreißig Jahren betrat Alexander zum ersten Mal wieder griechischen Boden. Er hatte in Argentinien, Kolumbien und Mexiko gelebt. Ein schiefgelaufenes Projekt in Juárez hatte er zum Anlass genommen, nach Europa zurückzukehren.
Die letzten Jahre hatte er in der Schweiz und in Wien verbracht. In der österreichischen Hauptstadt hatte er sich bald wie zu Hause gefühlt, Wien war ein idealer Platz zum Altwerden und galt nicht umsonst als die lebenswerteste Stadt der Welt. Doch es war auch eine Stadt der Intrigen, der illegalen Geschäfte und tödlichen Geheimnisse, wie er feststellen musste.
Alexander war in einer möblierten Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Gründerzeitbau in der Nähe vom Naschmarkt abgestiegen. Er ging viel spazieren, hielt seinen Körper halbwegs in Form, und er lernte Deutsch, die Sprache der Dichter und Denker. Fast war ihm ein bisschen langweilig in Wien gewesen.

Edith Kneif, in Wels geboren, hat bereits 22 Kriminalromane und ca. 50 Kurzgeschichten. Mit „Todesreigen in der Hofreitschule“ (2019) setzt Kneifl ihre beliebte Serie historischer Krimis im Wien des Fin de siècle rund um den charmanten Privatdetektiv Gustav von Karoly fort. „Wellengrab“ (2020) ist der Beginn ihre neuen Urlaubskrimi-Trilogie. Die nächsten Bände werden auf den Kanarischen Inseln und in Kroatien spielen. Foto: Kurt-Michael Westermann
Eine Zeitlang hatte er eine russische Freundin gehabt. Sie war zwanzig Jahre jünger als er und viel zu dünn für seinen Geschmack. Aber Natascha war toll im Bett. Toll im wahrsten Sinne des Wortes. Wegen ihrer zahlreichen erotischen Finessen hatte er sie kurz in Verdacht gehabt, eine Professionelle zu sein. Zwar verlangte sie nie Geld von ihm, aber ihre Vorlieben kamen ihn teuer zu stehen: Ihre Lieblingsbeschäftigung war Shoppen, auch vom Kochen hielt sie nicht viel, die Restaurantbesuche kosteten ihn ein kleines Vermögen. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, war sie ihm auch körperlich zu anstrengend. Natascha war in jeder Hinsicht unersättlich. Trotzdem hatte er Hemmungen, mit ihr Schluss zu machen.
Durch Natascha kam er in einer Bar der Wiener Innenstadt mit einem schwerreichen Russen ins Gespräch. Bald erledigte er einfache Jobs für Boris – gelegentliche Kurierdienste, die ihn meist nach Luxemburg oder Liechtenstein führten. Heute war er sich sicher, dass die Begegnung mit dem Russen kein Zufall gewesen war. Alexander hatte Natascha nicht viel über sich erzählt, aber offenbar hatte sie geahnt, dass er für illegale Geschäfte zu haben war.
Als er eines Tages für Boris in Luxemburg eine Geldtransaktion erledigte, wurde er bei seiner Rückkehr am Wiener Flughafen von internationalen Fahndern festgehalten und einvernommen. Boris hatte Wien verlassen, ohne Alexander eine Nachricht zu hinterlassen und ihn zu warnen. Die Interpol hatte den Russen wegen Steuerhinterziehung und Betrug auf ihre Fahndungsliste gesetzt.
Etwa zur selben Zeit verließ Natascha Alexander. Er empfand vor allem Erleichterung. Er hatte sie nicht geliebt, war nicht einmal verliebt in sie gewesen. Sie hatte ihm nur die einsamen Nächte erträglicher gemacht.
Alexander konnte es sich nicht erlauben, von der Interpol genauer unter die Lupe genommen zu werden. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen Namen zu ändern und unterzutauchen.
Im Internet fand er eine hübsche Atelierwohnung in der Leopoldstadt mit Blick auf das Riesenrad. Die Wohnung gehörte einer Malerin. Sie wollte für ein halbes Jahr nach Frankreich und suchte jemanden, der einstweilen auf ihre Wohnung schaute. Er musste sich also nicht einmal anmelden.
Einen wunderbaren Frühling lang genoss er das luftige Atelier in der Nähe des Praters. Gerne hätte er noch eine Zeitlang weiter in den Tag hineinleben wollen. Doch eines Abends bekam er Besuch. Seine russischen Freunde hatten nicht auf ihn vergessen. Es überraschte ihn keineswegs, dass sie seine Adresse in Wien herausgefunden hatten. Beim Joggen im Prater war er einmal zufällig Natascha begegnet. Sie war in Begleitung eines anderen Mannes gewesen. Wahrscheinlich waren sie im gefolgt.
„Ihr Name ist Alexander Makiris? Sie sind der Grieche?“, vergewisserte sich der Mann in dem eleganten, gutsitzenden Anzug, der so gar nicht zu seiner Verbrechervisage passte.
Alexander zögerte, bevor er nickte. Er wusste, wann Lügen sinnlos war.
„Wir haben einen Auftrag auf Mykonos für Sie.“
Er machte sich nicht die Mühe nachzufragen, wen dieser Mann mit „wir“ meinte, wartete den Vorschlag des Mannes ab, ohne die Miene zu verziehen. Ein Job in seiner alten Heimat. Nicht weit entfernt von der Insel, auf der er geboren worden war. Er hielt das für ein besonderes Zeichen. Außerdem war es höchste Zeit abzuhauen. Wenn ihn die Russen so leicht finden konnten, würde die Interpol wohl auch bald bei ihm auftauchen. Es würde der letzte Auftrag sein, den er annahm. Danach wollte er sich endgültig zur Ruhe setzen.
Die Aufgabe schien nicht besonders schwierig zu sein. Er sollte einen österreichischen Hotelbesitzer auf Mykonos zum Verkauf überreden. Das Honorar klang verlockend und gleichzeitig verdächtig. Für einen so simplen Job zahlte normalerweise keiner fünfzigtausend Dollar. Wenn er seine Wertpapiere und Goldbarren, die er in einer Schweizer Bank deponiert hatte, verkaufte, würde er damit genügend Geld haben, um sich ein Haus auf einer einsamen Insel und ein gebrauchtes Fischerboot zuzulegen. Als Sohn eines Fischers bildete er sich ein, vom Fischfang etwas zu verstehen. Sollte es finanziell knapp werden, könnte er ja wieder seiner ursprünglichen Arbeit nachgehen. Denn zwischen der Türkei und den griechischen Inseln herrschte nach wie vor ein reger Austausch von Waren aller Art, Zigaretten und Cannabis aus dem Mittleren Osten waren auch im heutigen vereinten Europa noch gefragt.
Er stimmte zu.
Bevor der Besucher ging, übergab er ihm ein dickes Kuvert.
Alexander setzte sich auf die Couch und nahm die Fotos aus dem Umschlag. Sorgfältig prägte er sich die verschiedenen Gesichter ein und las die beigefügten Anweisungen. Tatsächlich klang alles nach einem gut organisierten, unkomplizierten Auftrag. Fotos und Zettel verbrannte er, die Asche spülte er im Klo hinunter. Die Russen waren zum Glück genauso altmodisch wie er, kommunizierten ungern per Mobiltelefon oder E-Mail. Anscheinend misstrauten sie ebenfalls den neuen Technologien. Alles war gläsern und kontrollierbar geworden. In seinem Beruf war das schlicht und einfach fatal.
Ohne einen Funken von Wehmut zu verspüren, verließ Alexander am nächsten Tag die Stadt, in der er sich sehr wohlgefühlt hatte, und flog nach Athen.

1. Teil: Piräus
Als ich ihn erblickte, wusste ich sofort, dass es Ärger geben wird. Schnellen Schrittes kam er die Treppe zum Oberdeck herauf. Ich erkannte ihn an seiner Statur und seinem Gang. Im Gegensatz zu mir hatte er sich kaum verändert, die vielen Jahre hatten wenige Spuren bei ihm hinterlassen. Wie die meisten großen Männer ging er leicht gebückt, so als würde er sich seiner Größe schämen.
Das Unglück wird seinen Lauf nehmen, dachte ich, als ich sein Gesicht aus der Nähe sah. Alles Sanfte und Weiche war aus seinen Zügen gewichen. Aber er war immer noch ein schöner Mann. Und er war auffallend gut gekleidet. Hellbeiger Leinenanzug, weißes Hemd, champagnerfarbene Sneakers. Bestimmt liefen ihm die Frauen genauso nach wie in seiner Jugend. Ob ihm das heute bewusst war? Damals hatte er nur Augen für eine gehabt. Er war kein Frauenheld, sondern ein schüchterner, introvertierter Bursche gewesen.
Ich überlegte, ob ich ihn ansprechen sollte, ließ es aber bleiben. Er würde mich nicht erkennen. Vielleicht würde er sich an meinen Vornamen erinnern? So wie alle im Dorf hatte er mich früher immer einfach Frau Christina genannt.
Als er knapp an mir vorbeiging, sah ich ihm in die Augen. Große, dunkle, traurige Augen mit langen schwarzen Wimpern, um die ihn wahrscheinlich jede Frau beneidete.
Ich erschrak. Seine Augen erinnerten mich an jene von Christos, den einzigen Mann, den ich je geliebt hatte. Aber Christos war tot. Die Faschisten hatten ihn 1969 während der Unruhen in Athen umgebracht.

Edith Kneifl zeigt ein Griechenland hinter der sonnigen Fassade!
Vor der fantastischen Kulisse der griechischen Inseln Mykonos, Ikaria und Samos bahnt sich ein verhängnisvolles Abenteuer an. Griechenland ist einerseits Urlaubsparadies und Sehnsuchtsort, andererseits geprägt von der massiven Schuldenkrise, von Verarmung und Hoffnungslosigkeit. Edith Kneifl öffnet mit „Wellengrab“ die Augen für Griechenland in allen seinen Facetten: den paradiesischen ebenso wie den abgründigen.