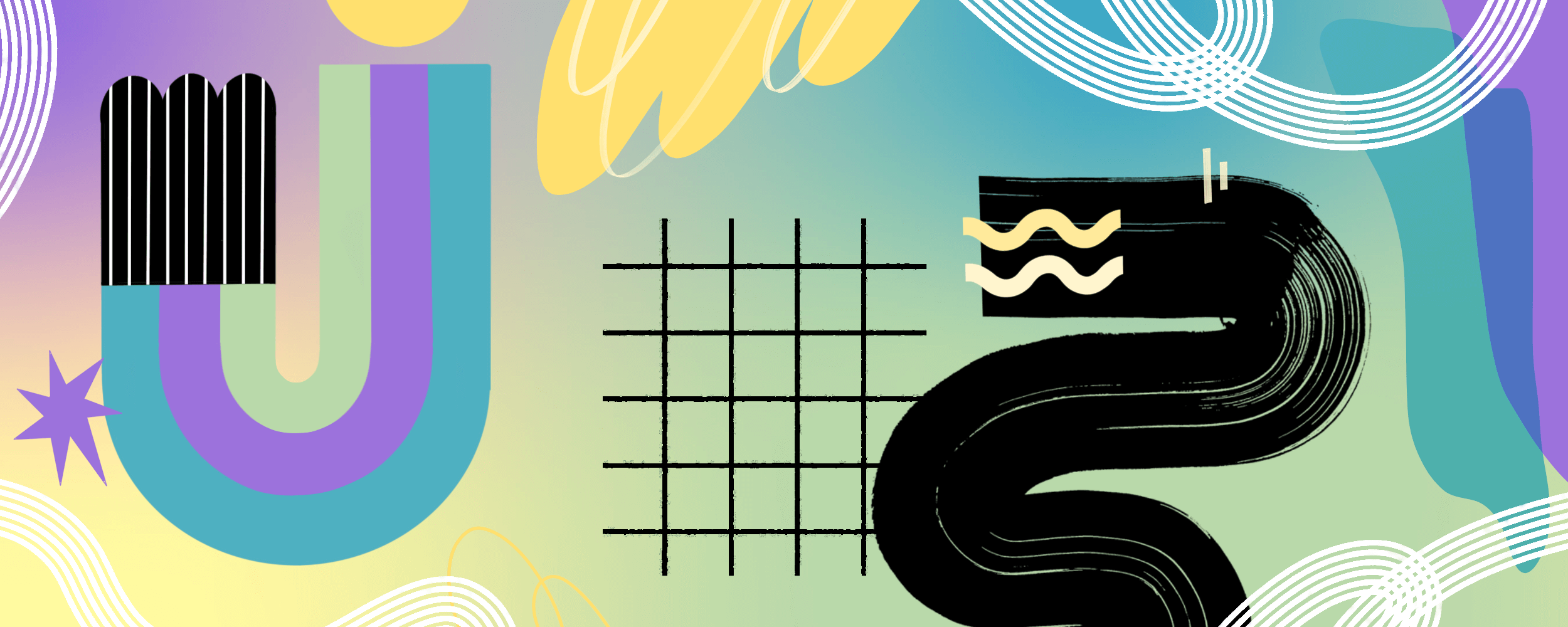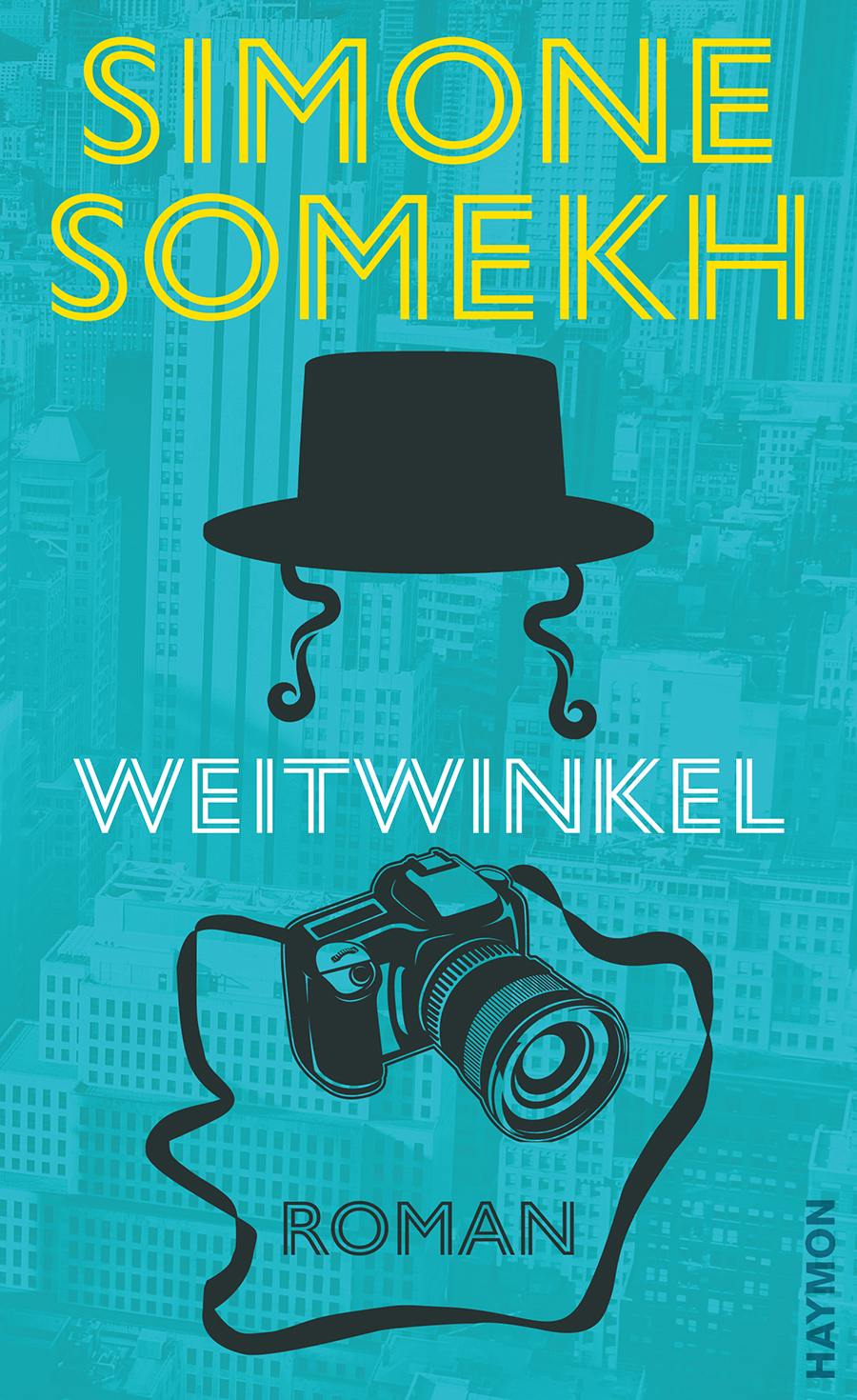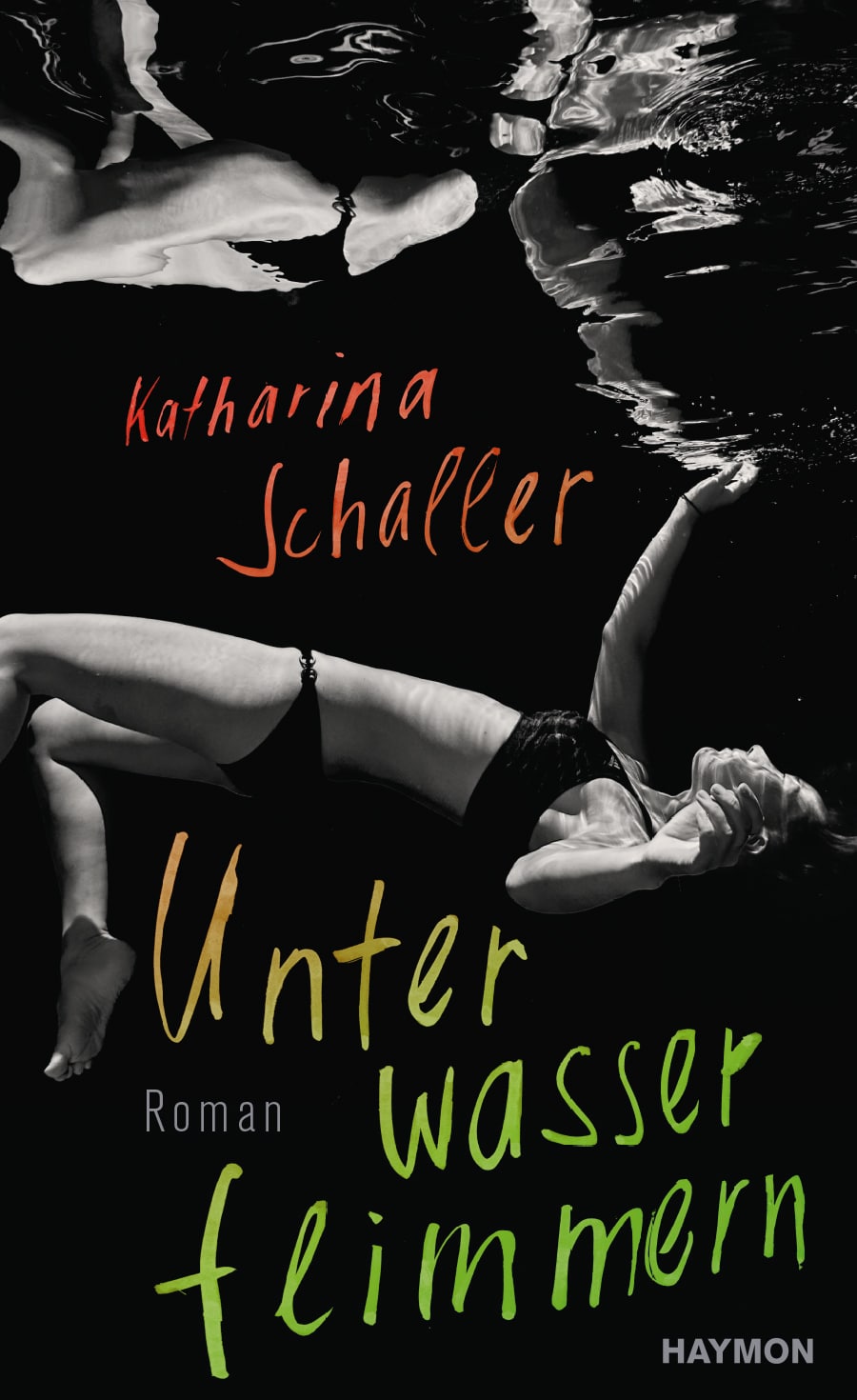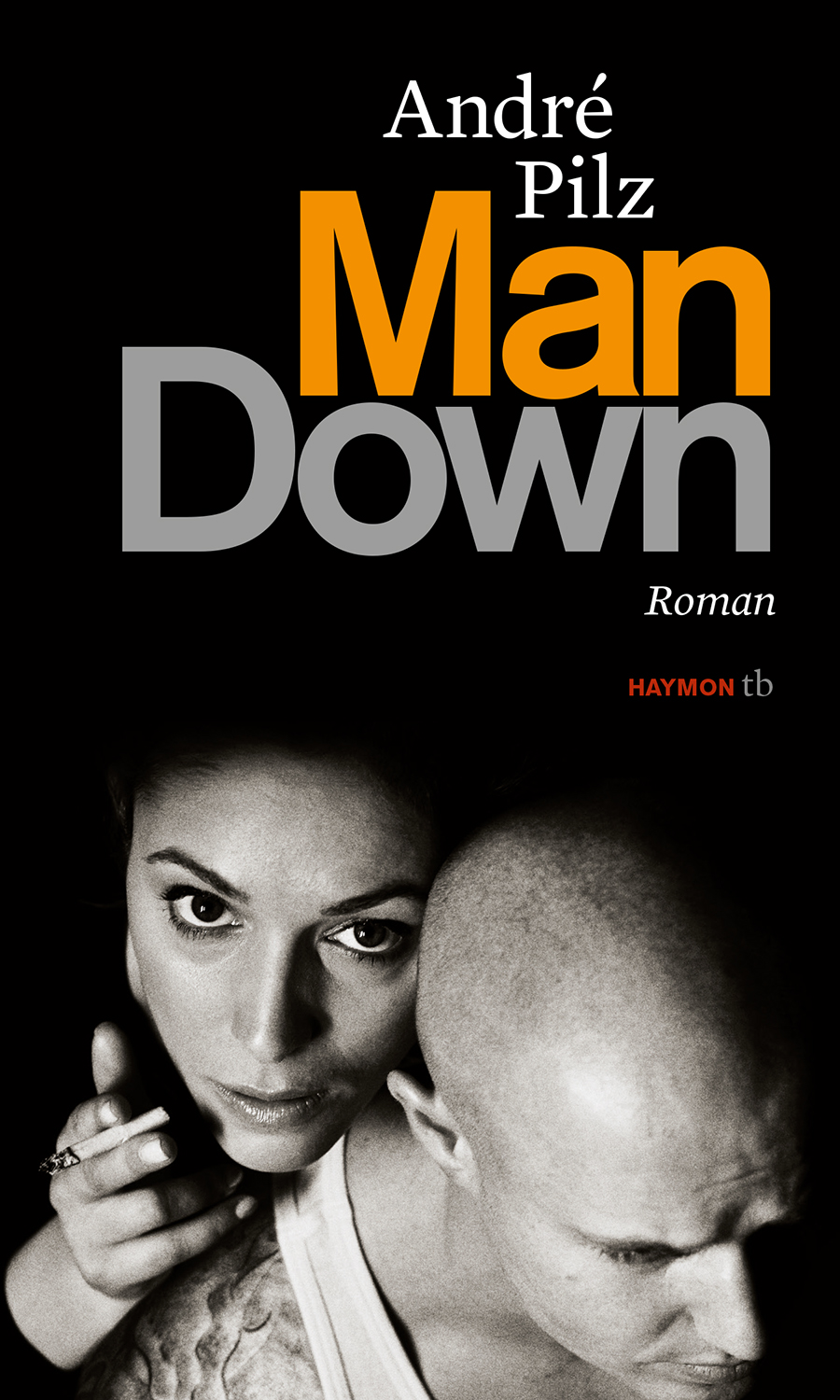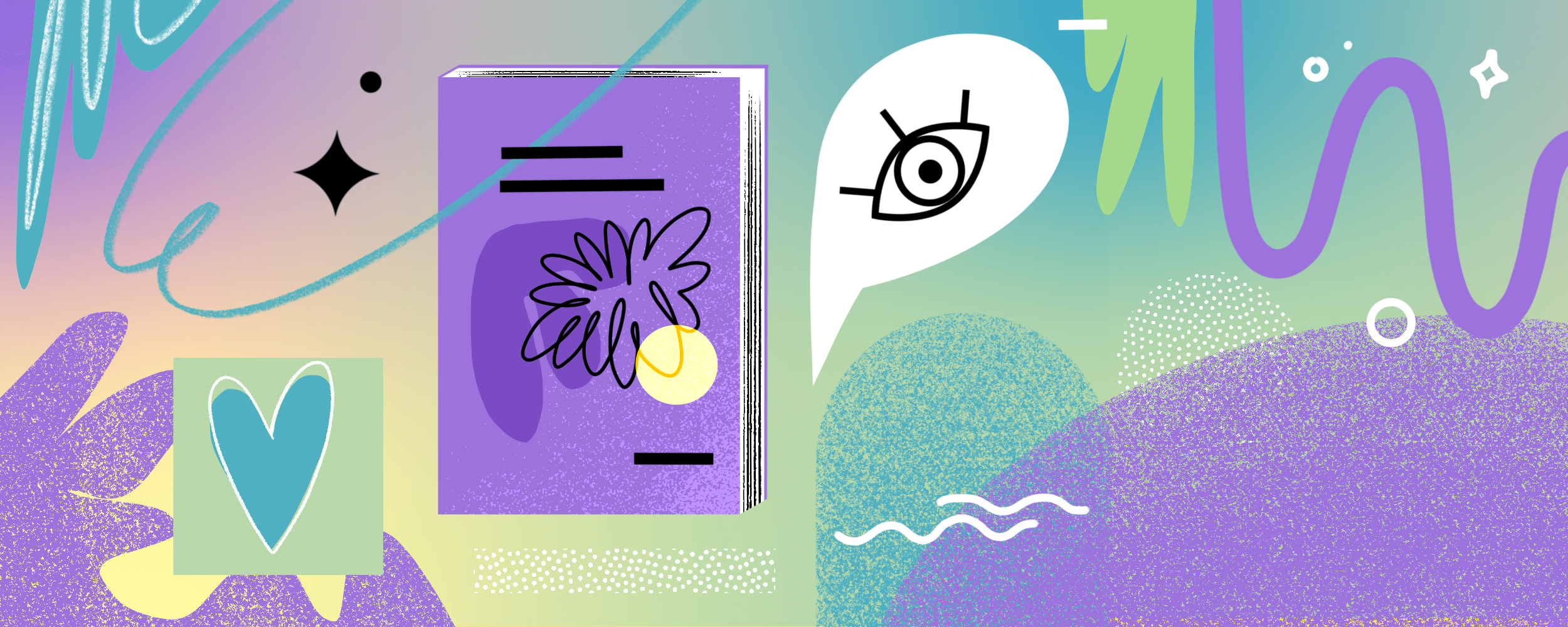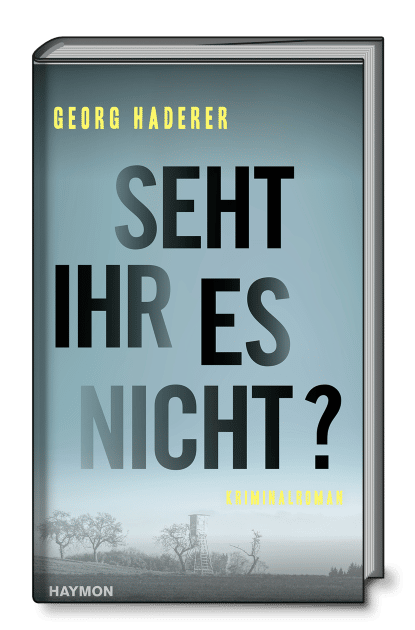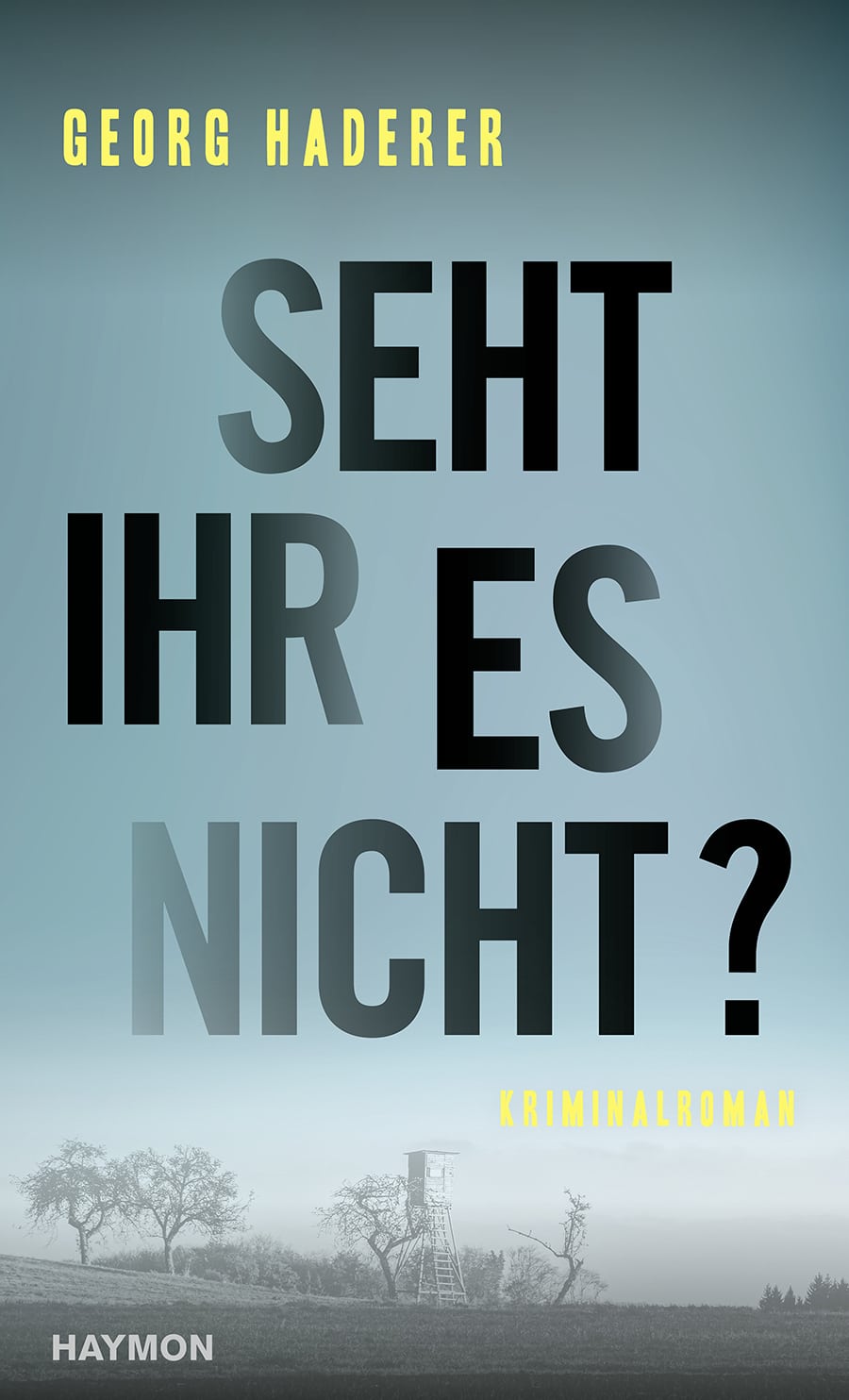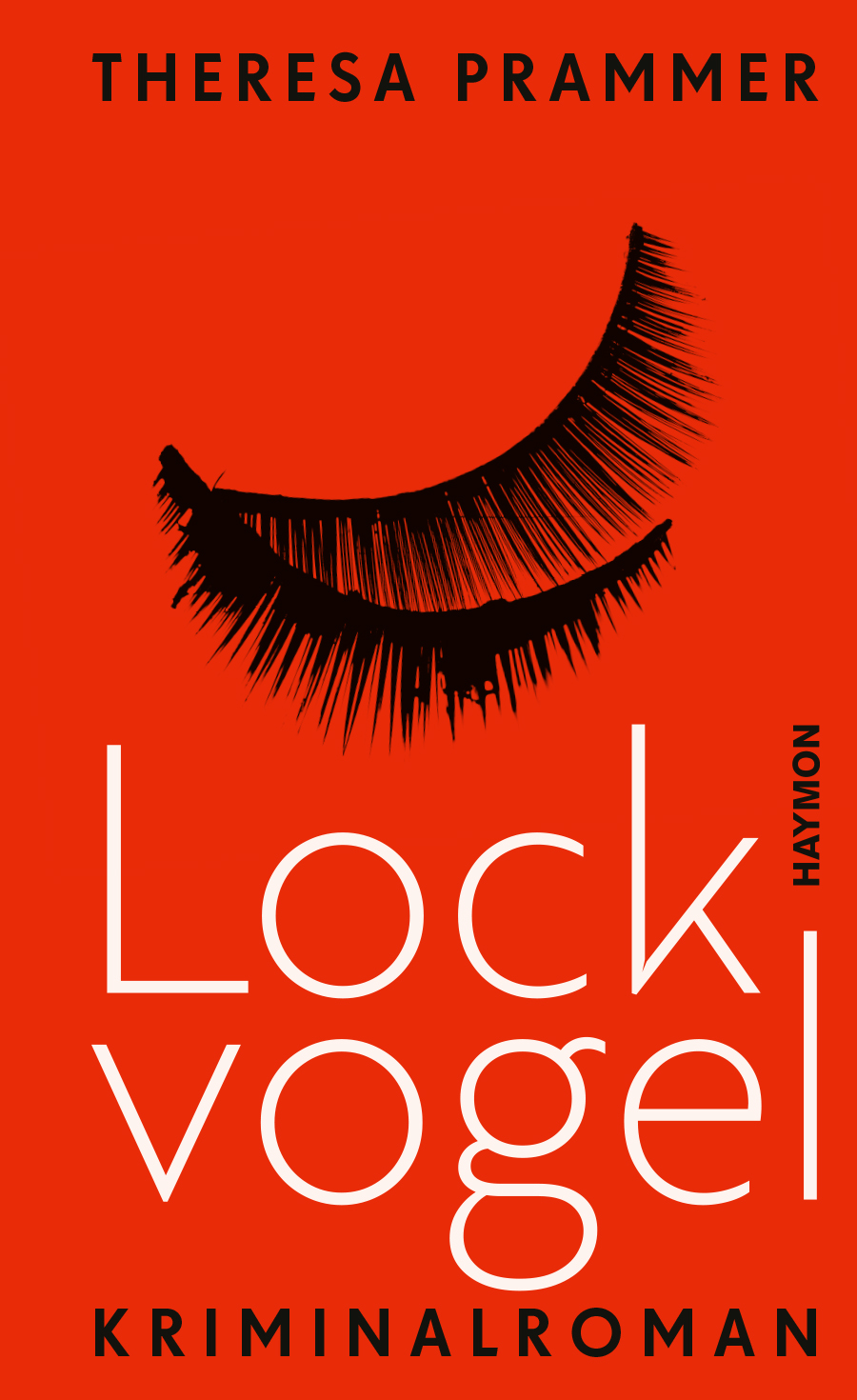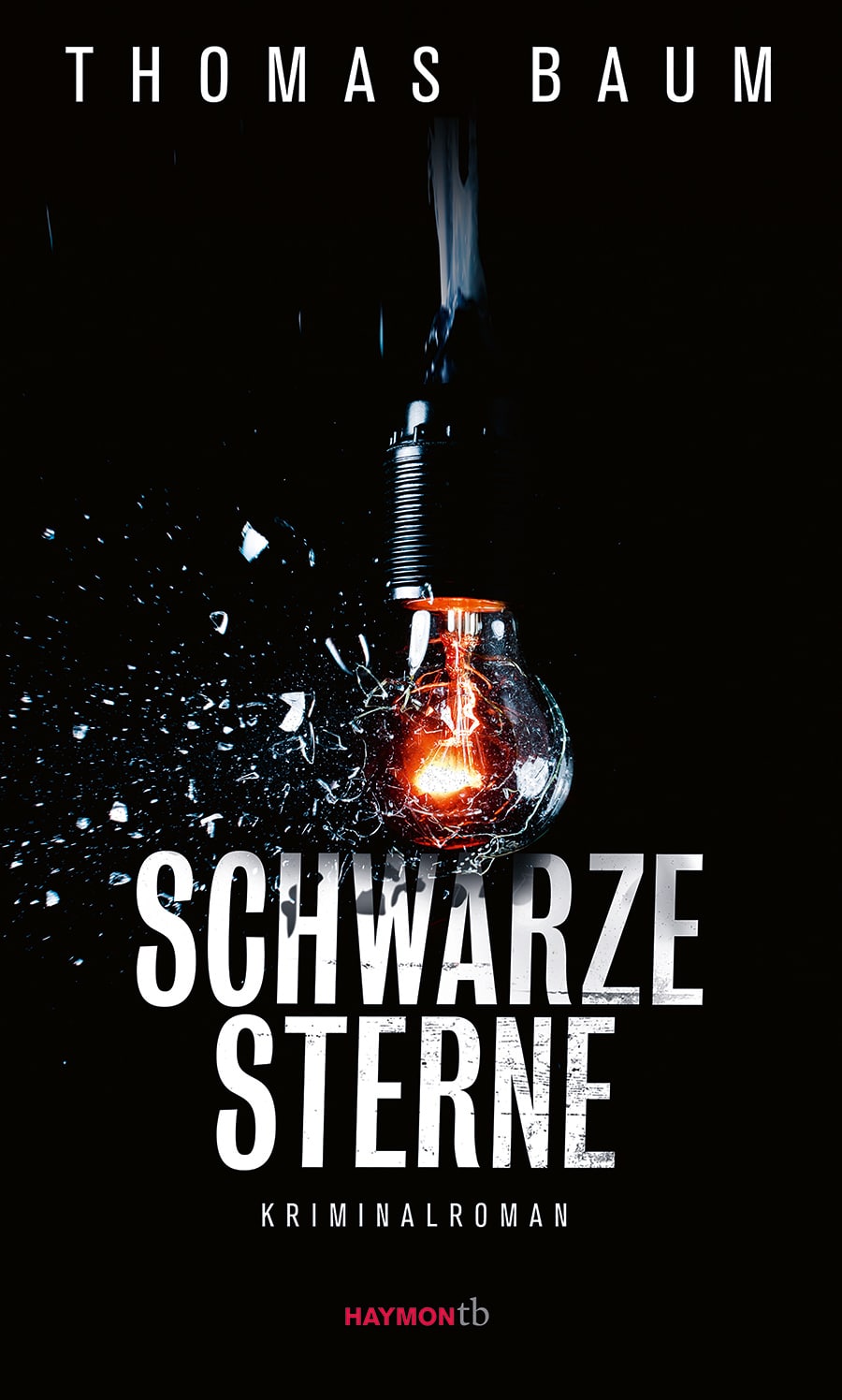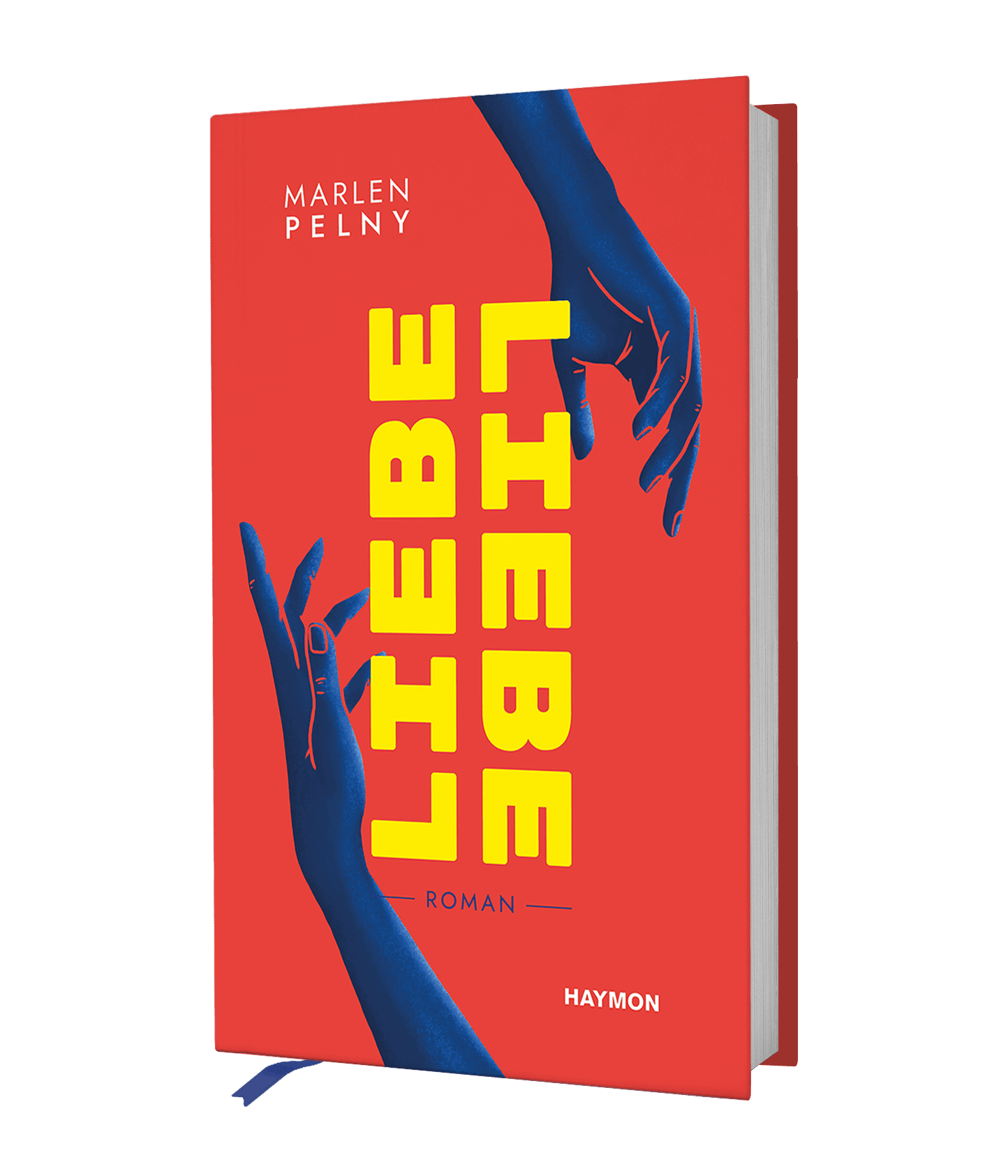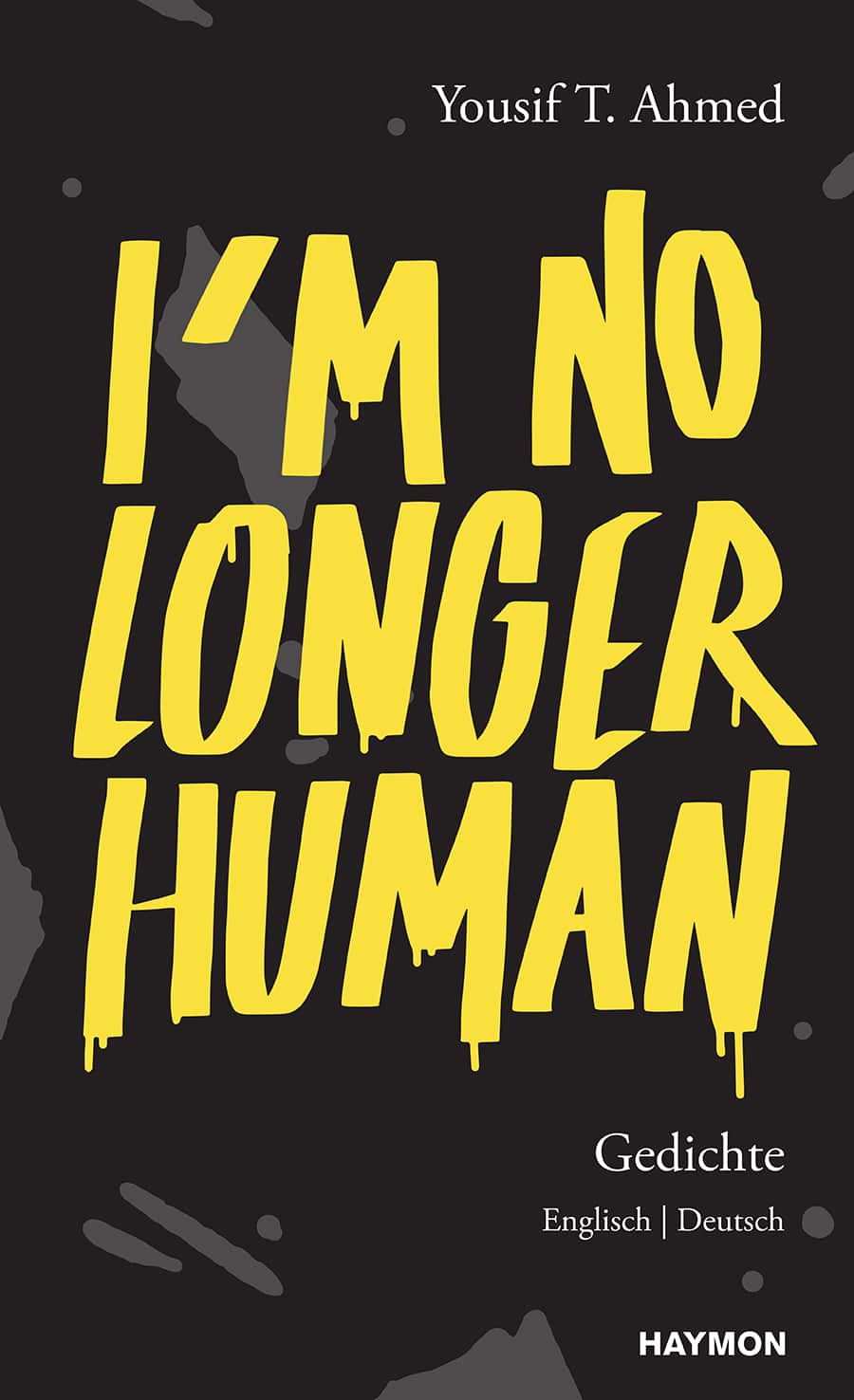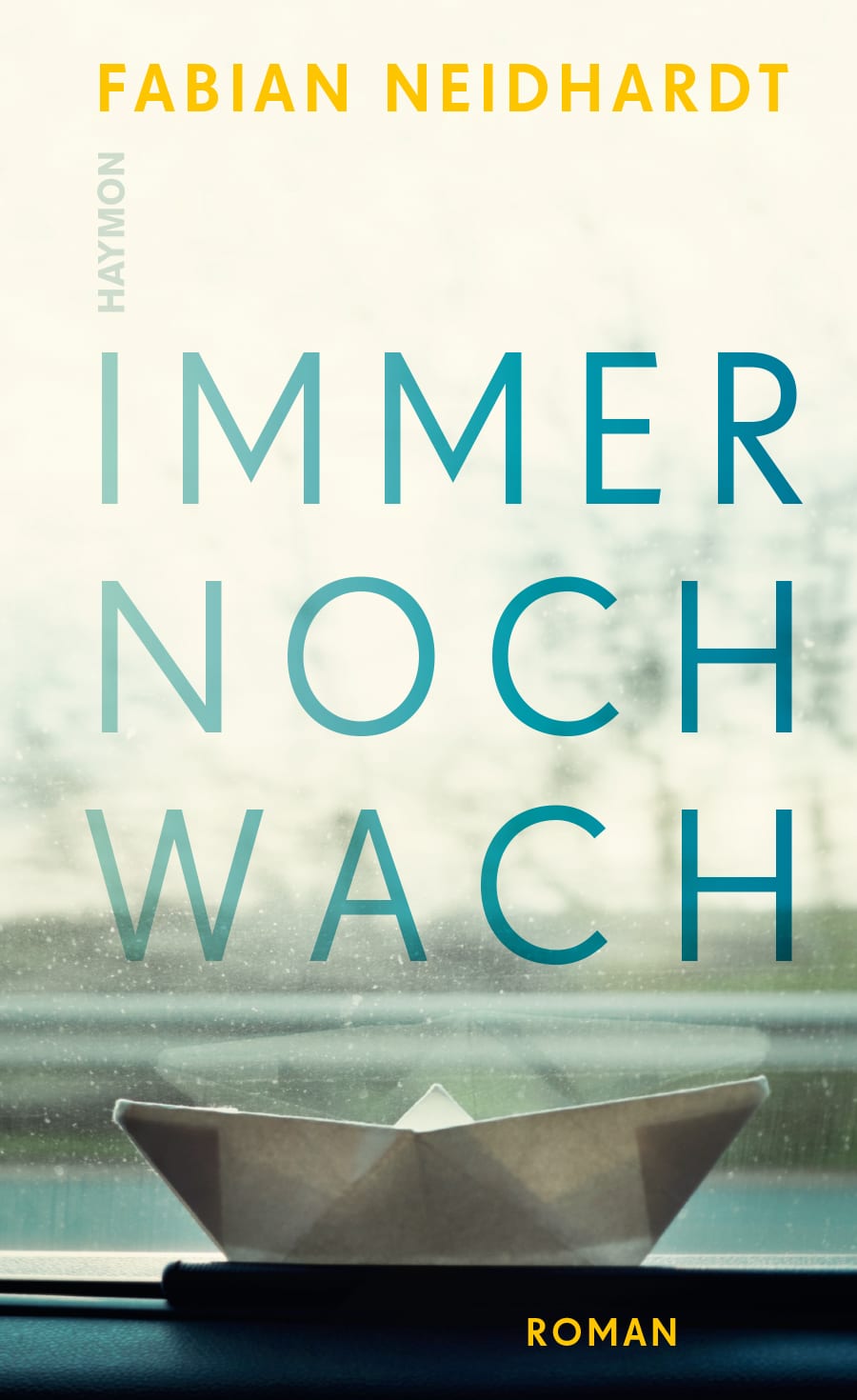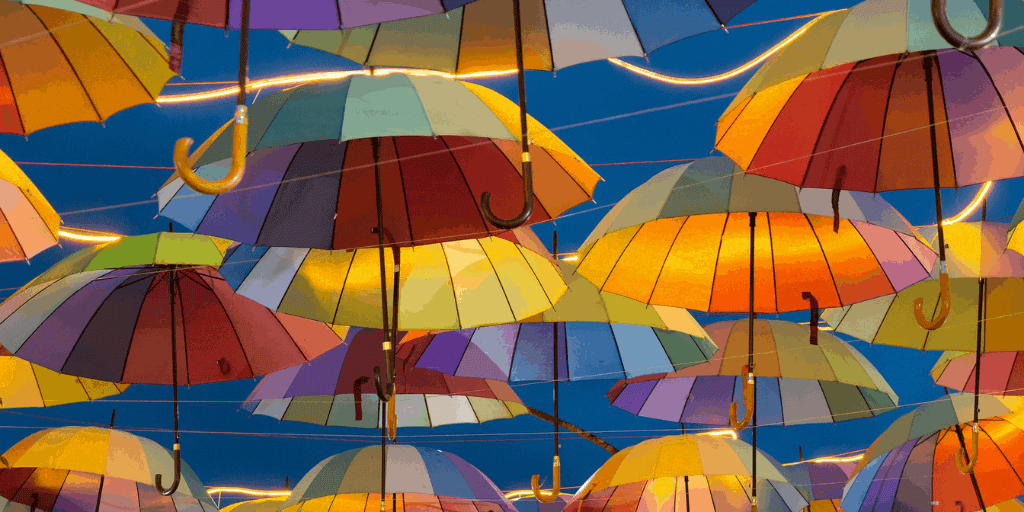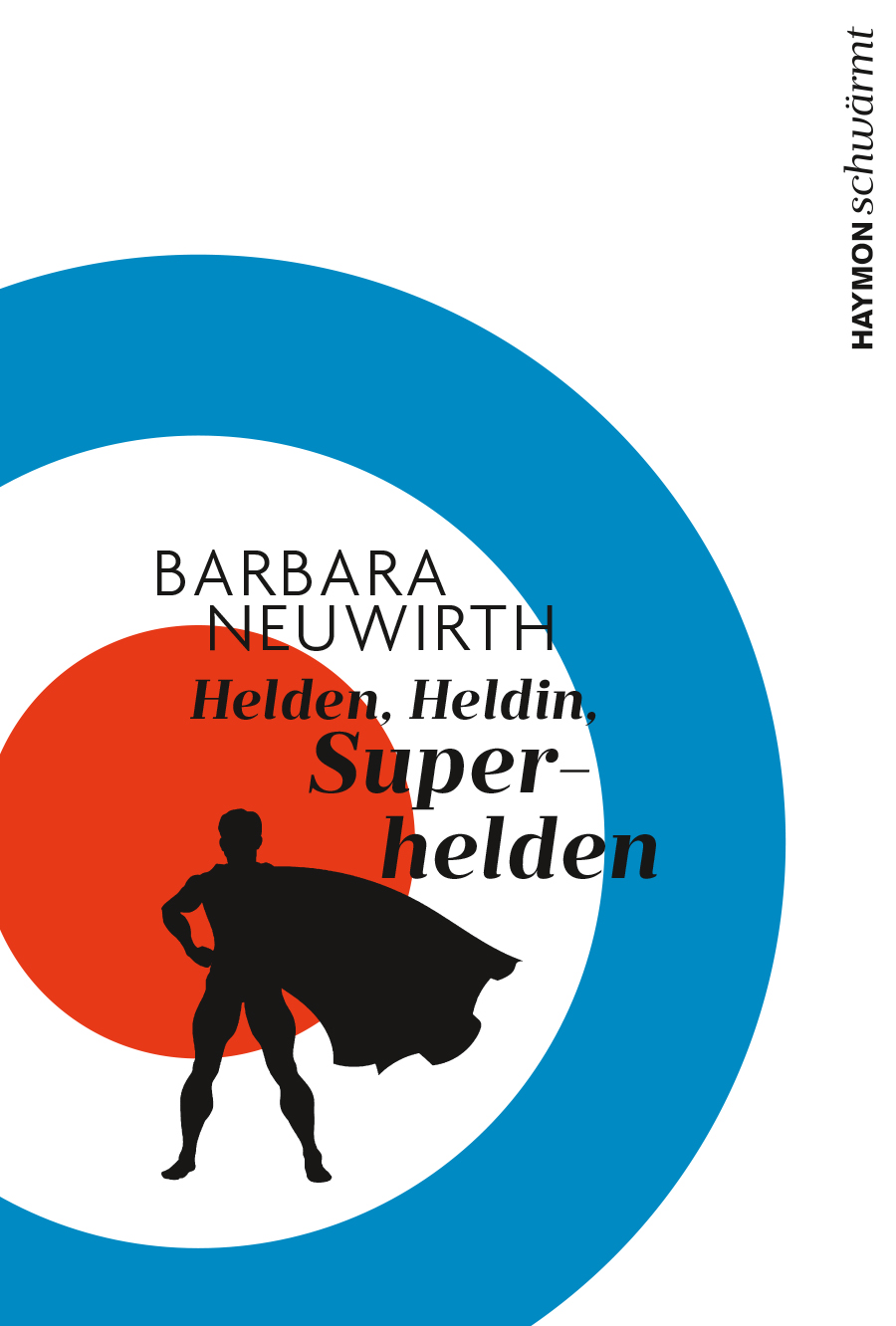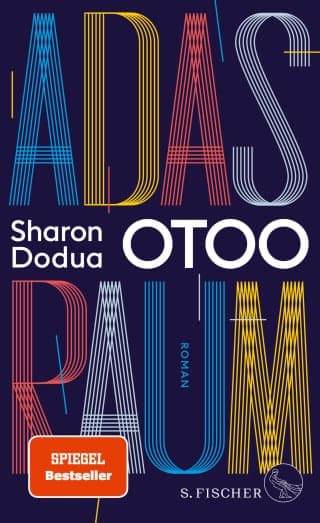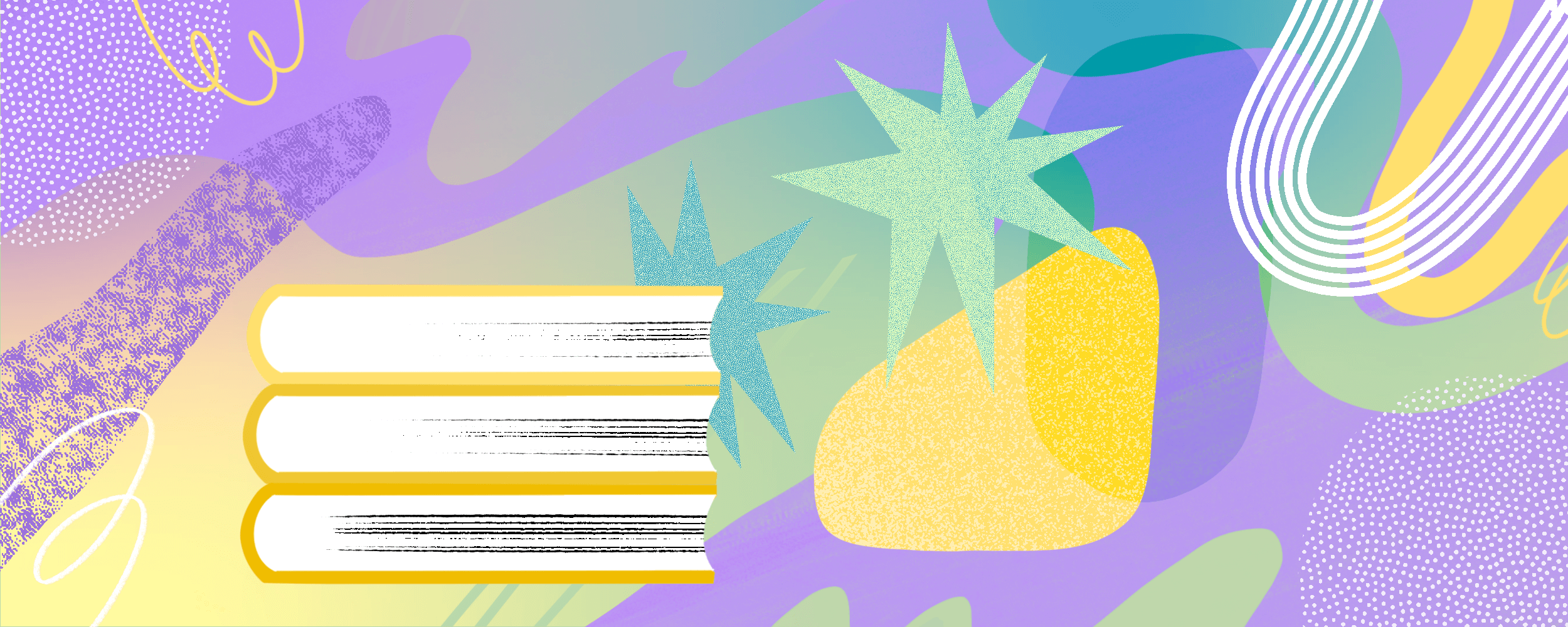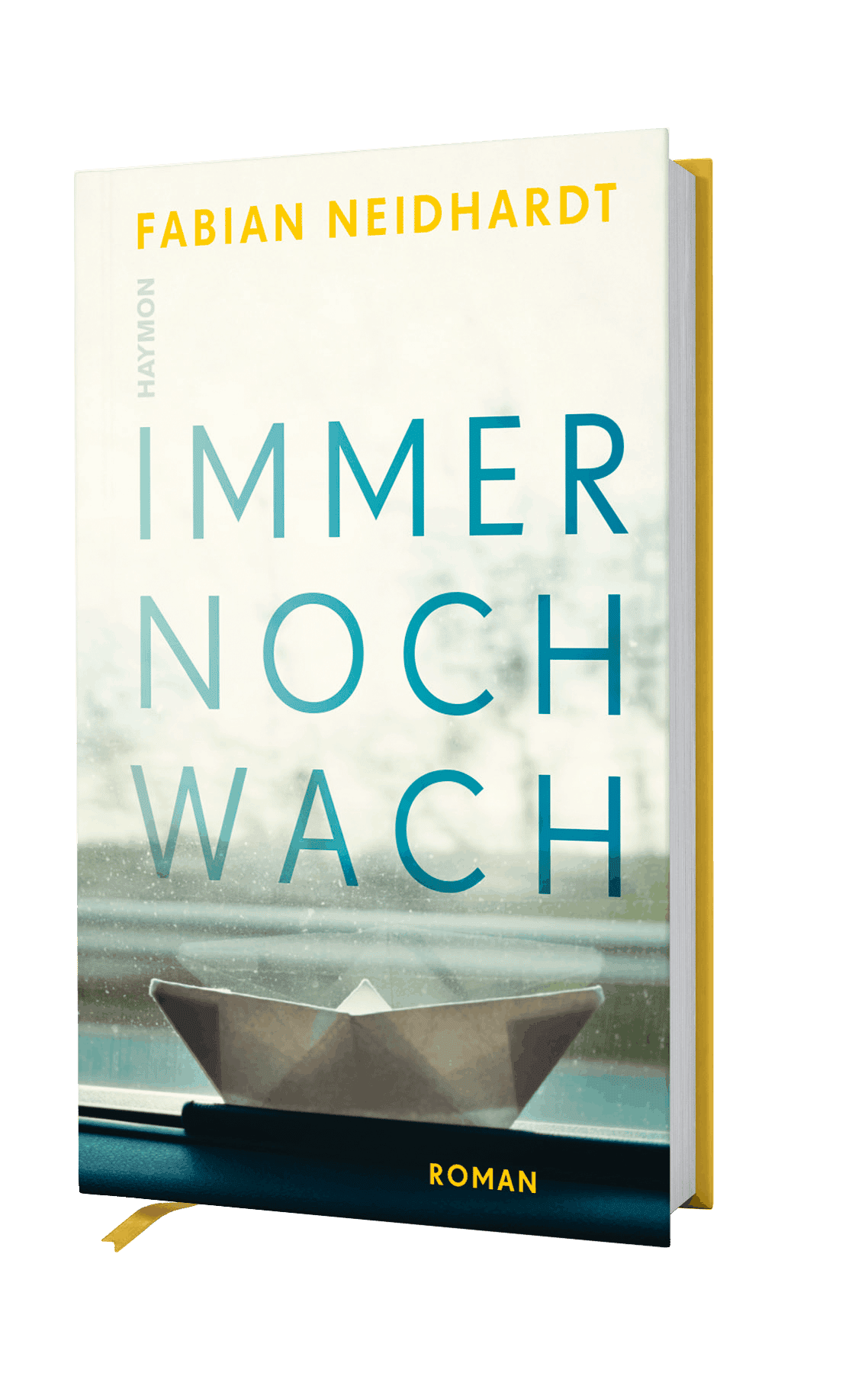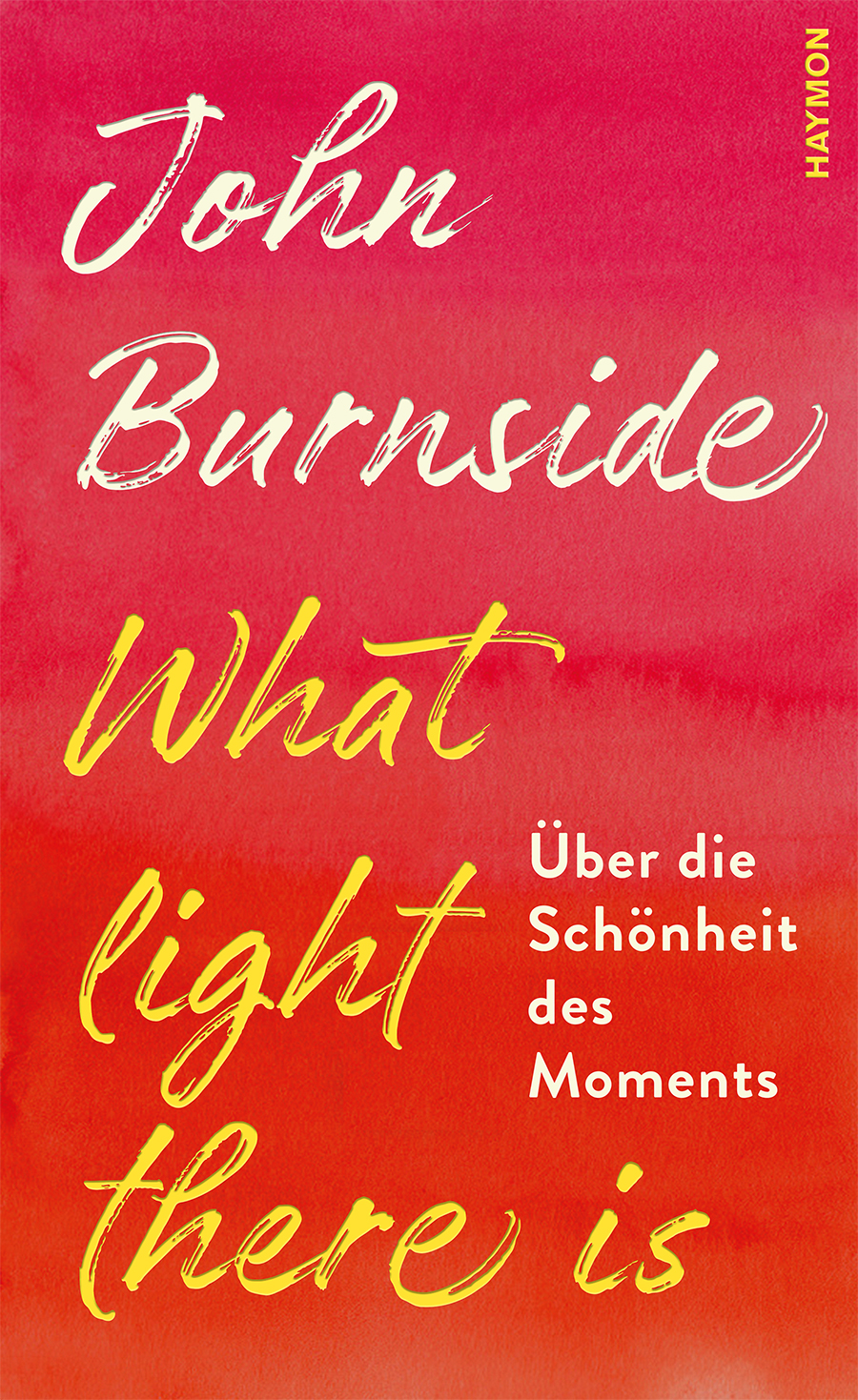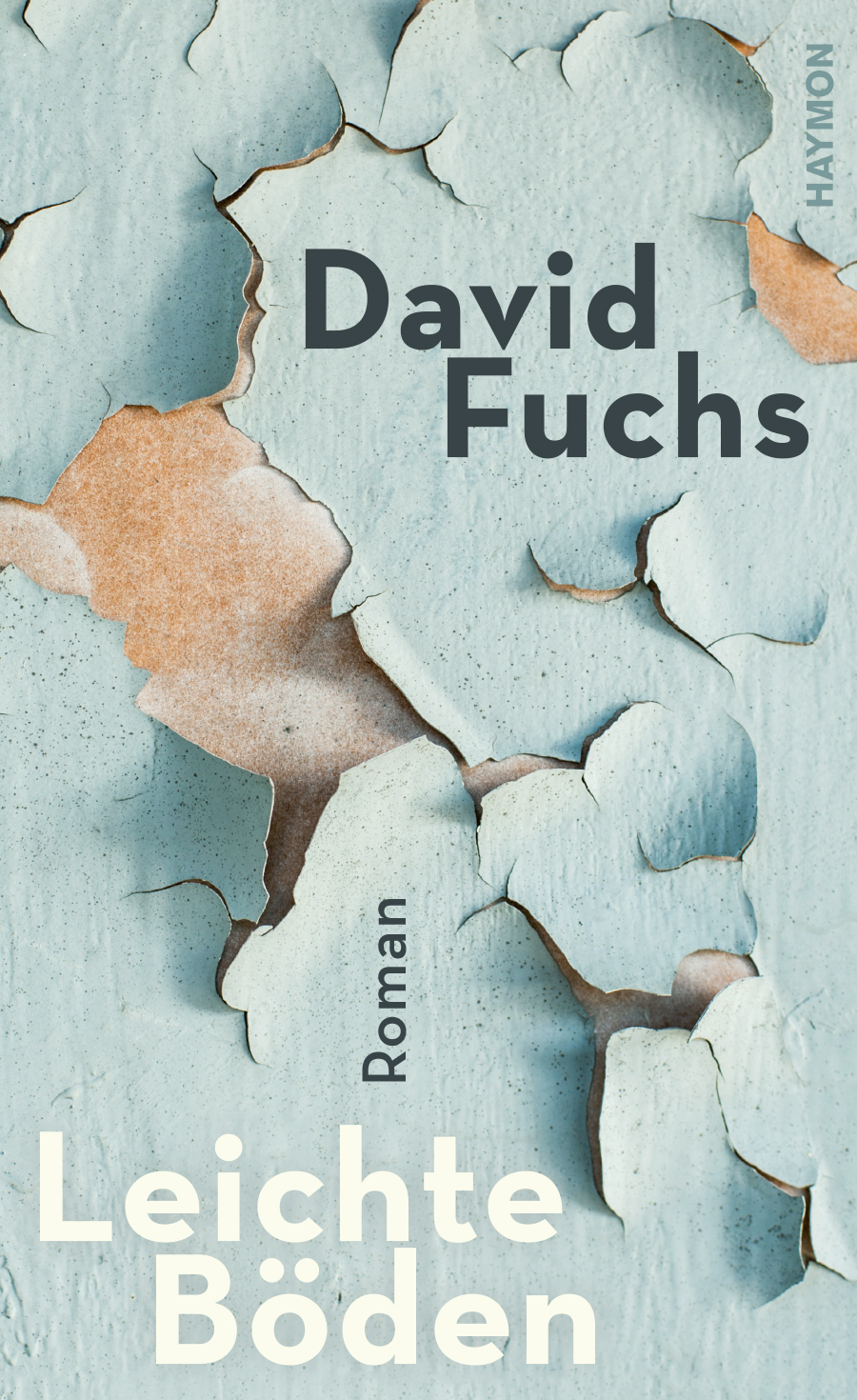„Die Beziehungsebene annehmen und leben ist das Wirkungsvollste, was wir gegen die Konkurrenz Suchtmittel tun können.“ – Ein Interview mit Thomas Klein vom Fachverband Sucht e.V.
Jedes sechste Kind leidet unter der Alkoholabhängigkeit eines oder beider Elternteile. Das ist eine schockierend hohe Zahl. Doch wo beginnt eigentlich Abhängigkeit? Wie reagierst du richtig, wenn jemand in deinem Umfeld gefährdet ist? Und wo fängt Prävention eigentlich an? Linda Müller hat mit Dr. Thomas Klein, Geschäftsführer des Fachverbandes Sucht e.V., gesprochen. Er ist seit fast vierzig Jahren im Bereich Sucht tätig und kennt das Leid der Betroffenen – und ihrer Angehörigen.
Gerade, wenn es um Alkohol geht, sind die Grenzen oft fließend – wo beginnt die Abhängigkeit? Auf Ihrer Website findet man einen Selbsttest, mit dem man einschätzen kann, ob man gefährdet ist. Gibt es Anzeichen, die Sie in Ihrer Arbeit besonders oft sehen?
Es ist, gerade was den Alkohol angeht, wichtig, drei Formen des Konsums zu unterscheiden: Genuss, schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit. So wie jede Erkrankung hat die Diagnose klare Kriterien. Da wäre zum Beispiel der Kontrollverlust, also dass man sich vornimmt, nur eine kleine Menge zu konsumieren, aber dann dennoch sehr viel trinkt. Da ist ein unbedingter Zwang, konsumieren zu müssen. Aus vielen Gesprächen mit Patient*innen weiß ich: Die Intensität, mit der der Körper nach dem Suchtmittel verlangt, ist für einen gesunden Menschen nur schwer nachvollziehbar. Und da ist natürlich auch eine Toleranzsteigerung, dass man also auch bei starkem Konsum kaum Auswirkungen bemerkt. Ich habe beispielsweise Patient*innen erlebt, die bei einem Blutalkohol von drei Promille kaum betrunken wirkten.
Eine wichtige Frage ist: Wo wird es kritisch? Wo geht es weg vom Genuss? Ein wichtiges Stichwort ist hier: Funktionalisierung. Ich suche also nach einer bestimmten, positiven Wirkung, die der Alkohol auf mich hat: Ich bin entspannter, besser gelaunt, kann besser schlafen, empfinde weniger Schmerz. Wenn ich diese Wirkung wiederholt suche, befinde ich mich in einem Bereich, wo mein Konsum gefährlich werden kann – es geht mir nicht um den Genuss, ich möchte eine Wirkung wiederholen. Das gilt grundsätzlich für alle Suchtmittel.
Bei Alkohol kommt im Laufe der Zeit auch eine physische Ebene dazu, neurologische Abläufe verändern sich, der Zwang, zu konsumieren, hat physiologische Gründe. Das ist im Umgang mit Erkrankten wichtig zu wissen: Der Erkrankte kann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr frei entscheiden, aufzuhören, weil ein Entzug somatische, körperbezogene Auswirkungen hat.
Einige Fragen im Selbsttest betreffen heimlichen Konsum und Schuldgefühle nach dem Trinken. Wissen viele Betroffen insgeheim, dass ihr Konsum eine Grenze überschritten hat?
Das beschreiben sehr viele Betroffene, dass ein Gespür dafür da ist, dass ihr Umgang mit Alkohol nicht normal und problematisch ist. Wir Menschen haben (zum Glück) die Fähigkeit zur Verdrängung, sonst könnten wir zum Beispiel in Trauersituationen nicht funktionieren, sondern wären langfristig blockiert. Diese Fähigkeit greift auch hier: Die Betroffenen registrieren zwar, dass ihr Umgang mit Alkohol nicht okay ist, haben aber die Illusion, dass sie das Trinken eigentlich doch abstellen können. Sie orientieren sich an anderen, die noch mehr konsumieren, die ihrer Meinung nach „echte“ Alkoholiker*innen sind.
Auch das Kaschieren des Konsums nach außen hin ist Teil der Verdrängung: Viele Suchtkrankheiten fallen im Umfeld über Jahre nicht auf. Ein Patient von mir beispielsweise war Hausarzt, und über Jahre hinweg hat niemand seine Abhängigkeit bemerkt, er konnte mehr oder weniger normal seiner Arbeit nachgehen. Betroffene entwickeln teils immense schauspielerische Fähigkeiten, um sich selbst und anderen etwas vorzumachen.
Würden Sie sagen, dass Alkohol gefährlicher ist als andere Substanzen, weil er ständig verfügbar und in einem gewissen Ausmaß gesellschaftlich akzeptiert ist, oder ist das ein Trugschluss?
Ganz klar: Ja. Einerseits ist Alkohol Teil unserer Kultur, wird nicht nur toleriert, sondern der Konsum wird sogar erwartet, er gehört in vielen Situationen dazu. Sich von Alkoholkonsum zu distanzieren, hat immer einen kleinen Beigeschmack und wirft vielfach Fragen auf: Bist du krank, abhängig, schwanger …?
Die Ausprägung von jeder Form von Abhängigkeit ist immer auch Abhängig von Verfügbarkeit. Wir haben zwar Jugendschutz-Gesetze, aber wir alle wissen, dass die untergraben werden können. Ich hab zwei mittlerweile erwachsene Töchter, und ganz klar haben auch die als Jugendliche Mittel und Wege gefunden, an Alkohol zu gelangen.
Gruppendynamiken spielen, was den Konsum von Alkohol angeht, ebenfalls eine Rolle: Gerade als junger Mensch möchte man dazugehören. Und man muss auch sagen: Natürlich schafft Alkohol in Maßen eine andere, häufig ausgelassene Stimmung und kann in Party-Situationen Spaß machen. All das fördert, dass Menschen mit Alkohol in Berührung kommen.
Hierin unterscheidet sich Alkohol von illegalen Suchtmitteln, denn die sind, Cannabis vielleicht ausgenommen, nicht so einfach verfügbar, damit ist auch die Verführungssituation weniger groß.

Suchtkrankheit betrifft nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr Umfeld. Gerade Kinder von Suchtkranken müssen besonders gut auf sich achten.
Abhängigkeit ist eine systemische Erkrankung, es leidet immer auch das Umfeld der Betroffenen, leider gerade auch die Kinder.
Kinder und Jugendliche befinden sich in einem Prozess des Lernens. Man lernt nicht nur, zu gehen, zu denken und zu sprechen, man lernt auch, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich in Konflikt- oder Verzweiflungssituationen verhalten und so weiter. Wenn Kinder in einem Kontext aufwachsen, in dem Alkohol zum Beispiel dazugehört, wenn es Probleme gibt, wenn bei einem Streit eine Partei die Wohnung verlässt und betrunken zurückkommt, wenn Traurigkeit kompensiert wird, dann erlernen sie gewissermaßen auch dieses Verhalten. So sind leider viele meiner Patient*innen aufgewachsen.
Es wird viel diskutiert, ob es bezüglich Suchtpotential einen Erbfaktor gibt, ich schätze diesen aber, wenn überhaupt, als sehr klein ein. Der Faktor Lernen und Mitbekommen spielt eine größere Rolle. Sehr oft habe ich gehört: „Ich wollte nie wie mein Vater werden, und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich letztlich in dieselben Muster falle.“ In meinen Augen hängt das damit zusammen, dass man als Kind suchtkranker Eltern oft wenig Chancen hat, alternative Strategien zur Problemlösung zu erlernen und anzuwenden, so ist man auf das Verhaltensspektrum zurückgeworfen, das man kennt.
Gibt es Strategien der Abgrenzung, die man Kindern von Suchtkranken mitgeben kann?
In meinen Augen fängt Prävention bereits im Kindergarten an. Aber nicht etwa dahingehend, dass man Kleinkindern erzählt, wie gefährlich Alkohol ist. Es geht darum, Kindern zu einer eigenen Persönlichkeit zu verhelfen, ihnen zu ermöglichen, dass sie selbst möglichst stabil werden. Dass sie lernen, wie wichtig Freundschaften sind, wie schön es ist, sich auszutauschen, dass sie wahrgenommen werden. Dann haben Menschen eine große Chance, dass sie sich, wenn sie keine Möglichkeit haben sich abzugrenzen, Unterstützung suchen – in Beratungsstellen oder eben auch bei Freund*innen. Und für die Freund*innen gilt: einfach zuhören und da sein. Nicht sofort gute Ratschläge geben, sondern zum Beispiel auch anbieten, sich gemeinsam bei einem Ausflug abzulenken, Übernachtungsmöglichkeiten für schwierige Momente anzubieten. Kurzum: Die Beziehungsebene annehmen und leben, das ist das Stabilste und das Wirkungsvollste, was wir gegen die Konkurrenz Suchtmittel überhaupt tun können.
Was sind die größten Herausforderungen im Zusammenleben mit suchtkranken Menschen?
Ich habe im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit sehr viel mit Angehörigen gearbeitet und bestimmte Punkte immer wieder gesehen.
Schuld- und Schamgefühle sind dominant, häufig wird auch versucht, das Problem krampfhaft geheim und innerhalb der Familie zu halten. Es wird als eigene Schwäche empfunden, dass man den*die Partner*in nicht stabilisieren kann, Verantwortung wird umdefiniert, Angehörige übernehmen Verantwortung für einen Genesungsprozess, den nur der*die Betroffene leisten kann.
Das Stigma ist hier noch größer, wenn Frauen betroffen sind, bei Männern ist übermäßiger Alkoholkonsum gesellschaftlich eher akzeptiert.
Zudem begeben sich Partner*innen oft unbewusst in eine bestimmte Opferrolle, die schwer zu durchbrechen ist. Hier gab es während meiner Arbeit im Suchtbereich immer wieder extrem aufschlussreiche Momente in Anamnesegesprächen, in der Muster von Wiederholung in der eigenen Rolle deutlich wurden. Die eigenen Strukturen und Anteile daran zu identifizieren, kann extrem hilfreich sein.
Wie geht man am besten vor, wenn man bemerkt, dass jemand in der engeren Umgebung in Richtung Suchtkrankheit schlittert? Kann man helfen?
Ja. Ich kann etwas tun. Hinter dieser klaren Antwort steckt ein Grundprinzip auf der gegenüberliegenden Seite, also der Seite des Betroffenen. Ich kann nicht nicht denken. Wenn ich also jemanden auf ein Problem anspreche, nimmt er es auf, auch, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er im ersten Moment abwehrt.
Wenn mir aber jemand wichtig ist und ich ihn gernhabe, dann habe ich auch eine Verantwortung, und dazu gehört es auch, Grenzen deutlich zu machen. Wenn mehrere Menschen das tun, wenn mehrere Menschen klar äußern, wie sie eine Situation, einen Umgang mit Alkohol einschätzen, wird die betroffene Person nicht umhinkommen, sich damit auseinanderzusetzen – spiegeln ist also sehr wichtig.
Man muss allerdings auch aushalten können, dass die Reaktion auf eine Konfrontation dieser Art sehr negativ sein kann und die betroffene Person sich vielleicht zunächst abwendet. Dazu muss man sich aber, so hart es klingt, vor Augen halten: Wenn ich nichts tue, übernehme ich Mitverantwortung. Die Selbstmordraten unter Suchtkranken sind hoch. Und auch, wenn es zunächst zu einem Bruch in der Beziehung kommt, habe ich oft gesehen, dass die Beziehung letztlich daran gewachsen ist.
Schätzungsweise jedes sechste Kind in Deutschland leidet unter der Sucht eines oder sogar beider Elternteile, ergibt meine Recherche. Das ist eine schockierend hohe Zahl. Welchen Weg müssen wir einschlagen, um dieses Zahl zu senken? Wie sieht gelungene Prävention aus?
Ich engagiere mich diesbezüglich seit über drei Jahrzehnten auch politisch, manchmal verzweifelt man daran, immer wieder gibt es auch kleine Erfolge.
Besonders wichtig finde ich die Begleitung von Kindern. Die Gesellschaft verändert sich laufend. Es gibt eine hohe Anzahl an Alleinerziehenden und berufstätigen Eltern, die Versorgung der Kinder passiert zu einem Teil außerhalb des Zuhauses. Daher finde ich, dass die Berufe, die diese Versorgung leisten, also etwa Erzieher*in, Lehrer*in etc., unbedingt aufgewertet werden müssen. Hier sind wir wieder beim Stichwort Lernen, aber eben außerhalb des familiären Kontextes. Die Anerkennung und die Rahmenbedingungen dafür sollten ausgebaut werden, ebenso die Ausbildungssituation – denn in die Familie selbst kommt man oft ohnehin nicht hinein, helfen kann man Kindern von Betroffenen vor allem außerhalb. Und kann ihnen so den Weg in ein gesundes Erwachsenenleben ebnen.
Auch Aspekte wie Werbung haben sich zum Positiven verändert, hier darf man allerdings nicht stehenbleiben und muss stets kritisch hinterfragen – beispielsweise auch die mediale Darstellung von Alkoholkonsum. Und selbstverständlich ist es wichtig, Therapiemaßnahmen entsprechend zu ermöglichen und zu finanzieren. Natürlich stehen uns hier noch viele Herausforderungen bevor, die wir angehen müssen. Aber ich sehe es positiv: Ich denke, wir sind weit gekommen und auf einem guten Weg.