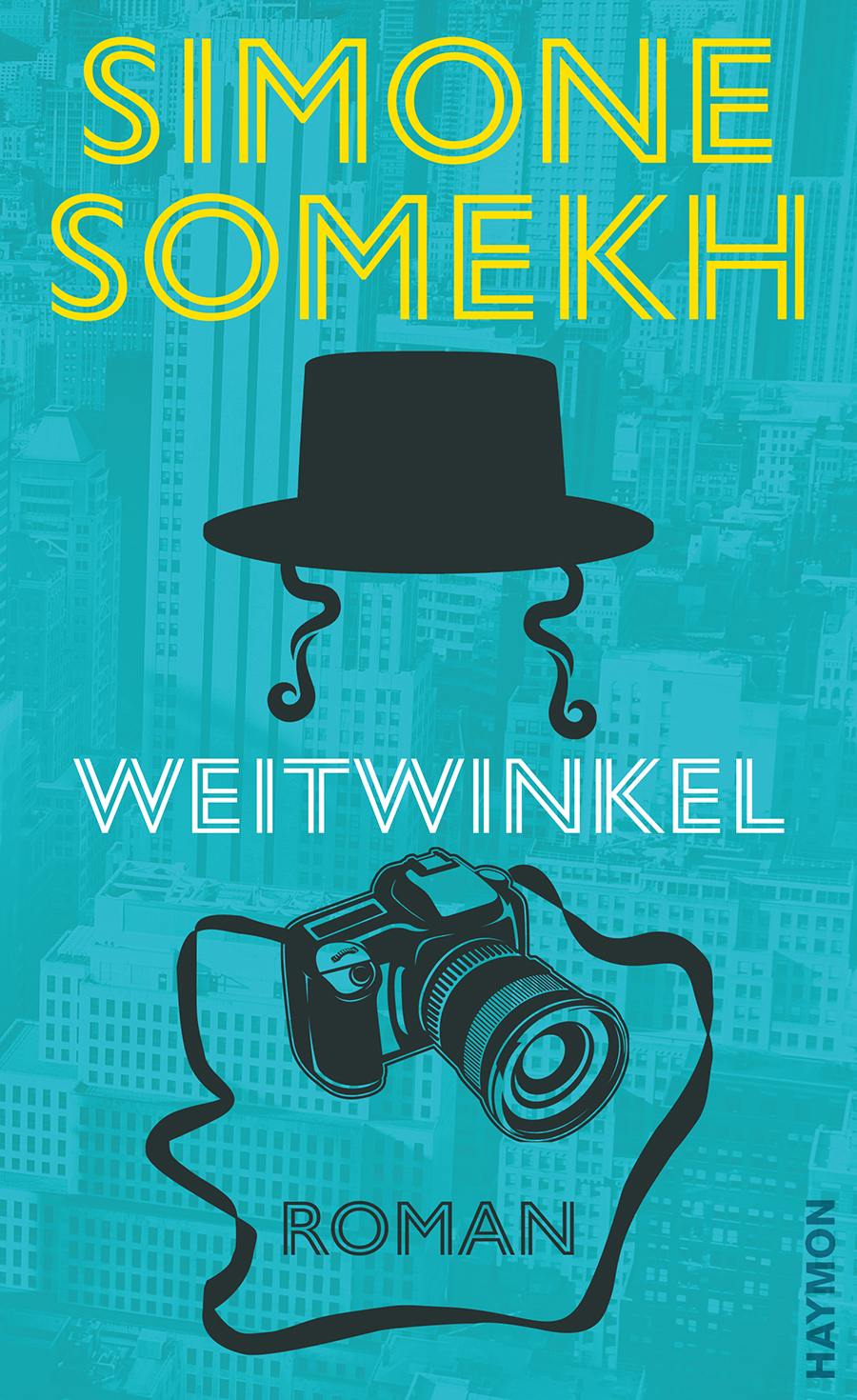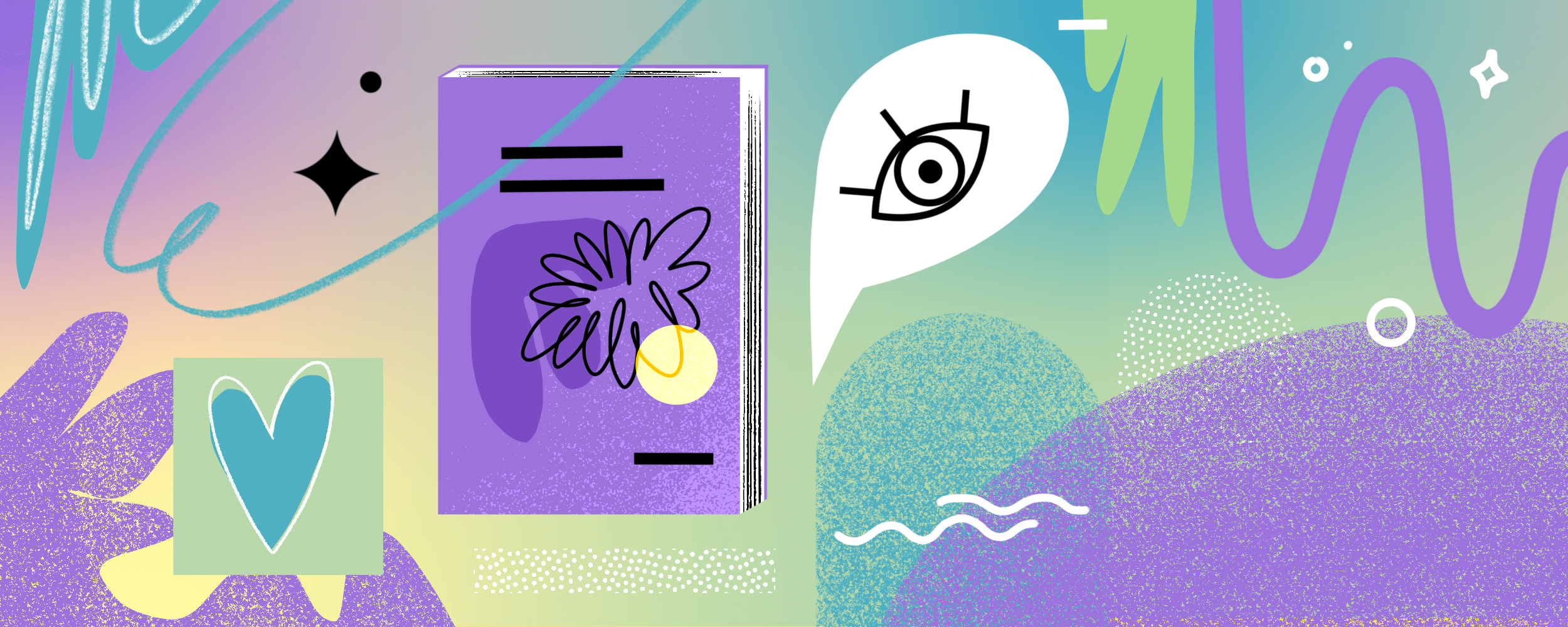
„Wir alle können eine respektvolle Haltung einnehmen und versuchen, andere Personen in ihrer Menschlichkeit wahrzunehmen.“ Ein Interview mit Sharon Dodua Otoo
„Dürfen Schwarze Blumen Malen?“, fragt Sharon Dodua Otoo 2020 in ihrer Klagenfurter Rede zur Literatur. Die Autorin und politische Aktivistin unterstützt unter anderem die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. und Phoenix e.V. und beschäftigt sich mit der Wirkmacht von Sprache, mit Mechanismen der Ausgrenzung und damit, wie wir einander respektvoll und menschlich begegnen können. Mit Linda Müller hat sie darüber gesprochen.
2020 hielten Sie die Klagenfurter Rede zur Literatur „Dürfen Schwarze Blumen Malen?“. Eindrücklich zeigen Sie darin auf, dass Sprache wirkmächtig ist, dass sie Realitäten verändert. Und dass sie sich wandeln kann, auch und besonders im Sinne eines für alle Sprecher*innen respektvollen Umgangs. Worüber sollte ich als Individuum nachdenken, wenn ich meinen eigenen Umgang mit Sprache reflektiere? Und inwiefern kann mir Sprache ein „Post-it-Note“ sein?
Ich freue mich über die Frage, gleichzeitig hoffe ich, dass in meiner Rede auch klar wurde, dass ich mich als Lernende begreife und dass ich ebenso auf der Suche bin. Ich habe mich vielleicht mehr mit rassismuskritischen Themen auseinandergesetzt, dafür kennen Sie sich vielleicht mehr mit anderen Formen von Diskriminierung aus. Wir können voneinander lernen. Mir hilft es, immer wieder daran zu denken, dass Menschen nicht marginalisiert *sind*, sondern dass sie marginalisiert *werden*. Und dahinter, dass diese Marginalisierung passiert, muss keine Absicht stecken. Wenn ich weiß, dass mein Sprachgebrauch zu weiteren Ausschlüssen beiträgt, dann kann ich die Entscheidung treffen, dies zu ändern. Bei der Buchpräsentation von „Adas Raum“ beispielsweise war es mir wichtig, dass in die deutsche Gebärdensprache gedolmetscht wird. Aber auch in meiner eigenen Wortwahl kann ich diskriminierende Begriffe vermeiden, um ihnen nicht unnötig Raum zu geben. Ich kann auf zum Beispiel Selbstbezeichnungen achten.
Meine Idee mit der Post-It-Note soll deutlich machen, dass es keine einfachen Lösungen geben wird. Manche Menschen möchten als „Mensch mit Behinderung“ bezeichnet werden, manche lehnen das ab und bevorzugen die Selbstbezeichnung „Behinderte“. Unser Anspruch kann nicht sein, es perfekt zu machen. Dann werden wir scheitern. Aber wir alle können eine respektvolle Haltung einnehmen und versuchen, andere Personen in ihrer Menschlichkeit wahrzunehmen.

In einem Interview mit dem Domradio sprechen Sie davon, dass Sie sich in einer fragenden, demütigen Haltung mit Themen beschäftigen möchten. Ist das etwas, das Sie im derzeitigen Diskurs im Literaturbetrieb vermissen: die Wahrnehmung, dass es mehr als nur eine Wahrheit gibt, und dass jeder immer dazulernen kann und muss – aber auch Fehler machen darf?
Ja, ich vermisse das tatsächlich. Ich treffe zum Beispiel immer wieder wundervolle Literaturkritiker*innen, die eine ähnliche Haltung haben. Allerdings sind sie in der Regel nicht diejenigen, die die großen Schlagzeilen schreiben. Ich frage mich, was es brauchen würde, um genau diesen Stimmen mehr Raum zu geben, damit wir mehr von ihnen mitbekommen und sie besser gehört werden.
Der Literatur im deutschsprachigen Raum bzw. auch dem Literaturbetrieb wird häufig vorgeworfen, sich in einem Elfenbeinturm zu befinden. In einem weißen Elfenbeinturm, in dem auch Klassismus und Sexismus ein Problem sind und in dem ebenso wie im alltäglichen Leben Mehrfachdiskriminierung droht. Sehen Sie diesbezüglich eine Entwicklung in die richtige Richtung – und an welchen Stellen gibt es noch besonders viel zu tun?
Das ist eine große Frage. Ich kann selbstverständlich nur über die Bereiche reden, die ich mitbekomme, und selbst da bin keine Expertin. Mein Eindruck ist, dass sich besonders auf Social Media viel tut. Diskussionen auf Twitter in der sogenannten „Buchbubble“ sind für mich anregend und lehrreich. Außerdem sind Formate wie 54books leicht zugänglich und bemüht, eher marginalisierte Themen hervorzuheben.
Aber es ist leider noch immer so, dass ich als deutschsprachige Schwarze Autorin oft die einzige Schwarze Person bei meinen eigenen Veranstaltungen bin. Wie kann der Literaturbetrieb weitere Schwarze Menschen als Publikum ansprechen? Wie bekommen wir mehr Schwarze Bewerber*innen für Stellen in Literaturhäusern? Buchhandlungen? Als Moderator*innen? Was würde es brauchen, damit eine größere Zahl von Schwarzen Schreibenden auch von Agenturen repräsentiert würde? Auch Schreibstipendien bekämen? An Literaturwettbewerben teilnehmen würden? Es wäre wunderbar, wenn diese Fragen viel mehr diskutiert würden.
Sie sind Aktivistin, ein politischer Mensch, auch abseits Ihres Schreibens, und Sie weisen immer wieder darauf hin, dass Ihre Texte erst durch Rezeption zur Literatur werden. Lassen sich Literatur und Politik überhaupt trennen? Oder bedingen sie einander?
Ich sehe Literatur und Politik als sehr eng miteinander verknüpft. Aber ich bin nicht die Erste, die diese Haltung hat – denken wir zum Beispiel an die Arbeiten von Max Frisch, Heinrich Böll und Bertolt Brecht. Ich wundere mich über manche Diskussionen, denn ich halte es für selbstverständlich, dass wir Autor*innen, die Bühnen und Aufmerksamkeit bekommen, auch eine gewisse Verantwortung haben. Wir können mit unserer Imaginationskraft Lesenden zu neuen Gedanken und möglicherweise auch zu Handlungen inspirieren. Das ist eine sehr machtvolle Position. Und in einer Gesellschaft, in der es Machtgefälle gibt, ist es für mich logisch, dass wir Schreibenden uns diesen Machtgefällen gegenüber kaum neutral verhalten können. Damit meine ich nicht, dass unsere Arbeit sich explizit um parteipolitische Themen drehen muss! Ich finde, es wäre schon ein radikaler Schritt, wenn weiße Autor*innen Romane schreiben würden, in denen zum Beispiel Hauptfiguren den eigenen (erfolgreichen oder gescheiterten?) Lernprozess über Rassismus thematisieren würden.
Neben den Adas erheben weitere Protagonist*innen eine Stimme, und zwar solche, von denen man es gemeinhin eher nicht erwarten würde. Ein Reisigbesen, ein Türklopfer, ein Ausweis, ein Raum – Adas Zimmer. Oder anders betrachtet: Die Stimme einer wandernden Seele spricht aus Gegenständen zu uns. Warum diese besondere Perspektive?
Weil es in „Adas Raum“ viel um Trauma und Gewalt geht, wäre es naheliegend gewesen, entweder aus einer sogenannten „Opferperspektive“ oder aus einer sogenannten „Täterperspektive“ zu schreiben. Viel interessanter war es für mich allerdings, zu beobachten, was Trauma und Gewalt mit uns machen – mit uns als Individuen ebenso wie mit uns als Gesellschaften. Um mich damit auseinanderzusetzen, um weg von der „Schuldfrage“ zu kommen und hin zu einem Nachdenken über Konzepte von Zeug*innenschaft, habe ich diesen Versuch gestartet. In einer Erzählstimme aus diversen Gegenständen sah ich das Potential, diese Aufgabe zu erfüllen. Zumindest wollte ich das ausprobieren.
Ob das klappt? Das müssen die Lesenden entscheiden!
Sie sind ausgesprochen gefragt und Ihr Terminkalender ist sicherlich zum Bersten gefüllt. Trotzdem: Ein besonderer Traum von mir wäre es, Sie in einer Jury (Bachmann?!) zu sehen. Gibt es Grund zur Hoffnung?
Haha… echt? Warum? Ich bin nämlich keine Literaturkritikerin. Ich befürchte, ich würde in einer Bachmann-Preis-Jury nicht mithalten können …
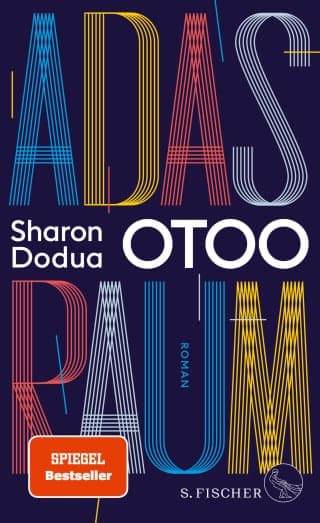
In ihrem Roman „Adas Raum“ verwebt Sharon Dodua Otoo die Lebensgeschichten vieler Frauen zu einer Reise durch die Jahrhunderte und über Kontinente. Ein überraschendes Buch, das davon erzählt, was es bedeutet, Frau zu sein.
Ada erlebt die Ankunft der Portugiesen an der Goldküste des Landes, das einmal Ghana werden wird. Jahrhunderte später wird sie für sich und ihr Baby eine Wohnung in Berlin suchen. In einem Ausstellungskatalog fällt ihr Blick auf ein goldenes Armband, das sie durch die Zeiten und Wandlungen begleitet hat. Ada ist viele Frauen, sie lebt viele Leben. Sie erlebt das Elend, aber auch das Glück, Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft für ihre Unabhängigkeit. Sharon Dodua Otoos Mut und ihre Lust zu erzählen, ihre Neugier, die Vergangenheit und die Gegenwart zu verstehen, machen atemlos.