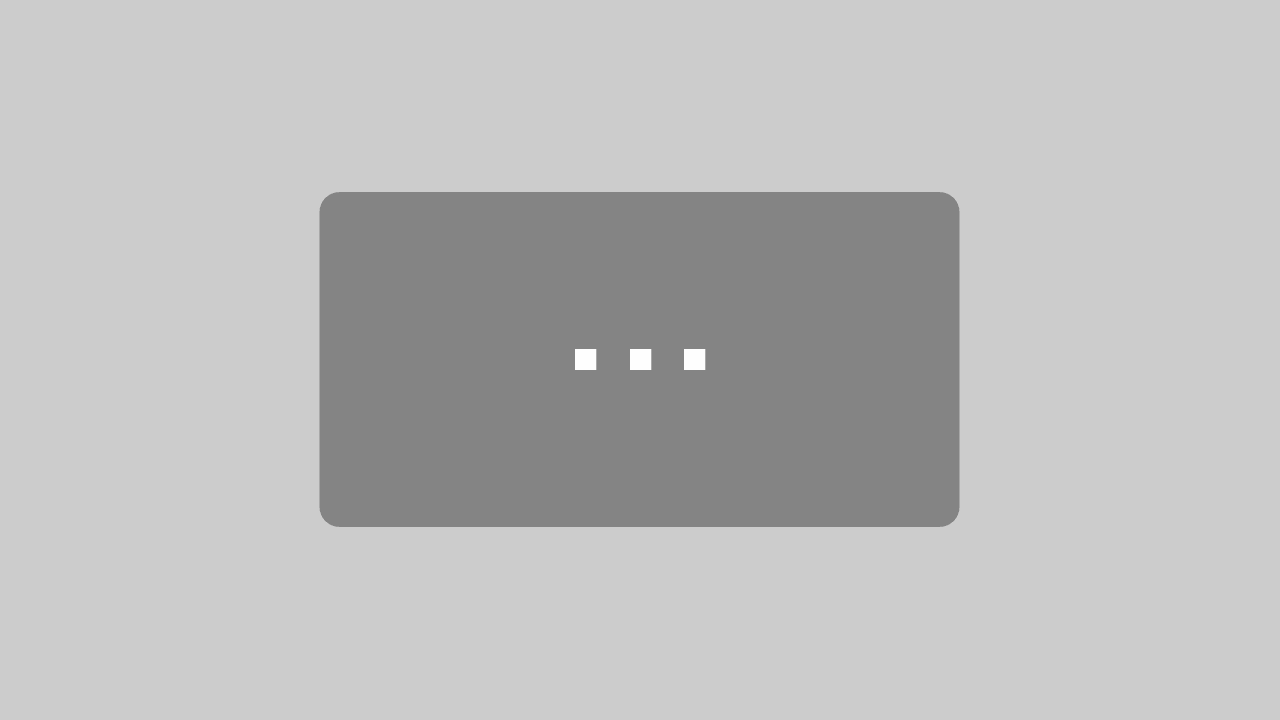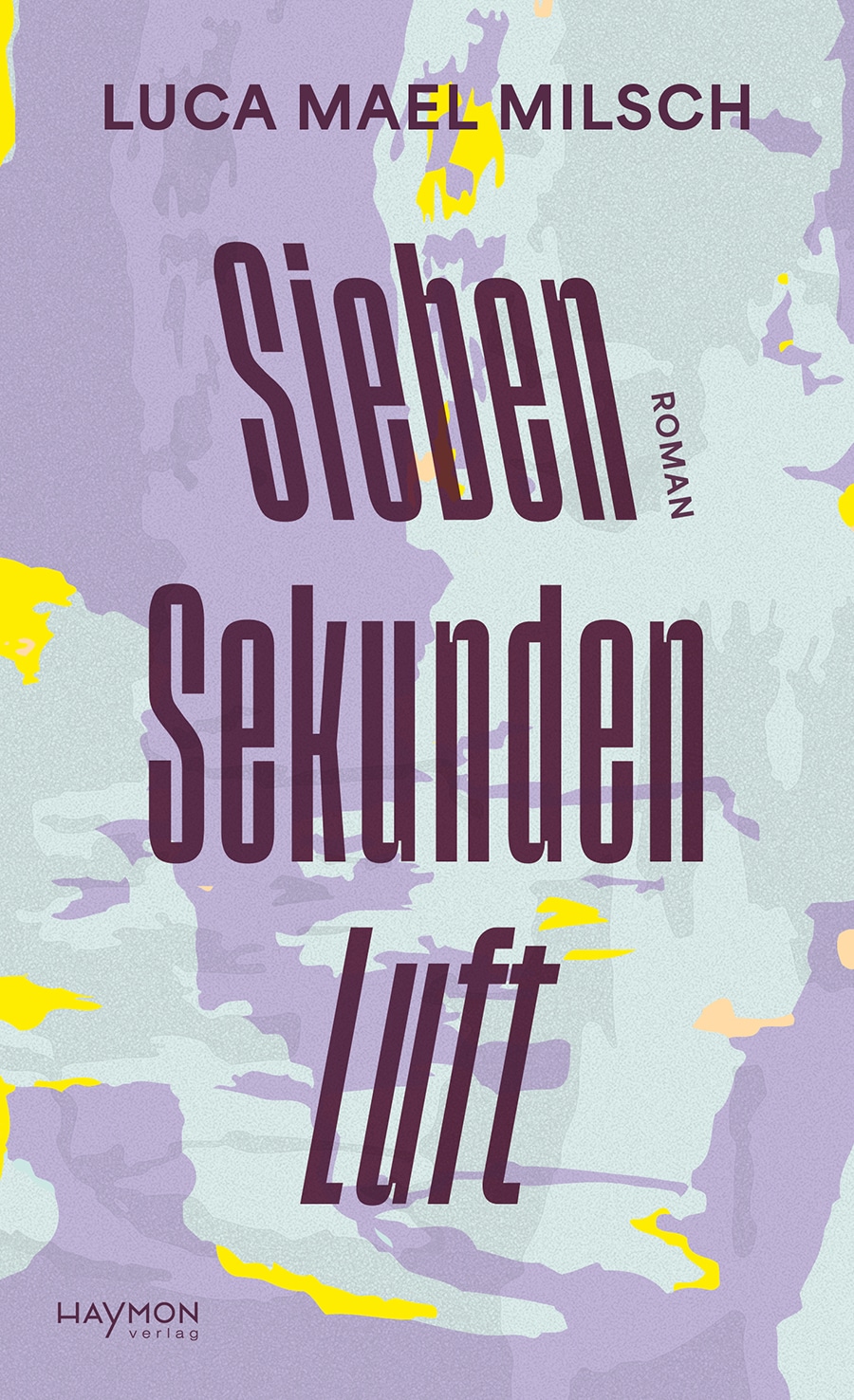„Man könnte für eine Gesellschaft sorgen, in denen weniger Gründe produziert werden, hassen zu müssen oder beschämt zu werden.“ – Videointerview mit Olivier David
„Für gewöhnlich liest unsereins nicht vor Publikum aus Büchern, unsereins trägt Sicherheitsschuhe beim Arbeiten, hat Kopfhörer auf den Ohren gegen den Lärm, hat Schmerzen irgendwo, lehnt, wo er kann, gähnt, so oft es geht.“ Das schreibt Olivier David in seinem Essay-Band „Von der namenlosen Menge“. In einem Video-Interview haben wir uns mit dem Autor unterhalten, der im Supermarkt, als Malerhelfer, Kellner, Lagerarbeiter, Schauspieler gearbeitet hat, ehe er mit 30 den Quereinstieg in den Journalismus schaffte. Darüber, was es heißt, seinen zugewiesenen Platz zu verlassen, darüber, was es bedeutet, eine authentische Sprache zu finden, die sein Herkunftsmilieu nicht preisgibt. Eine Sprache der Analyse, aber auch eine der Wut, der Einsamkeit, der Scham.
Warum gesellschaftliche Gewalt so oft unsichtbar bleibt, wieso es wichtig ist, die Geschichten der depriviligierten Milieus festzuhalten und was dies mit einer Veränderung der Machtverhältnisse zu tun hat, könnt ihr in unserem Haymon-Interview nachhören und in einer gekürzten, redigierten Version unten nachlesen.
Im Feuilleton liest man ja immer wieder, dass klassenbewusste, soziologisch angehauchte Literatur eine Art Hochphase erlebt, und deswegen möchte ich auch mit Blick auf dein Buch ein bisschen provokant fragen, ob unter diesen Vorzeichen Armut überhaupt noch ein tabuisiertes Thema ist?
Die Art und Weise, wie über Armut gesprochen wird, ist nicht tabuisiert, es gibt in den letzten Jahren nicht nur in der Literatur, sondern auch im Journalismus auf eine Art ein großes Willkommenheißen für solche Themen. Das hat natürlich auch irgendwie mit dem Druck von unten zu tun, dass für mehr Diversität gesorgt werden soll. Die Frage ist aber, und das gilt für den Journalismus, aus dem ich eigentlich komme, und für die Literatur gleichermaßen: Was darf man und was darf man nicht, also welche Rollen werden einem zugeschrieben? Und wenn man sich das anschaut, dann ist es im Journalismus ganz stark so, dass Menschen objektifiziert werden, das heißt, dass sie einfach ganz konkrete Funktionen erfüllen und innerhalb von bestimmten Schablonen funktionieren sollen. Und jetzt könnte man mit gewissem Recht sagen, dass es in der Literatur anders ist, aber ich bin da vorsichtig geworden, weil ich glaube, der Grund, warum bestimmte Armutsgeschichten oder bestimmte Klassengeschichten Erfolg haben, liegt darin, dass sie in bestimmten Rahmen funktionieren, wo sie Grundsätzliches nicht in Frage stellen und wo sie elementare Widersprüche nicht ansprechen. Also wo sie mit politischer Sprache arbeiten und sich hinter einem Kunstbegriff verstecken, wenn es dann darum geht, Dinge konkret werden zu lassen. Ich bemerke das immer wieder, sobald man sich aufmacht, seinen Platz zu verlassen – und mein Platz ist es mit meinem ersten Buch gewesen, meine eigene Geschichte erzählen zu dürfen. Sobald ich meinen Platz verlasse, wird es skandalisiert, dann wird einem gesagt, das steht dir gar nicht zu. Du bist hier, um deine Geschichte zu erzählen. Und das ist für mich kein Begriff von ehrlicher Teilhabe und kein ehrlicher Begriff von Interesse. Wenn wir Leute einladen, teilzuhaben, dann müssen wir ertragen, dass die eine andere Analyse von der Welt haben. Und das erlebe ich sowohl in der Literatur als auch im Journalismus und eben auch in der Politik nicht.

Olivier David, 1988 in Hamburg-Altona geboren, ist Schriftsteller und Kolumnist. Nach der Schule arbeitete er mehrere Jahre in einem Supermarkt, bevor er eine Schauspielausbildung begann. Olivier David jobbte als Kellner, Malerhelfer und Lagerarbeiter, nebenbei spielte er Theaterstücke für Kinder. Mit 30 gelang ihm der Quereinstieg in den Journalismus. 2022 erschien sein erstes Buch „Keine Aufstiegsgeschichte – Warum Armut psychisch krank macht“. Für die Tageszeitung „nd“ schreibt Olivier David die Kolumne „Klassentreffen“, für das Schweizer Magazin „Das Lamm“ die Kolumne „David gegen Goliath“.
Es wird eine Sprache gewählt, die an den Machtverhältnissen nichts ändert, sondern sie im Gegenteil reproduziert. Wie findet man das – eine Sprache in der man „authentisch“ zum Beispiel über sein Herkunftsmilieu oder seine Zugehörigkeit sprechen kann?
Ich habe einen Fundus aus 35 Jahren Gefühlen, Erleben, Erfahrungen – von Gewalt, von Deklassierung – in mir und bin mit vielen starken Gefühlen sozialisiert. Auch heute noch bin ich von vielen starken Gefühlen wie Wut und Trauer und großer Angst und Einsamkeit umgeben. Dafür eine Sprache zu finden – das hat einfach lange gebraucht.
Der erste Essay den ich für dieses Projekt geschrieben habe, war der Essay, wo es um die Beschaffenheit armer Körper geht. Wodurch sind arme Körper determiniert, was beeinflusst die Leben von armen Menschen und auch ihre Körper? Da war mir gleich klar, das muss etwas Gehetztes, das muss irgendwie zwischendurch etwas Atemloses bekommen, das muss etwas Grundwütendes haben, das muss diese Wut ausdrücken, die meine Muskeln gespürt haben, als ich am Fließband gearbeitet habe. Diese Hoffnungslosigkeit, wenn du merkst: Ah, okay, zwei Kollegen werden gerade von deinem Fließband weggenommen und du siehst, die Pakete stapeln sich. Und diese ganze Wut, unter einem Maleranzug zu stecken und der Bürgermeister von Hamburg, der später dann unser Bundeskanzler geworden ist, Olaf Scholz, geht mit einem Tross aus 50 Anzugträgern an dir vorbei und verdient in einer Minute so viel wie du in einem ganzen Monat. Dieses auf seinen Platz zurückgewiesen werden. Diese Gefühle, die müssen irgendwie in Sprache gegossen werden und letzten Endes ist es mir leichtgefallen, eine Sprache für diese Wut zu finden, für dieses Atemlose. Es ist mir nicht so leichtgefallen, eine Sprache zu finden für die leisen Töne in mir, für die Einsamkeit. Weil ich gewohnt bin, meine Leerstellen zu überschreiben mit Aktion.
Das Schwierige an dem Essay-Band war, diese Sprachen zu verbinden: also analytische Sprache und die Sprache der Wut miteinander zu verbinden, oder die emotionale Sprache zu verbinden mit den Teilen, in denen ich auf die Suche gehe, was es denn in der Literatur schon für Gedanken zu den Themen gibt, die ich verhandle. Und das zusammenzubringen, mit Momenten, an die ich mich erinnere, meiner Familie, mit Momenten von Menschen aus meinem Umfeld, mit meinen Gefühlen – das zusammen zu verwurzeln, das war für mich eine große Herausforderung. Da einen gemeinsamen Ton, eine Temperatur zu finden.

In deinem Buch, so mein persönlicher Eindruck, steckt auch eine Art Rehabilitation von verpönten oder geächteten Emotionen in unserem Diskurs. Also Wut, Frust, Scham, Ohnmacht – die Art und Weise, wie darüber oft öffentlich geredet wird, ist eine des Tone-Policings, eine der Verdrängung, der Pathologisierung, der Ächtung. Diese Emotionen markieren oft einfach individualisiertes Versagen für das Ergebnis gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Hat zum Beispiel die Wut für dich auch eine Art subversives Potenzial?
Die Wut hat absolut machtvolles, auch subversives Potenzial. Gleichzeitig ist sie im Regelfall schädlich. Zunächst für einen selbst und dann notwendigerweise auch für andere. Wut oder Ohnmacht sind an sich keine guten Gefühle. Es sind Gefühle, denen man mit einer bestimmten Klassenposition dann häufiger ausgesetzt ist.
So ist es auch mit der Scham. In aller Regel schadet Scham dem Individuum. Da ist es wahrscheinlicher, dass Menschen sich durch konstante Beschämung nicht empowern können und dass sie nicht die Möglichkeiten haben, den Blick zu öffnen und zu sagen: „Dass ich beschämt werde, ist schon ein Fall von Individualisierung sozialer Benachteiligung“. Das ganze Leben über wurde mir signalisiert, dass ich das Problem bin und ich wurde beschämt für Dinge, die institutionell schiefgegangen sind, und genauso ist es auch mit der Wut. Wut richtet sich zuerst gegen einen selbst und dann gegen andere und in aller Regel ist Wut nichts Progressives, aber ich suche nach Schreibweisen, wie man dem Schreiben für betroffene Menschen gerecht werden kann. Für mich ist es dann keine Option, diesen bürgerlichen Impetus von einer Caroline Emcke zu wählen, die sagt „Hass ist per se destruktiv“. Das ist für mich eine Art von Gaslighting. Die Menschen kriegen ein Gefühl auferlegt, das nicht zu ihnen gehört, sie sind nicht mit dem Hass geboren, sondern sie werden zu Hassenden gemacht über die gesellschaftliche Position, in die sie hineingeboren werden. Und sie dann dafür zu beschämen, dass sie diese Hassgefühle haben und dass diese sich vielleicht in einer nicht ganz adäquaten Art und Weise veräußern, das ist Victim Blaming. Diejenigen, die benachteiligt sind, werden für ihre Benachteiligung und die Gefühle, die diese Benachteiligung in ihnen auslöst, ein zweites Mal beschämt, ein zweites Mal zur Verantwortung gezogen. Und das, obwohl sie für beides nicht viel können. Da gibt’s auch Gegenbegriffe und da habe ich mich natürlich auch auf die Suche gemacht nach Autor*innen, die anders denken. Zum Beispiel Şeyda Kurt, die sagt, erstmal ist Hass nur ein Gefühl und erstmal ist es notwendig, dass wir uns mit unseren Gefühlen auseinandersetzen. Auch als Gesellschaft. Vielleicht ist Hass auch ein politisches Gefühl und vielleicht muss man auch nach den Gründen fragen, warum Leute hassen und das macht Emcke nur ganz marginal. Und damit zahlt sie natürlich ein, in so eine bürgerliche Idee von „Leute, die hassen, sind schlecht.“ Wir kennen diese linksbürgerlichen Schilder auf den Demos gegen Rechts: „Hass macht hässlich“ und „Wer hasst, ist dumm“ und so. Ich habe das auch vor zehn Jahren so ähnlich gedacht und so ähnlich gesagt. Das finde ich aber unüberlegt, es ist performativ, weil es einfach nur darum geht, etwas zu verurteilen, aber nicht nach den Gründen für den Hass zu fragen. Denn am Ende haben die Gesellschaften, in denen wir leben, viel davon in der Hand. Man kann Gesellschaft auf eine sehr gute Art und Weise steuern. Man könnte für eine Gesellschaft sorgen, in denen weniger Gründe produziert werden, hassen zu müssen oder beschämt zu werden. Und für diese Gesellschaft habe ich versucht zu schreiben. Ob es gelungen ist, müssen andere sagen.

– Olivier DavidWir entpolitisieren gesellschaftliche Gespräche permanent. Wir müssen zu einer Repolitisierung gesellschaftlicher Phänomene zurückkommen, indem wir sagen: „In allem was wir machen, steckt Gesellschaft drin“.

Geschichten von der unteren Klasse, Literatur über soziale Herkunft – meist sind das Erzählungen von Aufbruch und Aufstieg. Olivier Davids Essays kreisen um diejenigen, die unten geblieben sind. Die mit den schmerzenden Körpern, die Nachtarbeitenden, die Vergessenen – und um ihn selbst. Wie fühlt es sich an, mit dem eigenen Körper und der eigenen Gesundheit den Wohlstand höherer Klassen zu bezahlen? Wie selbstbestimmt kann die Entscheidung, allein zu bleiben, sein, wenn soziale Beziehungen durch Vereinzelung, Geldmangel und eingeschränkte Teilhabe unter Druck stehen? Wie soll Geschichte weitergegeben werden, wenn es kein kollektives Gedächtnis armer Menschen gibt?
Auf dieses Kapitel wollte ich mit der Frage hinaus. Ich glaube, dir gelingt es, auch im besten Sinne aufklärerisch zu wirken mit deinem Buch. Und zwar mit erschreckenden Zahlen: In jedem Jahr erkranken 43% der Frauen der untersten Klassen an psychischen Erkrankungen. Ein Drittel der Männer in den marginalisierten Milieus in Deutschland erleben ihren 65. Geburtstag nicht. Warum ist diese gesellschaftliche Gewalt öffentlich so unsichtbar?
Ich glaube, wir haben uns als Gesellschaft abgewöhnt, da hinzuschauen, eigentlich liegt alles vor unserer Nase. Ich war vor ein paar Wochen in dem Archiv von der Lokalzeitung in Hamburg, in der ich Volontariat gemacht habe, für die Recherche an einem Buchprojekt, das sich mit den 1970er Jahren auseinandersetzt. Und da wurden früher in so kleinen Spalten am Rand jede Woche die Unfallzahlen rausgegeben, da wurden auch Kapitalverbrechen bekannt gegeben und ich habe gesehen, was für eine gewalttätige Gesellschaft das war. Da waren Nachrichten zu finden: „Mann tötet seine Kinder“, in einer kleinen Spalte mit vier Zeilen. Das wäre heute eine Woche lang in allen Medien deutschlandweit Aufhänger gewesen. Das war den Leuten vier Zeilen wert, weil die ganze Zeitung voll war damit.
Wir sehen auch heute noch diese Nachrichten, aber wir entziehen ihnen Logiken und Schlüsse. Wenn wir zum Beispiel über Migration reden, dann reden wir ganz häufig eigentlich über Klasse. Gerade, wenn man eine konservative Einlassung zur Migration betrachtet: „Wir müssen die Migration begrenzen“. Letzten Endes geht’s da sehr oft um Klasse, und wir schauen nicht hin und unsere medialen und politischen Diskurse verkürzen und individualisieren Dinge, die passieren, auf den Moment der Tat. Wie Bourdieu sagt, wenn wir uns Gewalt anschauen, dann müssen wir hinter die Gründe für Gewalt schauen. Oftmals sind sie eben sozialer Natur. Wenn du zu Hause geschlagen wirst, ist es wahrscheinlicher, dass du selber Gewalt anwendest. Menschen, die aus der unteren Klasse kommen, wenden häufiger Gewalt an als Menschen, die mehr Geld haben. Natürlich können die es auch anders maskieren, in einer 200 Quadratmeter großen Wohnung fällt’s leichter, die Gewalt zu verbergen.
Was ich eigentlich sagen will, ist: Wir entpolitisieren gesellschaftliche Gespräche permanent. Wir müssen zu einer Repolitisierung gesellschaftlicher Phänomene zurückkommen, indem wir sagen: „In allem was wir machen, steckt Gesellschaft drin“.
Wie gesagt, reden wir hier auch von psychischen Erkrankungen: 33% der Frauen der untersten sozialen Statusgruppe in Deutschland erkranken innerhalb eines Jahres an einer psychischen Störung. Das sind epidemische Ausmaße! Wir haben 14 Millionen, wahrscheinlich mehr, Armutsbetroffene und noch mal vier bis fünf Millionen, die nah dran sind, die nicht weit in den Rückspiegel schauen müssen, um die Armut zu sehen. Wir haben 40% der Menschen in Deutschland, die nicht mal 1000 € gespart haben. Das sind alles Leute, auf die diese Frage zutrifft und das bedeutet, dass Millionen Menschen in diesem Land aufgrund ihres sozialen Status psychisch erkranken. Weil wir sehen in den höheren sozialen Statusgruppen, die das Robert Koch Institut in dieser von dir zitierten Studie erfasst, da sind die Erkrankungszahlen auf einmal fast nur noch ein Drittel. Das heißt, psychische Erkrankung ist ein Ding, und darüber zu sprechen wird langsam populär und das ist gut und notwendig. Aber es wird eben entpolitisiert, indem zu wenig über die sozialen Hintergründe dieser Sachen gesprochen wird.
Auch noch ein letztes Beispiel aus dem Essay „Der arme Körper“: Es vergeht in Zeitungen keine Woche, in der nicht irgendwelche Bauarbeiter von Gerüsten fallen, in der nicht Leute erschlagen werden, in der nicht Müllmänner ums Leben kommen – ich habe in meiner Zeit des Volontariats zwei tote Müllmänner aufgeschrieben, die von ihren Müllautos überfahren worden sind, beim Ausrangieren oder sonst was. Das sind eben originär die Menschen aus der Arbeiter*innenklasse, die während ihrer Arbeitszeit sterben, weil sie körperliche Arbeit ausüben und das ist eigentlich eine politische Sache. Das heißt, da beginnt die Selektion schon im Kindergarten und in der Vorschule, und über diese Selektion kann man eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie viel früher eine Person stirbt. Abhängig davon, welchen Beruf sie ausübt. Also, ob sie einen körperlich-handwerklichen Beruf ausübt, oder ob sie im Büro sitzen darf. Und daraus ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit, wann dein Leben zu Ende ist und mit welchen Vorerkrankungen du frühzeitig, ja, ermordet wirst, denn das lässt sich eben bis zu einem gewissen Grad steuern. Also eigentlich müsste es so sein, dass Leute, die körperlich arbeiten, zum Beispiel 15 Jahre früher in Rente gehen, denn jeder dritte Mann aus der Armutsklasse stirbt vor Beginn seines Renteneintritts. Dass wir das nicht machen, bedeutet einfach, dass es Leute gibt in diesem Land, die aufgrund ihres sozialen Status ermordet werden. So drastisch muss man es leider sagen.

– Olivier DavidWer erinnert sich an meine Tante, die Steine auf die Polizei geschmissen hat? Wer erinnert sich an meinen Vater, der im Gefängnis saß? Wenn ich es nicht mache, dann macht’s vielleicht keiner.
Das ist gesellschaftliche Gewalt, die zugedeckt wird und ich glaube, es ist ja tatsächlich auch die Herausforderung, die Schicksale zwar nachempfindbar zu machen und gleichzeitig diesen Scheinwerfer auf diesen Klassenaspekt zu richten. Denn Ideologie – das haben wir schon vor Kurzem festgestellt – sind immer die anderen. Klar muss aber sein, dass konservative Kräfte, die Machtverhältnisse unangetastet lassen und reproduzieren, sich immer unsichtbar machen und ich glaube dagegen schreibst du ja auch an.
Dieses klassenbewusste, „auto-ethnographische“ Schreiben wirft ja immer Prämissen auf, die auf den ersten Blick ganz deterministisch wirken können. Gibt’s trotzdem etwas, das Olivier David hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt?
Zuversicht ist ein schwieriges Konzept für mich, ich glaube, deswegen hat es mich zum Beispiel sehr viel gekostet, den letzten Essay zu schreiben. Weil ich mir das eben nicht erlauben wollte, da ohne Zuversicht rauszugehen. Ich finde, man muss auch die Zuversicht von der falschen Zuversicht trennen. Man changiert da zwischen so einem Aufwerten von Klasse, da gibt’s viele Lebensläufe von Menschen, die unter großer Kraftanstrengung versuchen, ihre Würde zu erhalten und denen das auch möglich ist. Und dann gibt es wieder den deterministischen Blick darauf, dass es am Ende des Tages eben auch die Frage sein kann, wie lange einen der Staat überhaupt leben lässt in einem Land.
Es geht eben in dem Buch nicht nur um mich, sondern auch um Geschichten, um Menschen um mich herum, und da muss man einfach nur hinhören und dann im Zweifel mal etwas übersetzen, wenn Leute den Zugang nicht dazu haben, dass sie Dinge so sagen, wie sie eigentlich gemeint sind. Da, wo Hoffnung da ist, muss auch – und das ist auch ein Satz aus dem Buch – von ihr berichtet werden. Ich treffe keine Empfehlungen am Ende des Buches und sage nicht, so und so und so muss es sein. Aber man muss Möglichkeiten von Hoffnung aufzeigen, wenn man ein Produzent von symbolischen Gütern ist. Alles andere wäre gefährlich, weil letzten Endes gehören wir Menschen hier im globalen Norden – Leute, die das Privileg haben, über ihre soziale Situation und über die soziale Situation von ihrem Teil der Gesellschaft zu schreiben – zu den privilegiertesten Menschen mit den meisten Ressourcen auf diesem ganzen Planeten.
Natürlich ist im Vergleich zu Multimilliardären mein Einfluss ein Witz. Aber ich glaube auch dieser alten Version von mir, die am Fließband gearbeitet hat, die arbeitslos war, die Nachtschichten, Frühschichten und Spätschichten gemacht hat und die bekifft Käse geschnitten hat hinter der Käsetheke, auch dieser Person bin ich verpflichtet. Und diesen alten Lebenslauf von mir würde ich verraten, wenn ich nicht sagen würde, dass eine andere Welt möglich ist. Ich glaube, da gibt’s einen schmalen Grat dazwischen, die Leute zu verführen, und zu sagen: „Kommt alle mit!“ Und im Gegenteil zu sagen, „Nee, es ist sinnlos“.
Es muss eben über die Hoffnung berichtet werden und, das ist ja auch das Erzählprinzip überhaupt, den Leuten muss ihre Geschichte wiedergegeben werden. Dort, wo ihnen vielleicht die Möglichkeiten fehlen, sie zu konservieren. Den Wert ihrer Geschichte anzuerkennen, das ist absolut notwendig und das ist natürlich auch ein Teil dessen, was mich interessiert an Literatur. Dass ich versuche, Zeugnis zu geben, denn: Wird meine Familie sonst gelebt haben, wenn ich nicht über sie schreibe? Die Menschen in meiner Familie erinnern sich natürlich sehr genau an ihr eigenes Leben, aber wer erinnert sich an ihr Leben in zehn, 20 Jahren? Dagegen strotzen natürlich die Archive der Herrschenden und der Reichen vor Heldengeschichten. Wer kann nicht aus dem Stand fünf Geschichten zu Elon Musk erzählen, aus den letzten zehn Jahren, die der crazy, crazy Unternehmer irgendwie auf die Reihe gekriegt hat? Aber wer erinnert sich an meine Tante, die Steine auf die Polizei geschmissen hat? Wer erinnert sich an meinen Vater, der im Gefängnis saß? Wenn ich es nicht mache, dann macht’s vielleicht keiner. Und da will ich so eine Art Erinnerungsversicherung sein für meine Leute.

– Olivier DavidEigentlich müsste es so sein, dass Leute, die körperlich arbeiten, zum Beispiel 15 Jahre früher in Rente gehen, denn jeder dritte Mann aus der Armutsklasse stirbt vor Beginn seines Renteneintritts. Dass wir das nicht machen, bedeutet einfach, dass es Leute gibt in diesem Land, die aufgrund ihres sozialen Status ermordet werden. So drastisch muss man es leider sagen.
Das finde ich auch einen schönen Gedanken, dass das Buch dann als manifestierte Erinnerung irgendwann im Regal stehen wird – quasi performativ wird. Ein Artefakt, in dem sich zumindest deine Version der Geschichte deiner Eltern oder deiner Verwandten materialisiert. Und genau das ist es ja, was der Arbeiterklasse vorenthalten wird. Schon der Titel „Von der namenlosen Menge“ geht ja zurück auf die Erzählung von Éric Vuillard über den 14. Juli, wo man nach der französischen Revolution sehr genau wusste, wie viele goldene Türknäufe aus den Palästen entwendet wurden, aber über die Protagonist*innen der Aufstände in Paris wurde überhaupt nichts dokumentiert. Vielleicht ist diese Vorstellung ja auch ein bisschen romantisierend und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber da steckt ein Stück materialisierte Erinnerung und Geschichte drin.
Ist genau der Aspekt vielleicht auch ein sensibles Thema, dass du deine Version der Geschichte festhältst? Wie geht es dir mit der Vorstellung, dass zum Beispiel dein Vater dieses Buch lesen könnte und sein Leben vielleicht anders interpretiert hätte als du mit diesem spezifisch klassenbewussten, politischen Zugang?
Also zuerst einmal zum ersten Teil, der keine Frage war: Ich sehe und meine das genau so. Für mich ist das Schreiben eine Möglichkeit, Dinge festzuhalten und sie auch später ausgedruckt zu haben, Bücher zu haben, die Zeugnis liefern. Ich finde das auch nicht naiv, sondern für mich ist das eine ganz konkrete, haptisch erfahrbare Art, sich in die Welt einzuschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und zur Frage: Wir können nicht durch die Welt gehen, ohne andere Menschen zu verletzen. Wenn ich über meinen Vater schreibe, dann verletze ich ihn damit und es ist eine andere Verletzung, als wenn ich ihm sage, ich mag dich nicht (was nicht der Fall ist, ich mag meinen Vater). Weil das ein Buch ist, ist es ja noch an eine Leser*innenschaft gerichtet, insofern multipliziert sich diese Verletzung sogar. Wie geht man damit um als Schreibender? Ich versuche, so wenig gewalttätig zu sein und so präzise zu arbeiten wie möglich. Um den Grat zwischen Fiktion, also meiner Idee von meinem Vater, und meinem Vater so schmal wie möglich zu halten. Aber in dieser schmalen Spur verliert sich immer Deutung. Eines der Essays im Buch ist ein Brief, den ich an meinen Vater geschrieben habe, der ergeht sich vor Vermutungen, eben weil ich die Leerstellen, die ich von meinem Vater habe, füllen muss, denn wir leben seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr in einem Land. Und meine Besuche bei ihm, oder die Male, die wir uns gesehen haben in den letzten 25 Jahren, die können diese Leerstellen nicht füllen. Also gibt’s sozusagen eine kleine Brücke. Es hat immer eine Fallhöhe und es wird immer Gewalt transportiert. Die Frage ist, glaube ich, mit welcher Intention das geschieht und ob es vorsätzlich geschieht, oder ob die Gewalt ein Nebenprodukt ist von einer Äußerung. Und so ist es beim Schreiben auch, eben mit dieser erweiterten Zuhörer*innenschaft oder Leser*innenschaft. Da geht’s glaube ich darum, sensibel zu sein.
Auf der anderen Seite diese Geschichten nicht zu erzählen, da frage ich mich, ob das nicht die viel größere Gewalt ist. Schreiben bedeutet auch Interpretation, und man kann natürlich nicht behaupten, ich erzähle jetzt alle Geschichten von allen Menschen aus der unteren Klasse. Das wäre essenzialisierend, man würde sagen, so wie die Leute sind, so liegt die hundertprozentige Wahrheit.
Was passiert aber jetzt mit Leuten, die arm und wahnsinnig rechts sind? Haben die dann recht, weil sie arm sind? Ich glaube, vielleicht ziehen sie falsche Schlüsse aus einem ehrlich empfundenen Leid. Und die Aufgabe von uns Schreibenden oder uns Menschen, die fürs Schreiben und fürs Denken und fürs Reden bezahlt werden, ist, zu schauen, was zwischen diesen Worten liegt. Und zu sehen, wenn jemand verhärmt vor dir sitzt, dem nur noch sieben oder acht Zähne im Gesicht stehen, wenn der dir sagt, er hat ein glückliches Leben, dann noch mal selber nachzudenken und zu sagen, welcher Kiefer erzählt dir von seinem glücklichen Leben? Der, der verspannt ist, bis ins Gehtnichtmehr? Welche Zähne erzählen dir von einem Leben, welcher Blick erzählt von einem Leben? Und versuchen, das zu dechiffrieren und natürlich geht dabei immer etwas verloren. Und natürlich wird dabei immer Gewalt reproduziert, das geht nicht anders. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist es, den Vorsatz zu haben, diese Geschichten trotzdem erzählen zu müssen und erzählen zu wollen. Und den Vorsatz zu haben, an einer Literatur zu schreiben, die den eigenen Leuten objektiv nützt, in denen man die Gewalt, die sich an ihnen ausdrückt als politische Kraft verortet. Also für eine Welt zu schreiben, in denen es die Menschen, die von Armut und Ausgrenzung betroffen sind, objektiv besser haben, weil sie egalitär ist.*