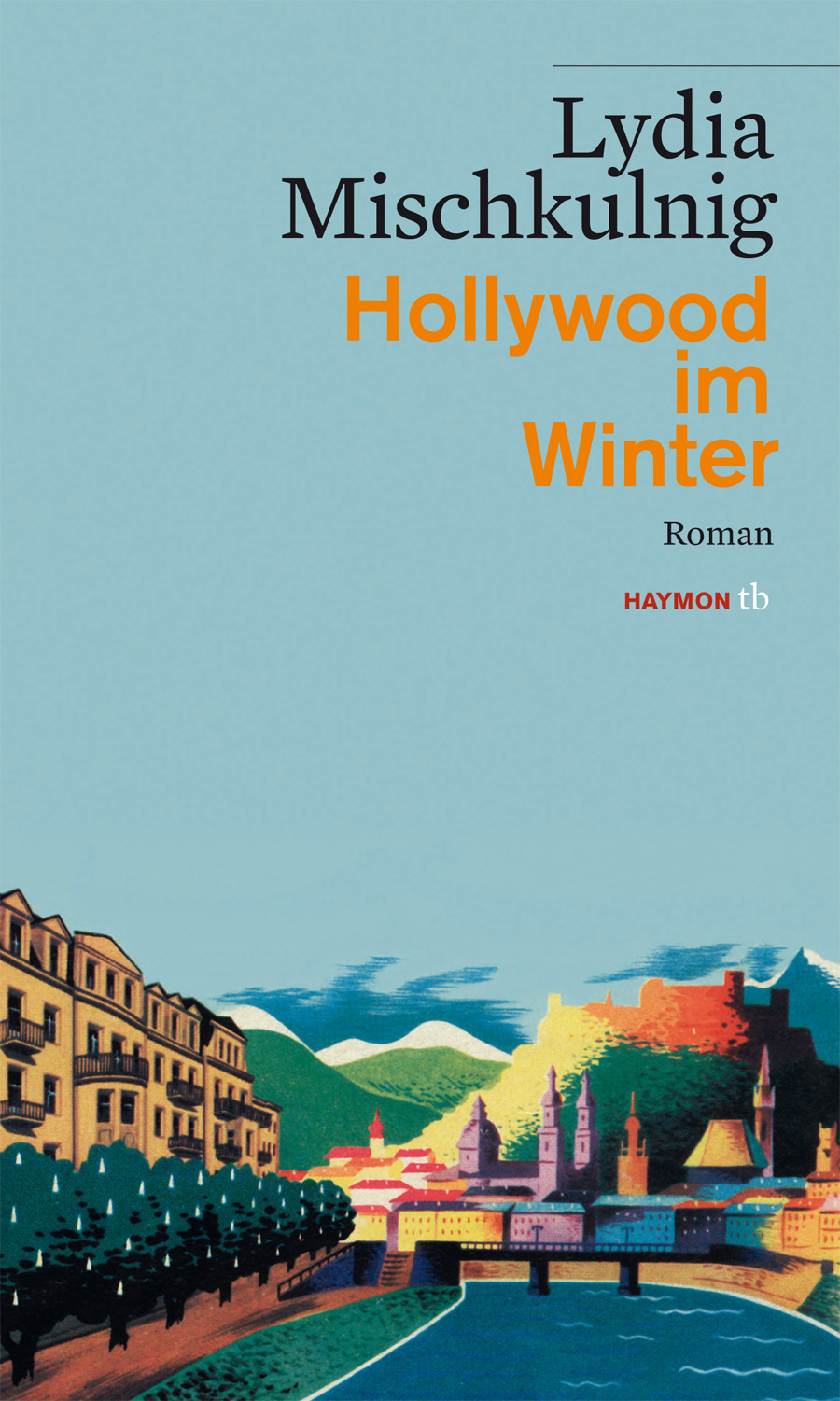Lydia Mischkulnig im Leserinnengespräch zu ihrem neuen Roman „Die Richterin“
Du hörst davon in den Medien, kennst vielleicht jemanden, der persönlich davon betroffen ist, oder bist es sogar selbst: In unseren Gerichtssälen wird darüber entschieden, ob Menschen im Land, in dem sie Zuflucht und Schutz suchen, bleiben dürfen – oder ob sie es verlassen müssen. Doch wie kommen diese Urteile zustande? Dieser Frage geht Lydia Mischkulnig mit psychologischem Tiefgang in ihrem neuen Roman „Die Richterin“ nach: Mit ihr tauchen wir in das Leben von Gabrielle ein, einer Asylrichterin – und damit in einen Berufsalltag, der uns sonst verschlossen bleibt.

Lydia Mischkulnig ist eine sprachmächtige Beobachterin. – Foto: Margit Marnul
Im Gespräch mit ihrer Leserin Heidi erzählt die Autorin von der Recherche für den Roman, von langen Stunden im Gerichtssaal, von ihren Gesprächen mit Betroffenen, von Afghanistan und blinden Flecken.
Mich würde sehr interessieren, wie Sie für diesen Roman recherchiert haben.
Das Thema Asyl, Flucht und Exil begleitet mich literarisch schon seit der Lektüre von Primo Levis „Ist das ein Mensch?“ und von Jean Amérys „Jenseits von Schuld und Sühne“, dann seit den frühen Neunzigerjahren und seit Ceauşescus Hinrichtung, als nach dem Regimewechsel rumänische Kinder zu Gast in der Schule waren, die meine Mutter damals führte. Dann folgten schon die Sezessionskriege in Jugoslawien und der Völkermord in Ruanda und im Iran, die Irakkriege und der afghanische Krieg, als die UdSSR eingriff, und schließlich die USA den Angriff auf das World Trade Center und den neoliberalistischen Brutalkapitalismus rächten. Irgendwann war mir klar: Das hört nicht auf – Flucht ist immer. Und nun gibt es auch vermehrt Fluchtgründe wegen des Klimawandels. So geriet ich mehr und mehr in die Thematik und schrieb Portraits, Aufsätze oder sogar Gedichte zur Existenz unter diesen grauenhaften Aussetzungen.
Das ist sozusagen Recherche, die man als LeserIn und StaatsbürgerIn des Alltags betreibt, ohne dass ich es richtig plane. Hinzu kommt dann das Interesse für Recht und die Sprache der Rechtsprechung und die philosophische Frage nach der Gerechtigkeit. Was bedeuten innerer Friede und Friede? Wie hängen die Begriffe zusammen?
Als dann 2015 die Flüchtlinge aus Syrien nach Europa kamen, war mir klar: Ich möchte auch wissen, was es heißt, im Asylwesen mitgestalten zu können. Wer sind all die AkteurInnen? Und schließlich interessierte mich der Gerichtssaal mit seiner interessierten Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit war ich selbst, in diese Rolle konnte ich mich begeben. Ich saß viele Monate dort und konnte Gespräche führen, sowohl mit HelferInnen und RechtsberaterInnen als auch mit den RichterInnen, ReferentInnen und Betroffenen.
Ich wechselte meine Perspektiven und irgendwann war mir klar, wie kompliziert die Lage ist und wie menschlich. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Bleiben in Sicherheit. Aber was geschieht mit denen, die Sicherheit nicht einmal begreifen, sondern bedrohen? Jeder Fall ist speziell. Das erfuhr ich auf nationaler und internationaler Ebene. Es geht immer um das Individuum – und damit geht es um die Gesellschaft in ihrer Rechtskultur. Und immer ist dies zu diskutieren. Das verstehe ich unter einem demokratischen Prozess: Er ist nie zu Ende.
Wie erging es Ihnen mit juristischen Dokumenten, z. B. mit Ablehnungsbescheiden? Meines Wissens sind die ja sehr umfassend.
Ich habe mich vor allem durch die Länderdokumentationen durchgearbeitet. Bescheide, Erkenntnisse gelesen, Protokolle studiert und vieles, sehr vieles ist öffentlich zugänglich und man findet sogar Material im Internet. Es gibt auch Rechtsliteratur zum Fachlichen, diese habe ich in vielen Gesprächen erörtert und kundige ExpertInnen in Diskussionen befragt. Es war mir total wichtig, zu verstehen, was diese nüchterne, distanzierte Sprache bedeutet. Und das geht nur über das Gespräch und die Einbeziehung von Befindlichkeit und Einstellung zum Thema, zu einem Gesetzestext. Ich habe gelernt, dass Recht gelebt werden muss. Und die Frage ist: Wie? Deshalb kann keine Maschine je eine menschlich-richterliche Instanz ersetzen. Es ist ungeheuerlich, einen negativen Bescheid zu lesen. Es ist auch ungeheuerlich, einen positiven zu lesen. Das Bewusstsein darüber, dass es sich immer um ein menschliches Schicksal handelt, macht einen gewaltigen Druck auf Geist und Psyche.
Inwieweit kennen Sie Kabul selbst?
Ich war nie dort. Ich werde aber eines Tages dort sein. Ich weiß von dieser Stadt seit 1979, seit dem Einmarsch der Sowjets. Und ich kenne die Fotos davon. Unerlässlich sind die anderen Blicke, die ich zum Beispiel von einem der angesagtesten PhilosophInnen und befreundeten Zeitgenossen Fahim Amir einholen durfte. Er stammt aus Kabul und hat dort auch Familie. Auch er hat mir diese kriegsgebeutelte Stadt in vielen Gesprächen näherbringen können. Und ich kenne Leute des Internationalen Roten Kreuzes, die dort vor Ort gelebt haben. Sie berichteten mir von ihren Eindrücken und Kenntnissen. Ich kenne es nur aus Erzählungen, und meine Frage für den Roman war daher: Wie stellen sich eigentlich AsylrichterInnen die Stadt Kabul vor? Sie hören ja dauernd davon. Und wie stelle ich sie mir vor?
Die Beziehung von Gabrielle zu ihrem Bruder hat mich beim Lesen überrascht: Sein Verhalten hat Gabrielles Leben oft nachhaltig negativ beeinflusst. Welche Rolle spielt er für Gabrielle?
Der Bruder ist eine Herausforderung für die Heldin, für ihre Einschätzungsfähigkeit. Ist er so gewesen, wie sie sich an ihn erinnert? Oder färbt sich ihr Bild aufgrund ihrer Ressentiments und gestaltet einen Sündenbock? Nach allem, was mit ihm geschah und durch ihn geschah, fragt sie sich nie, wieso sie ein Manuskript zu seiner Dissertation findet. Es taucht wie nebenbei auf und ist aber doch das Indiz auf eine Lebenslinie, die sie ihrem Bruder nicht im Geringsten zumessen konnte. Was hat es damit auf sich? Sie übersieht ein wesentliches Detail! Diese Frage stellt sich Gabrielle nicht. Man fragt sich für sie: Wieso? Was bedeutet dieses „Übersehen“ für die Einschätzung der Richterin? Welchen Charakter hat sie? Und letztlich stellt sich uns die Frage, was sollen wir von dieser Richterin und unserem eigenen Einschätzungsvermögen halten? Details entgehen immer jeder Beobachtung, niemand ist unfehlbar und verfügt über ein Gesamtbild. Das erscheint mir wichtig: Ambiguitätstoleranz zu fördern.
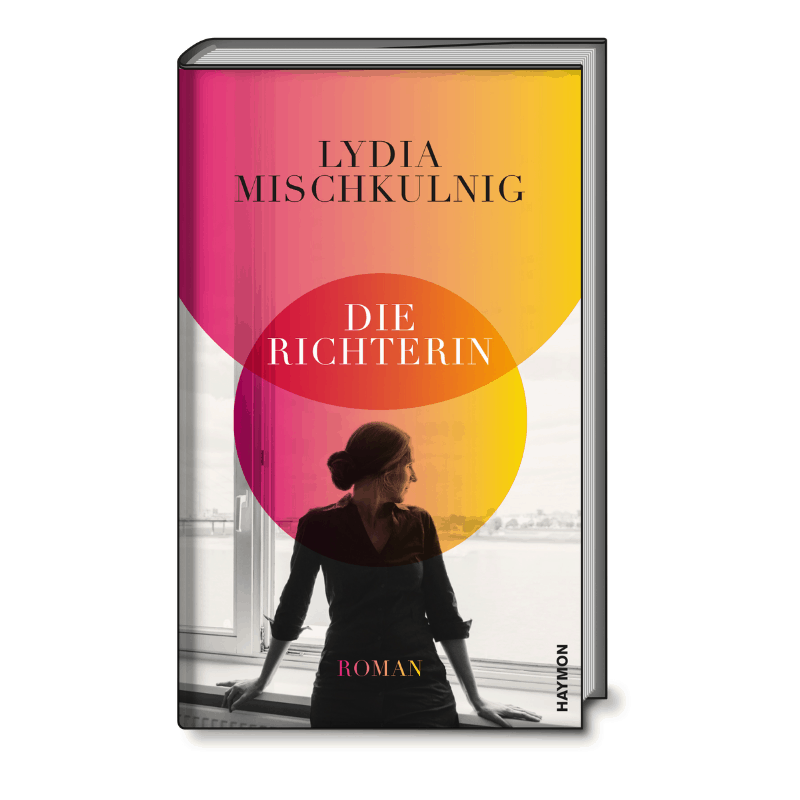
Richterin über das Schicksal: Über den Taumel einer Asylrichterin zwischen Macht und Ohnmacht, über die Tragweite ihrer Entscheidungen und den Weg dort hin erzählt Lydia Mischkulnig in „Die Richterin“. Schonungslos spürt sie die Sprünge auf, die unseren fragilen, vermeintlich klaren Blick auf die Welt durchziehen. Ein feinnerviger und sprachmächtiger Roman mit unterschwelligem Sog. – Hier geht’s zum Buch.