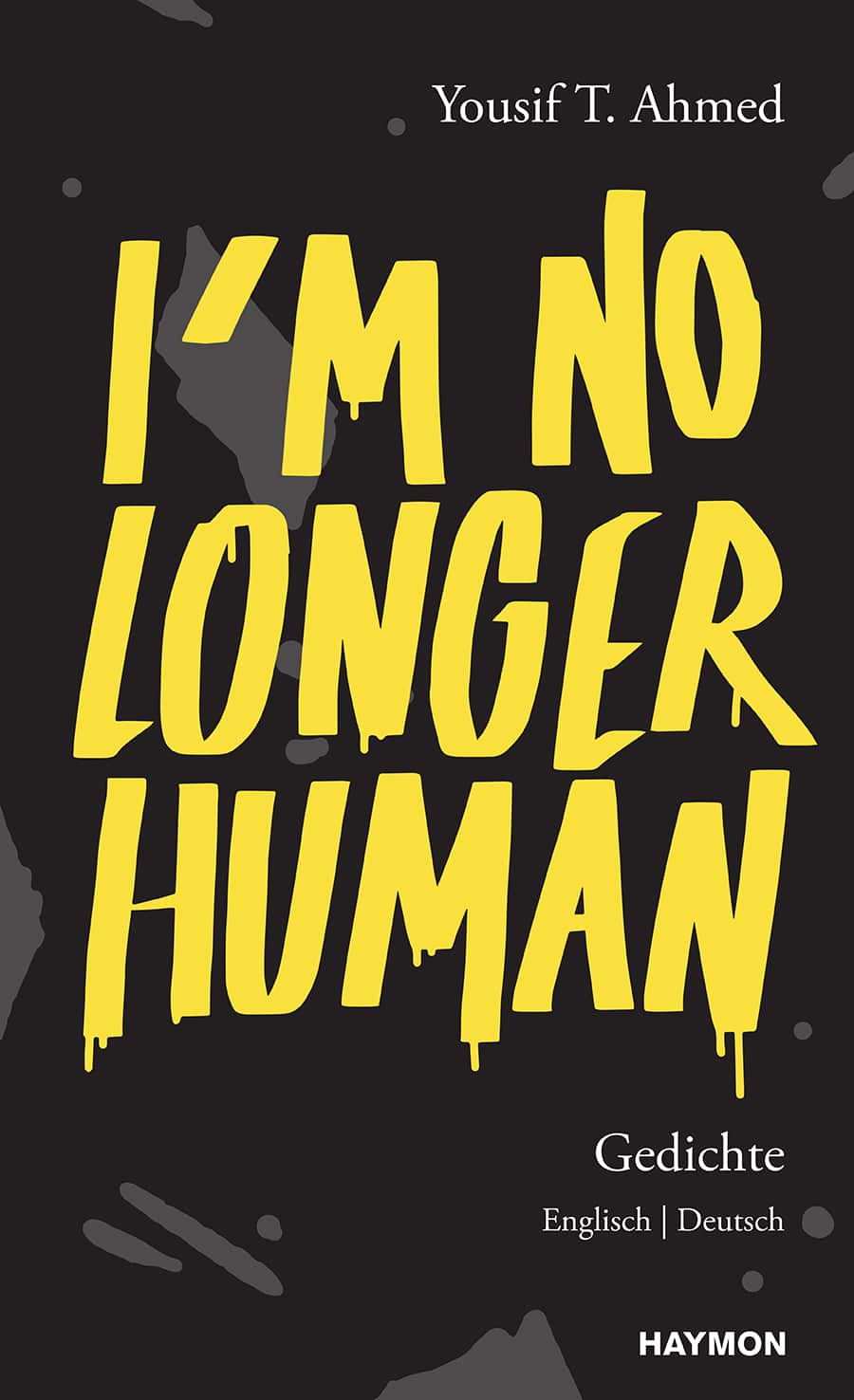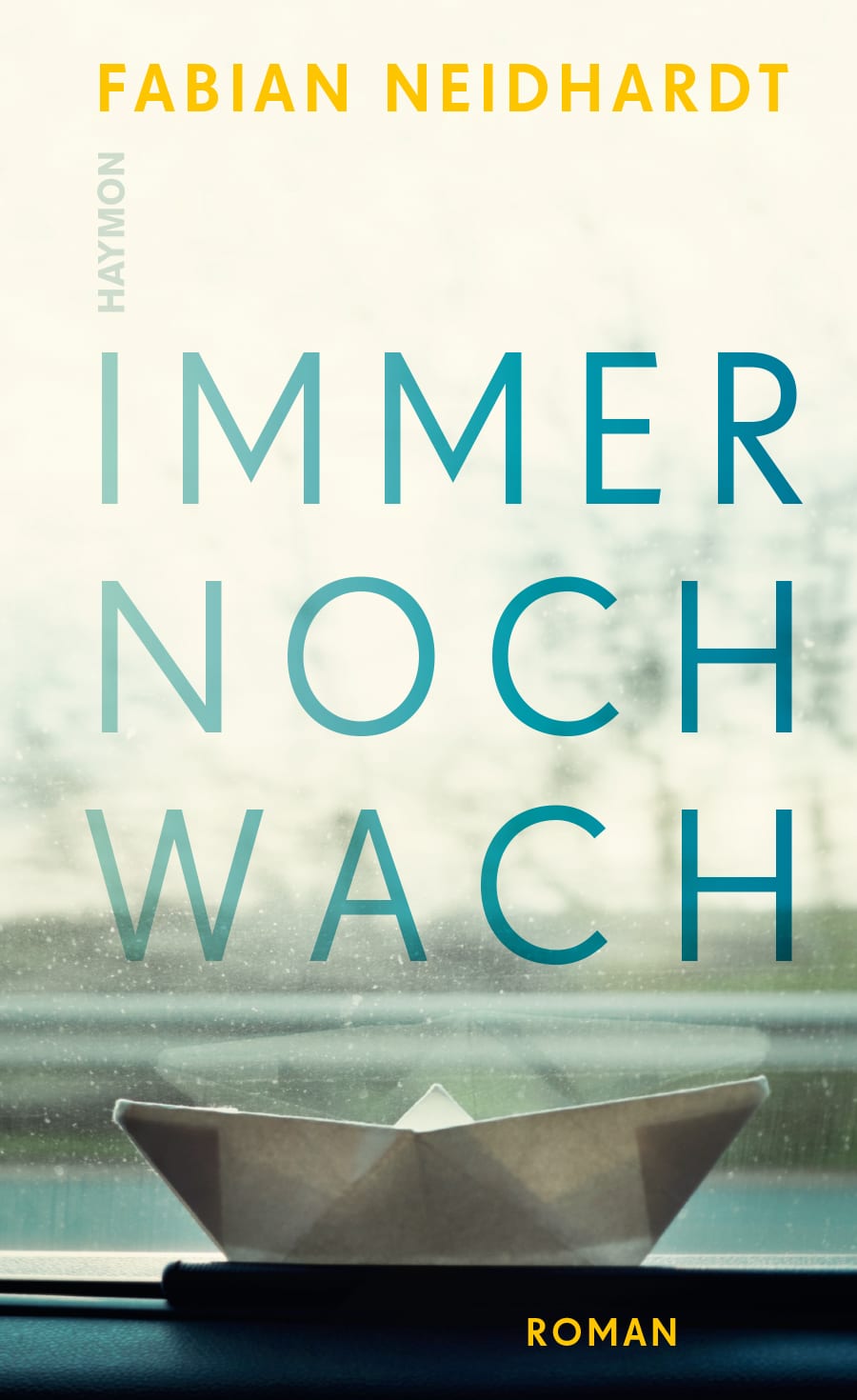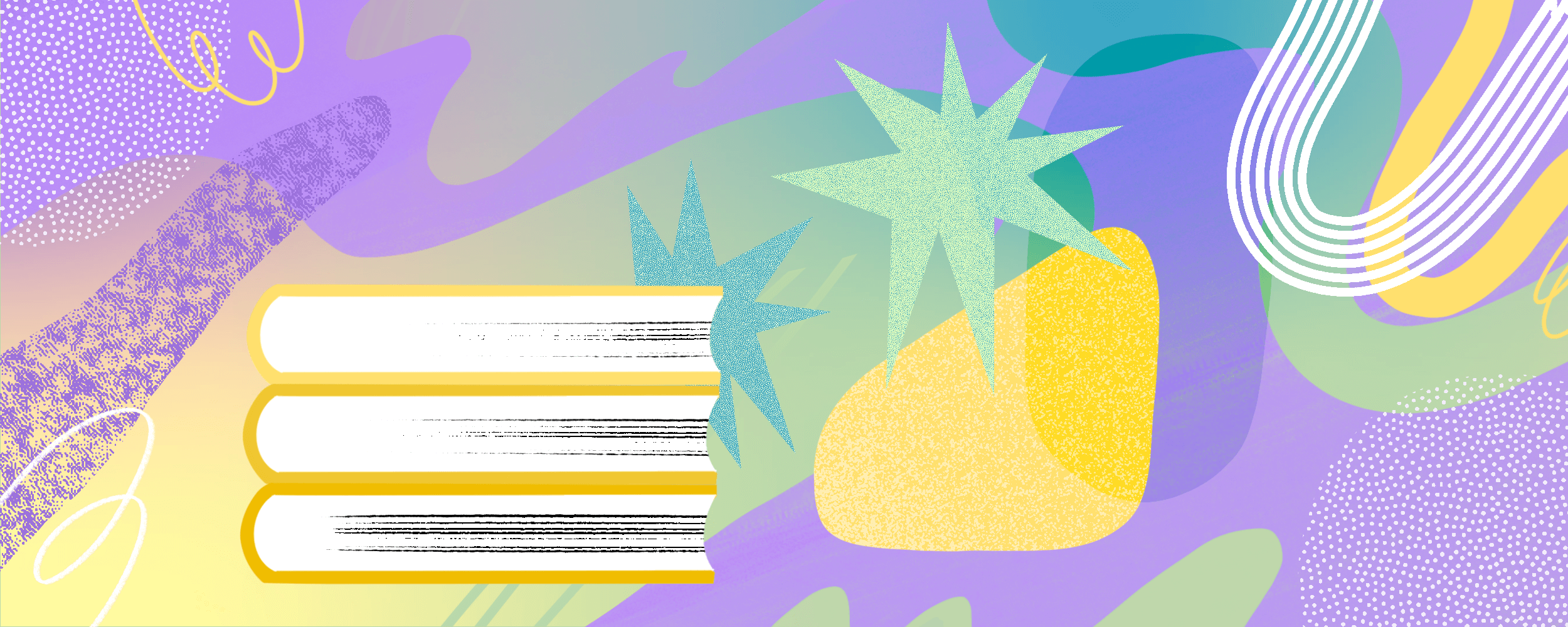
Ist Inklusion in der Leistungsgesellschaft überhaupt möglich? – Über die psychischen Auswirkungen von Ableismus und verinnerlichter Abwertung. Ein Beitrag von Charlotte Zach
Wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen mit Behinderung über Jahrhunderte und Jahrtausende ausgegrenzt, versteckt und tabuisiert hat, weil sie als System auf der einheitlichen Funktionsfähigkeit der Menschen, die sie ausmachen, basiert. Historisch war lange Zeit wenig Raum für eingeschränkte (physische) Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen. Doch unsere Gesellschaft hat sich verändert. Aufgabenbereiche von Menschen haben sich immer weiter spezialisiert und wir haben ein umfassendes Sozialsystem aufgestellt. Die Modernität einer Gesellschaft lässt sich sehr gut an ihrer Inklusion messen. Doch lassen sich moderne Leistungsgesellschaft und Inklusion als Paradigmen miteinander vereinen? Und was macht es mit dem Individuum, als nicht leistungsfähig zu gelten und in einer Leistungsgesellschaft zu leben – unabhängig davon, ob diese Annahme stimmt?

Charlotte Zach studierte Psychologie, arbeitet in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, hat ihre Peer-Counseling-Ausbildung abgeschlossen und organisiert als Rollstuhlfahrerin ihren Alltag selbstständig mit Assistenz. Gerade sucht sie noch oder mal wieder ihren Weg in der Balance zwischen Aktivismus für die eigene Betroffenheit und dem Anspruch, sich dabei nicht selbst auf die Behinderung zu reduzieren. Sie liebt das geschriebene Wort in allen Varianten, ob Essay, Gedicht, Liedtext oder Geschichte, und außerdem, die ganz großen Fragen in den kleinen Dingen des Alltags zu finden. In ihrem Newsletter Berührungspunkte schreibt sie über Körper, Sexualität und Behinderung. – Foto: Privat
Als junge Frau mit Behinderung fallen mir zahlreiche Situationen und Konflikte ein, die ich im Nachhinein als Infragestellung der Wertigkeit von mir als Person deute. So hatte ich zum Beispiel schon als kleines Kind häufig Angst, alleine zu bleiben, aus Sorge, meine Mutter könnte beschließen, sie wolle nicht zurückkommen, weil es ihr zu anstrengend und aufwendig sei, ein Kind mit Behinderung zu haben. Auch in der Schule hatte ich stets das Bedürfnis, mich besonders hervorzutun und unter Beweis zu stellen, dass ich umfassende Fähigkeiten habe, um auszugleichen, dass mir an anderer Stelle Fähigkeiten fehlen. Ich musste mich aktiv schützen gegen Annahmen, ich sei faul, dumm oder würde meine Behinderung zu meinem Vorteil ausnutzen. Und dieser Schutz wurde mir von meinen Mitschüler*innen als Arroganz ausgelegt. Jungen Menschen mit Behinderung ist sehr bewusst, dass sie in einer Leistungsgesellschaft leben und dass diese Leistungsgesellschaft immer davon ausgeht, dass du, als Mensch mit Behinderung, weniger leisten kannst.
Der Wert eines Menschen in unserer Gesellschaft wird durch seine Produktivität gemessen. Durch seine finanzielle und sexuelle Produktivität. Menschen mit Behinderung werden beide Bereiche gerne verwehrt und oft wird dieser Nicht-Zugang als gegeben dargestellt und nicht als soziales Konstrukt, das durch institutionelle und strukturelle Barrieren zusätzlich zu einer interpersonellen Diskriminierung aufrechterhalten wird. Ständig ist man etwas schuldig und Bittsteller*in. Und Systeme, die Menschen in die Armut drängen, indem sie für weit unter dem Mindestlohn arbeiten, um ihnen dann Grundsicherung zu zahlen – wie es in Werkstätten für Menschen mit Behinderung der Fall ist – oder Einkommensgrenzen für Assistenznehmer*innen manifestieren diese Problematik auf institutioneller Ebene.
Ich habe mich als junger Mensch mit Behinderung lange Zeit nicht getraut, arbeiten zu gehen. Einen Nebenjob neben Schule oder Studium zu beginnen. Mein Vater hat mir immer wieder vorgeschlagen, mich als Nachhilfelehrerin zu bewerben – aber ich konnte nicht!
Dabei wäre dies organisatorisch kein Problem gewesen. Doch ich hatte große Angst, als Arbeitskraft nicht für voll genommen zu werden. Ich hatte Angst vor den ableistischen Annahmen der Kund*innen und davor, dass diese Annahmen bei mir auf fruchtbaren Boden fielen. Ich wollte nicht wissen, wie ich reagieren würde, wenn mich jemand fragt, ob ich auch kognitiv behindert wäre. Oder wenn einfach niemand zu meiner Nachhilfe käme wegen solcher Fragen im Hinterkopf. Im Laufe meines Studiums musste ich mich dann für ein Praktikum bewerben und stand somit vor der Frage: Erwähne ich meine Behinderung in der Bewerbung? Wenn ja, wie? Als kleine Randnotiz über den Bedarf von Barrierefreiheit? Ich habe mich am Ende dazu entschieden, sie als prägenden Teil meiner Biografie zu benennen und sie als Ressource und Stärke in der Beratung zu verkaufen. In einer Welt, in der Behinderung fast ausschließlich als defizitär und defekt angesehen wird, war das schon ein sehr emanzipatorischer Schritt von klein-Lotte, aber letztendlich ist hinter dem Schritt nach wie vor der Gedanke verborgen, etwas ausgleichen, etwas wettmachen zu müssen. „Es ist mit mir kompliziert und ich versuche jetzt, dich davon zu überzeugen, dass ich es wert bin.“
Dieser Kosten-Nutzen-Blickwinkel lässt sich beim Thema Arbeitsmarkt noch gut nachvollziehen, doch diese Perspektive zieht sich in alle Lebensbereiche von Menschen mit Behinderung. Ich wollte als junger Mensch keine Kontakte zu anderen Menschen mit Behinderungen haben und habe mich zum Beispiel strikt geweigert, auf eine Ferienfreizeit mit Pflegebetreuung zu fahren oder Ähnliches. Der Grund hierfür war, dass ich gemerkt habe, wie sehr die Gesellschaft Menschen mit Behinderung als homogene Masse wahrnimmt, wie wenig sie differenziert zwischen verschiedenen Behinderungsformen. Und so wollte ich mit allen Mitteln verhindern, dass ich als Teil dieser Masse gesehen werde – und insbesondere, dass Menschen mir eine kognitive Behinderung unterstellen würden. Heute weiß ich, dass solche Gedanken internalisierter Ableismus sind und darauf zurückzuführen sind, dass ich die diskriminierenden Annahmen über die Wertigkeit von Menschen für mich übernommen habe. Ich wollte so viel Distanz wie möglich zwischen mir und anderen Menschen mit Behinderung schaffen und nahm mir damit lange Zeit die Möglichkeit, mich mit dem Bild von Behinderung auseinanderzusetzen, das die Mehrheitsgesellschaft hat, weil es auch in mir verankert ist. Ich unterschied zwischen guter und schlechter Behinderung.
Je mehr ich mich mit meiner eigenen Perspektive auf Behinderung auseinandersetze, desto deutlicher wird mir der Zusammenhang zu gesamtgesellschaftlichen Fragen: Wie wollen wir als Gemeinschaft zusammenleben? Mit welcher Grundhaltung begegnen wir unseren Mitmenschen im Kollektiv? Was macht den Wert eines Individuums in der Gemeinschaft aus? Wir können das Problem auf zwei Ebenen adressieren: Wir müssen uns einmal auf der konkreten Ebene fragen, welche Barrieren wir abschaffen und welche Reize wir setzen müssen, um die selbsterfüllende Prophezeiung der „unproduktiven“ Menschen mit Behinderung, die sich stets in Abhängigkeit befinden, aufzubrechen? Und im zweiten Schritt müssen wir uns aber auch die Frage stellen, woran wir den Wert eines Menschen in unserer Gesellschaft messen, und ob wir die Möglichkeit sehen, in einem der reichsten Länder der Welt Humanität vor Produktivität zu stellen? Je mehr ich lerne, meine Versuche des Wertausgleiches als solche zu demaskieren, desto deutlicher wird mir, dass sich Leistungsgesellschaft und Inklusion als Ideen vollkommen widersprechen. Und mir wird bewusst, wie viele der Missstände im zwischenmenschlichen Umgang und in der psychischen Gesundheit der Menschen darauf beruhen, dass sie versuchen, ihre internalisierte Minderwertigkeit für die Gesellschaft wieder wettzumachen. Ich kenne eine ganze Reihe von jungen Menschen mit Behinderung, die sich in einer schweren Phase ihres Lebens nicht getraut haben, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie nicht dem Stereotyp des depressiven behinderten Menschen, dem die Lebenslust verloren ging, entsprechen wollten.
Es geht nicht nur darum, zu verstehen, dass Chancengleichheit eine Illusion ist und dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Startbedingungen in den gesellschaftlichen Prozess eintauchen und wir versuchen müssen, diese Chancen etwas anzugleichen. Sondern es geht darum zu verstehen, dass solange wir in einem System leben, das die Wertigkeit von Menschen anhand von Produktivität und Fertigkeiten bemisst, bestimmte Menschen den Gedanken dieser Minderwertigkeit so tief verinnerlicht haben, dass sie in allen Lebenslagen mit all ihren Ressourcen damit beschäftigt sein werden, diese Minderwertigkeit auszugleichen. Sie alle nutzen viel ihrer Energie, um mögliche scheinbare Überlappungen mit Stereotypen so weit wie möglich zu kaschieren. Dieser psychologische Effekt von Minderheitsmerkmalen allgemein und dem Merkmal Behinderung als Paradebeispiel der Minderwertigkeit insbesondere, wird von der Mehrheitsgesellschaft sehr unterschätzt, wenn er überhaupt gesehen wird.