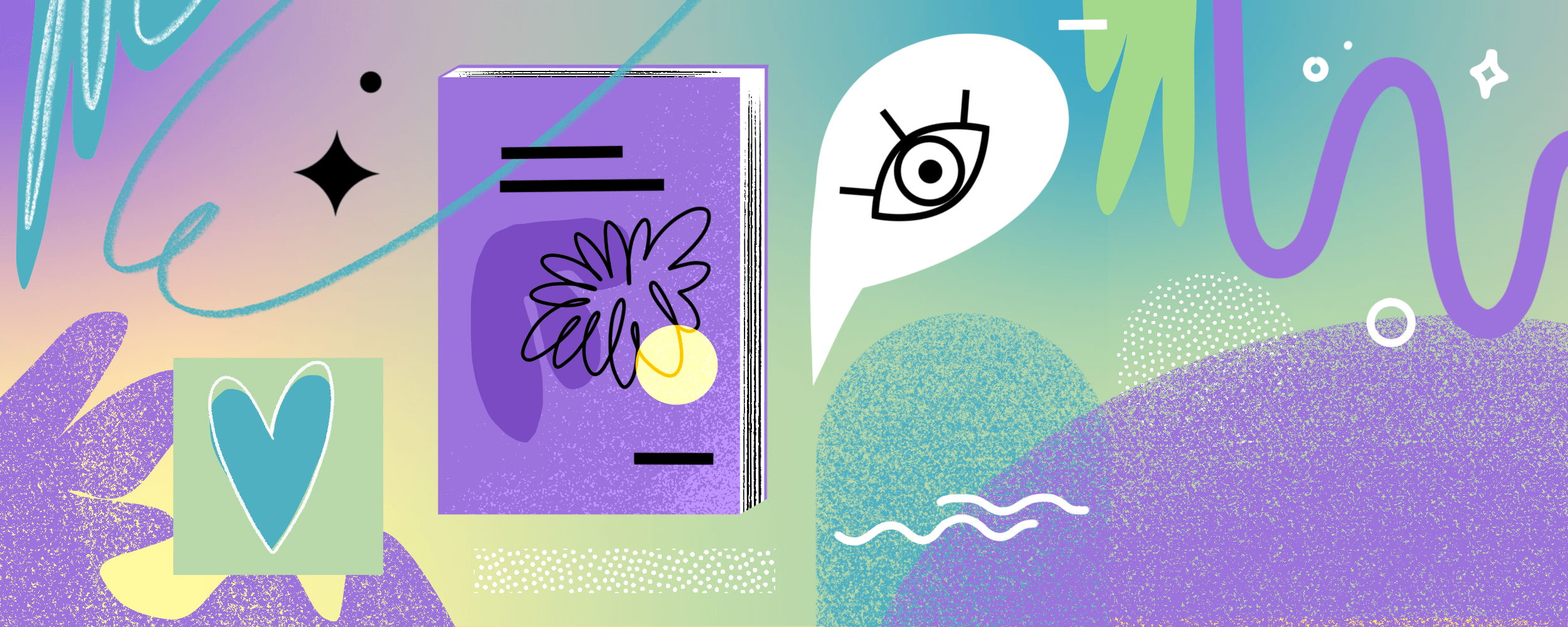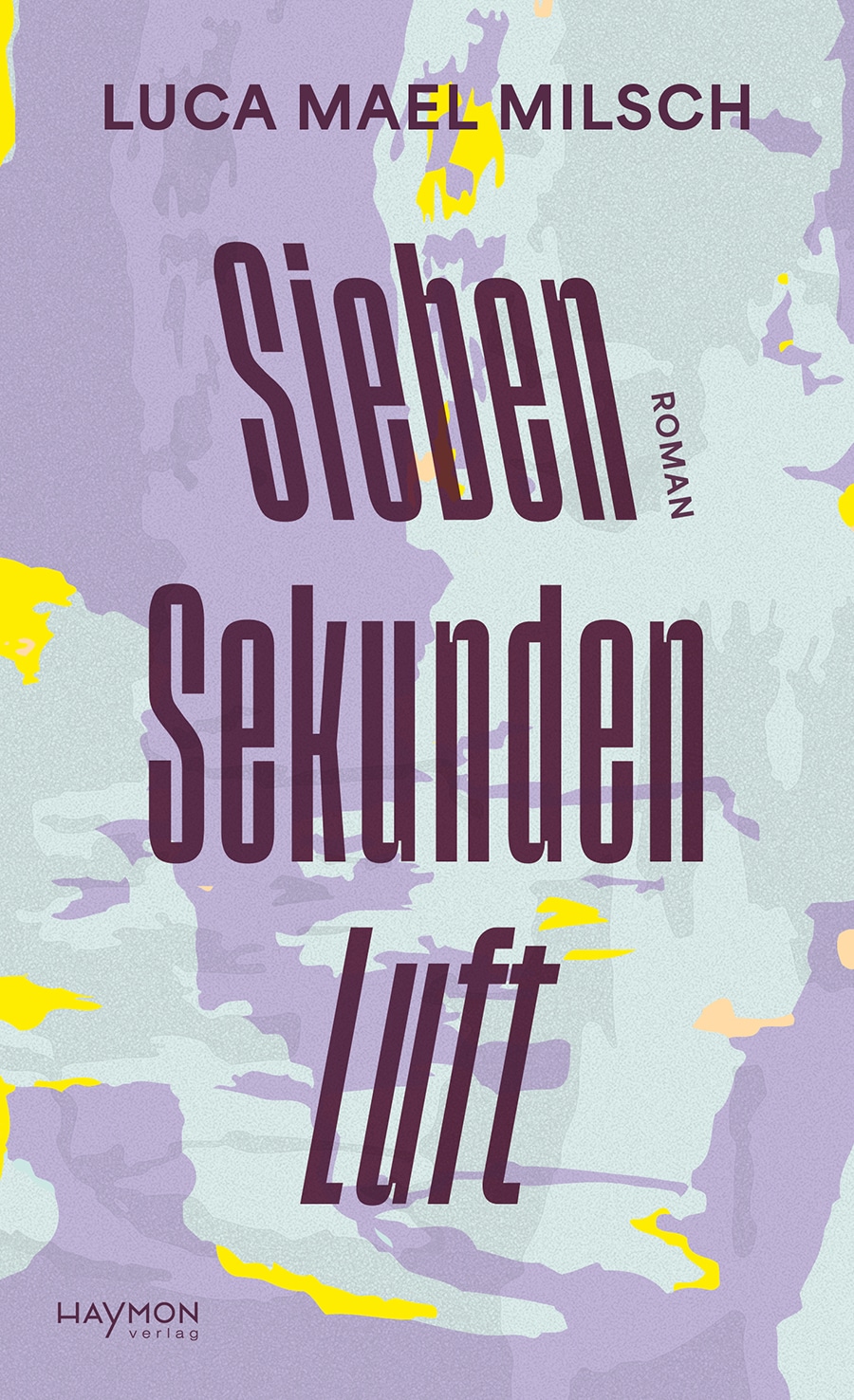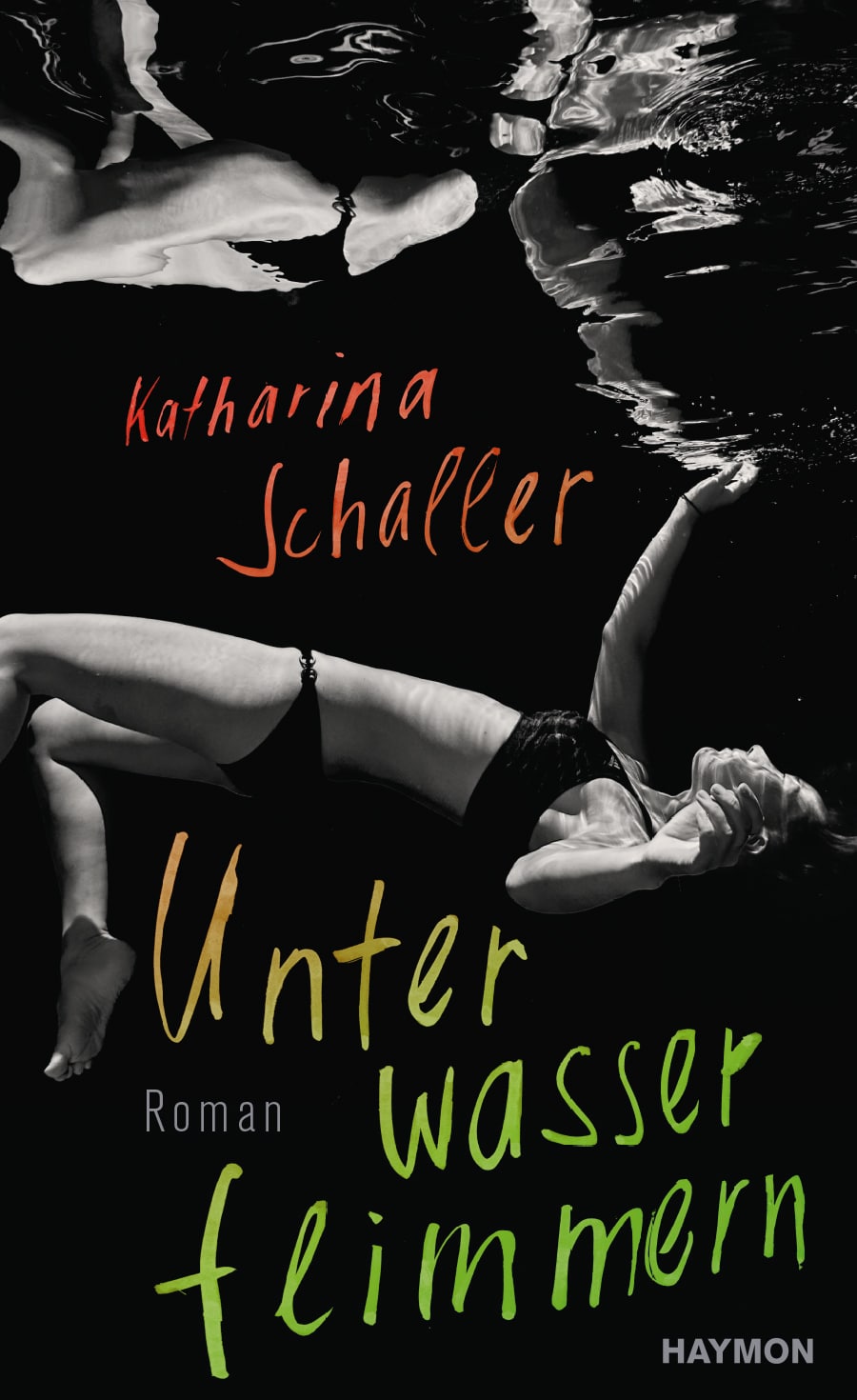Die Vorstellung davon, wie unsere Gesellschaft funktionieren sollte und wie Menschen in dieser Gesellschaft zu sein haben, basiert auf – mehr oder weniger stabilen – Konstrukten, Rollenbildern, ästhetischen Vorstellungen, Verhaltensnormen … Das alles wird uns in die sprichwörtliche Wiege gelegt, bevor wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, uns dagegen zu wehren. Was bräuchte es, um unter weniger einengenden Bedingungen aufwachsen und leben zu können?
Im Roman habe ich mit religiösen Glaubenssätzen gearbeitet, um dies zu unterstreichen: Der Gottesglaube, der sich in Sprache und Denken und auch im Namen Selahs eingeschrieben hat, scheint der Figur gar nicht so bewusst. Ich glaube, vehement verteidigte „das haben wir schon immer so gemacht“ oder „so ist es eben“ sind Entscheidungen, aber als solche unkenntlich gemacht. Um dagegen angehen zu können, muss auf unterschiedlichen Ebenen etwas passieren. Es braucht Identifikationsmöglichkeiten, sicherere Räume, solidarische Kämpfe und eine Bereitschaft, sich von den bestehenden Normen zu lösen.
Selah befindet sich ja in jedem Kapitel auf der Schwelle zu etwas Neuem. Da sind auch Vorbilder und Hilfen notwendig, die eben nicht unbedingt durch das gewohnte Umfeld geleistet werden können. Und gerade für queere Lebensrealitäten braucht es auch Fantasie, sich ein Leben über die bestehenden Normen hinaus vorzustellen. Fantasie, die Selah ja durchaus hat.
Du bist selbst Lektor*in, Kurator*in, Moderator*in und natürlich Autor*in. Wie siehst du in deiner Arbeit die Möglichkeit, vorherrschende zwanghafte Strukturen in unserer Gesellschaft zu sprengen?
Ich halte es für zentral, sich nicht nur als vereinzeltes Individuum mit persönlichen Problemen zu sehen, sondern sich im Kontext zu betrachten, auch die eigene Verantwortung in der Unterdrückung oder Ausgrenzung anderer zu erkennen. Und diese Verantwortung auf die Straßen, in den eigenen Bezugskreis zu tragen, anstatt in altbekannte und vermeintliche Sicherheit zurückzufallen. Denn es gibt etliche Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die uns vordergründig dafür belohnen, uns anzupassen und still zu sein. Aber um welchen Preis?
Ich denke zum Beispiel viel darüber nach: Wer ist alles anwesend im Kulturbetrieb und wer nicht? Auch darum geht es ja in meinem Roman. Warum sind manche Stimmen sehr laut und präsent, andere werden nicht einmal bedacht? Dorthin zu schauen, unbequeme Gespräche zu führen, und gleichzeitig immer lernbereit zu sein, halte ich für immens wichtig. Ich würde mir auch wünschen, dass in der Kultur mehr Energie in unsichtbare Arbeit fließen würde: Eine solidarische Praxis sollte nichts sein, womit sich profiliert wird und wofür es Applaus oder Profit gibt.