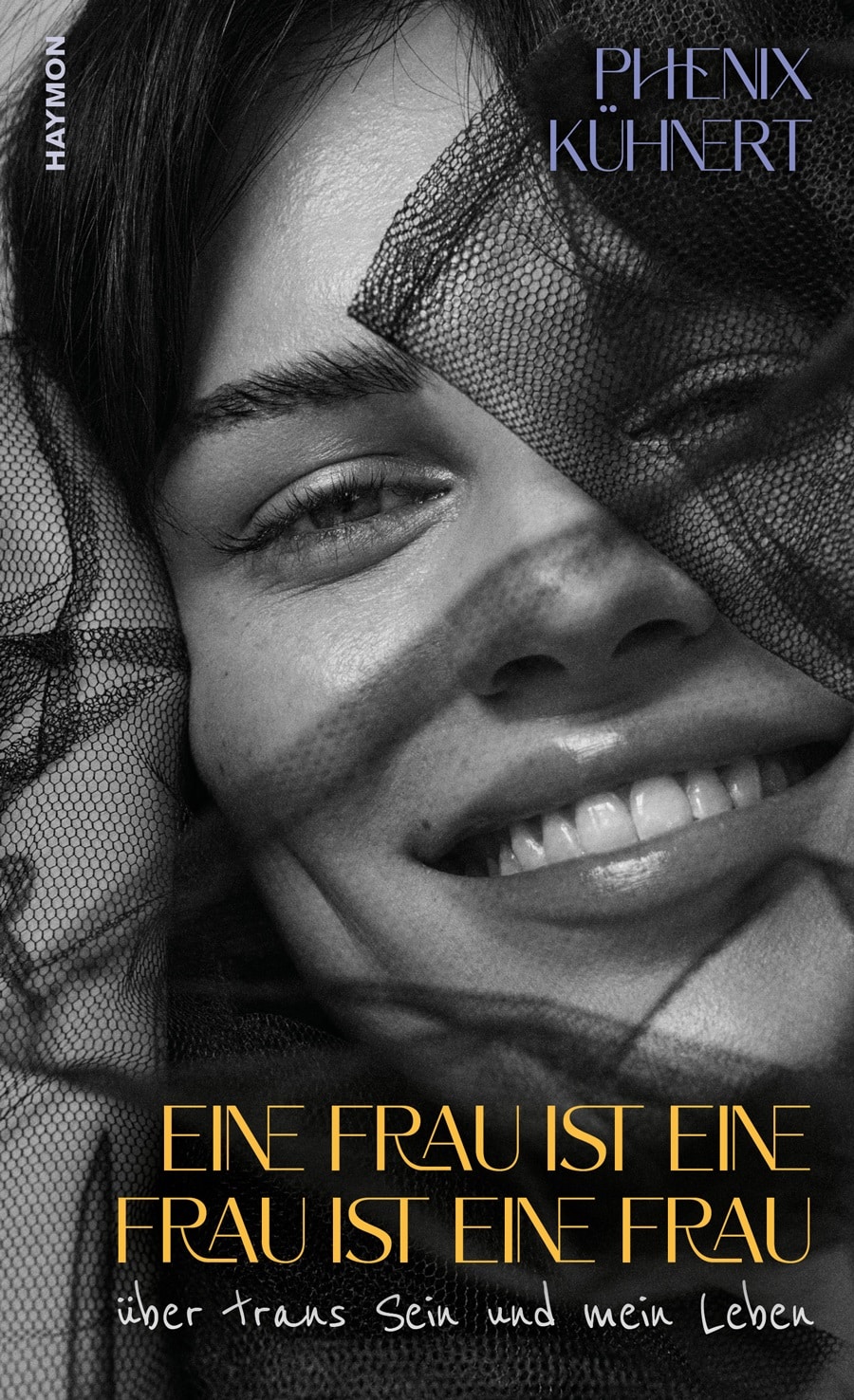„In der Literatur herrschen immer noch deutlich unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen“ – Veronika Schuchter im Interview
Auch die Literatur(branche) braucht nachhaltige, strukturelle Veränderungen und eine Perspektivenerweiterung. Denn: patriarchale Machtstrukturen beeinflussen immer noch was wir lesen und wie darüber gesprochen wird. Wie sich das äußert und auch was wir dagegen tun können haben wir mit Veronika Schuchter besprochen. Sie ist Germanistin, Genderforscherin, Literaturkritikerin und freie Lektorin. Im folgenden Interview gibt sie einen Überblick über die Auswirkungen von Ungleichheit und schiefen Machtverhältnissen im Literaturbetrieb, außerdem spricht sie über Kanonkritik sowie literarische Identitätspolitik.
In deinem Forschungsprojekt „Literaturkritik als Gender-Diskurs“ hast du dich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Kategorie Gender auf die Literaturkritik auswirkt. Herrschen im Literaturbetrieb unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen* bzw. werden Autorinnen und Autoren unterschiedlich bewertet und welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Und was lässt sich hier im Hinblick auf nicht-binäre Autor*innen beobachten?
Es herrschen leider immer noch deutlich unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen, das beginnt beim Verdienst, bei Vorschüssen und es hört damit auf, wie über Autorinnen gesprochen wird. Autoren werden meist zu ihrem Werk befragt, Autorinnen zu ihrer Person, oder wie es ist im Literaturbetrieb als Frau. Es ist wichtig auch darüber zu sprechen, doch das Werk sollte im Mittelpunkt stehen. Hier sind immer noch althergebrachte Rollenmuster am Werk, die oft gar nicht bemerkt werden, aber nur schwer zu überwinden sind. Nicht-binäre Autor*innen werden häufig auf diese Eigenschaft reduziert, das war etwa bei Kim de l’Horizon der Fall. Der Roman „Blutbuch“, der den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, wurde aus der identitätspolitischen Perspektive gelesen, dabei ist er viel mehr als das, etwa ein sehr berührender Text über die Mutter der erzählenden Figur.
In ihrem Roman „Das Licht ist hier viel heller“ thematisierte Mareike Fallwickl bereits 2019 die toxischen patriarchalen Strukturen in der Kulturbranche. Ihre Erzählung handelt von einem Schriftsteller, der sich die traumatische Geschichte einer Frau aneignet und damit sein literarisches Comeback feiert. Der Umgang mit Benjamin von Stuckrad-Barres „Noch wach?“ erinnert die Autorin stark an den Plot ihres Romans: „Wie mein Protagonist Wenger steht Stuckrad-Barre vor allem selbst im Rampenlicht. Beide legen männerdominierte Machtstrukturen offen – und profitieren dabei von ebendiesen Strukturen. Die geschädigten Frauen haben diese Stimme nicht“, führt sie in einem Interview aus. Wie wichtig ist deiner Meinung nach die Perspektive und Biografie der Schreibenden? Inwiefern spielt es für die Vermittlung von feministischen, queeren, antirassistischen und dekolonialen Inhalten bzw. Lebensrealitäten von intersektional diskriminierten Menschen eine Rolle, wer über wen erzählt und welche Realitäten dadurch vermittelt werden?
Das ist eine sehr komplexe Frage, die sich nicht eindeutig beantworten lässt. Durch die identitätspolitische Sensibilisierung der letzten Jahre neigen momentan viele dazu, dass sie literarische Texte durch die Biografie der Autorin/des Autors beglaubigt haben wollen. Das ist verständlich, aber das Schöne an Literatur ist ja, dass man sich in andere hineinversetzen kann. Wenn jeder nur noch über die eigenen Erfahrungen schreibt, würde das die Literatur sehr arm machen. Sonst kann ich genauso gut nur dokumentarische Texte lesen, die auf Fakten basieren. Natürlich gibt es Themen, die mehr Sensibilität erfordern. Wir sollten aber nicht anfangen, Autor*innen vorschreiben zu wollen, welche Perspektiven sie einnehmen dürfen. Wir müssen woanders ansetzen: Ich plädiere stark dafür, wieder stärker auf die Texte einzugehen. Die Lesekompetenz muss gefördert werden, der Literaturbetrieb muss diverser werden und die Literaturkritik bzw. Literaturvermittlung muss der Aufgabe nachkommen, Texte besser einzuordnen. Stuckrad-Barre ist dafür ein gutes Beispiel: Kann ein Mann einen Me-Too-Roman schreiben? Natürlich. Aber das hat Stuckrad-Barre nicht gemacht, sondern er hat einen Schlüsselroman über sich selbst geschrieben. Die Literaturkritik sollte genug Kompetenz haben, um dem Marketing hier nicht auf den Leim zu gehen. Es geht also mehr darum, welche Bücher bekommen Aufmerksamkeit? Dann können die Leser*innen selbst entscheiden, wie wichtig ihnen die Biografien der Autor*innen sind.
Das Patriarchat prägt nicht nur unsere Gesellschaft und unseren Alltag, sondern es beeinflusst auch, was und wie wir lesen. Wo äußern sich deiner Meinung nach patriarchale Machtverhältnisse in der Literaturforschung und -vermittlung am deutlichsten und welche Möglichkeiten siehst du als Wissenschaftlerin und Lehrende, ihnen entgegenzuwirken ?
Patriarchale Verhältnisse äußern sich in der Forschung und Literaturvermittlung vielfältig, besonders deutlich bei den Untersuchungs- bzw. Vermittlungsgegenständen. Wem Aufmerksamkeit gewidmet wird und wie über Literatur von Frauen und andere marginalisierte Gruppen gesprochen wird, ist noch deutlich androzentrisch und patriarchal geprägt, was auch durch die Unterrepräsentation dieser Gruppen in führenden Positionen bedingt ist. Über Literatur von Frauen wird beispielsweise deutlich weniger berichtet, in Interviews fragt man sie dann danach, wie sie sich als Frau im Literaturbetrieb fühlen, statt sich mit ihrem Text zu beschäftigen.
Ein erster, wichtiger Schritt ist es, Bewusstsein zu schaffen. Momentan tut sich da viel. Verlagsprogramme werden unter die Lupe genommen, quantitative Untersuchungen zu Geschlechterverhältnissen in verschiedenen Kulturbereichen erstellt usw. Mir persönlich ist es auf der einen Seite wichtig, Schieflagen zu belegen und herauszufinden, wie sie entstehen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch Vielfalt aufzeigen. Es ist ja nicht so, als hätte es keine Texte von Frauen, Texte in denen LGBTIQ+-Themen zentral sind, gegeben, sie sind nur oft nicht bekannt. Die lasse ich in meine Lehre miteinfließen.
Gibt es bestimmte Kriterien, nach denen du die Leselisten für deine Seminare zusammenstellst? Ist das Bedürfnis von Studierenden spürbar, sich diversitätskritischer mit Lektürelisten auseinanderzusetzen?
Das kommt ganz drauf an, worum es in meinem Seminar geht. Dieses Semester unterrichte ich ein Seminar zu Diversität und Gender, dementsprechend divers sieht die Literaturliste aus. Es geht auch nicht immer darum, von wem ein Text geschrieben wurde, sondern wie wir ihn heute behandeln, ob er noch anschlussfähig ist. Da kann man etwa von Grillparzers „Medea“ einiges lernen, obwohl er ein vermutlich heterosexueller cis-Mann war. Das Bedürfnis von Studierenden nach diverseren Lektürelisten und einem anderen Blick auf die Literatur hat in den letzten Jahren stark zugenommen und viele Lehrende kommen dem auch erfreulicherweise nach. Gerade auch für die Lehramtsstudierenden ist es wichtig, dass sie gut an diese Thematiken herangeführt werden und auch Texte kennenlernen, mit denen sie in der Schule später gut arbeiten können.
Ganz allgemein gefragt: Braucht es überhaupt einen Kanon? Kann der nicht einfach abgeschafft oder verändert werden und wer kann etwas dazu beitragen?
Den Kanon gibt es nicht, es gibt viele Kanones, die nach ganz unterschiedlichen Kriterien aufgebaut sind. Gemeinhin wird damit so etwas wie ein Bildungskanon gemeint – was muss ich gelesen haben? Kanones sind essenziell, weil sie dem zutiefst menschlichen Bedürfnis nach Austausch entspringen. Es ist wichtig, dass wir Texte haben, die viele Menschen kennen, damit wir uns darauf beziehen können, in Diskussion treten können. Wenn niemand weiß, was die anderen lesen, würde das den sozialen Faktor der Literatur empfindlich schwächen. Ich bin zwar beim Lesen allein, aber Literatur geht auf das mündliche Erzählen zurück. Unsere Märchen sind ein Kanon! Unsere ganze Kultur ist ein großer Kanon, wenn man so will. Und jeder kann etwas dazu beitragen, indem er über Texte spricht. Wichtig ist vor allem, dass die großen kanonbildenden Instanzen, die Literaturkritik, die Literaturwissenschaft, das Verlagswesen, diverser werden – dann wird auch „der“ Kanon diverser. Es geht also eher darum, den Kanon positiv aufzuladen und nicht als hierarchische, patriarchal geprägte Liste zu verstehen, sondern als bunten Fundus an Texten, über die wir sprechen können und der gefüllt werden muss mit Texten, die eben nicht mehr in erster Linie privilegierte Gruppen repräsentiert.