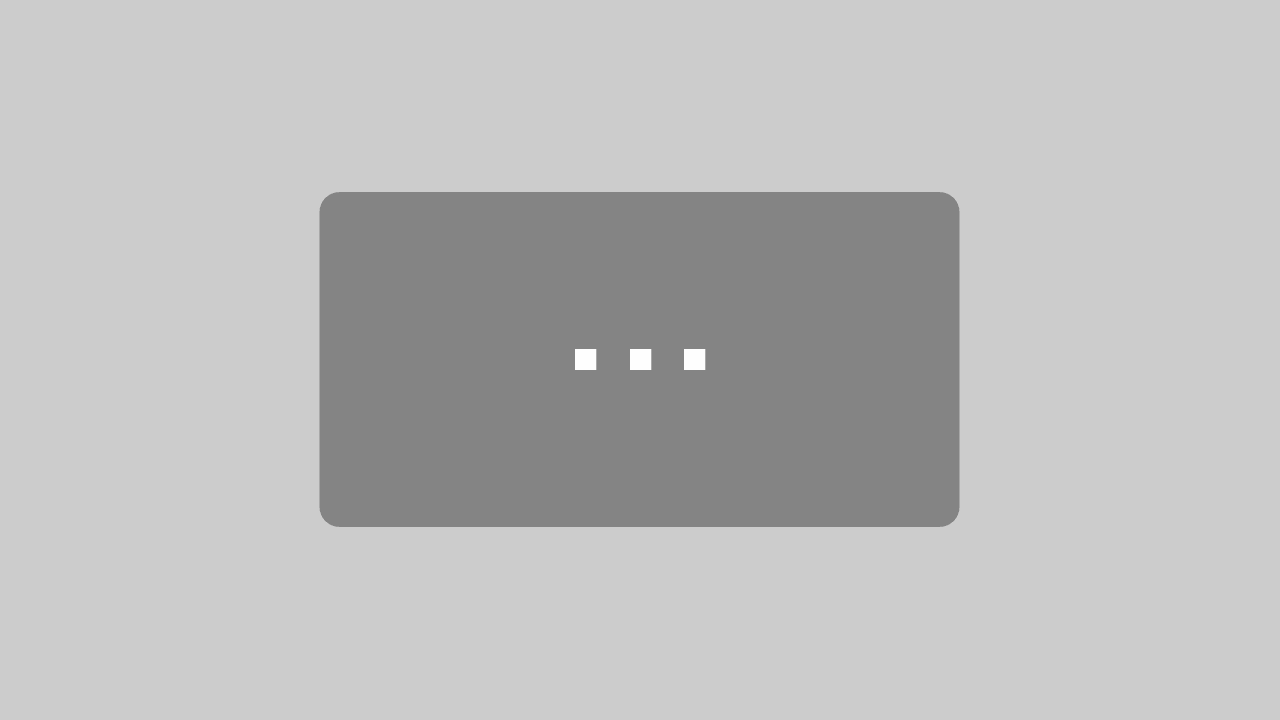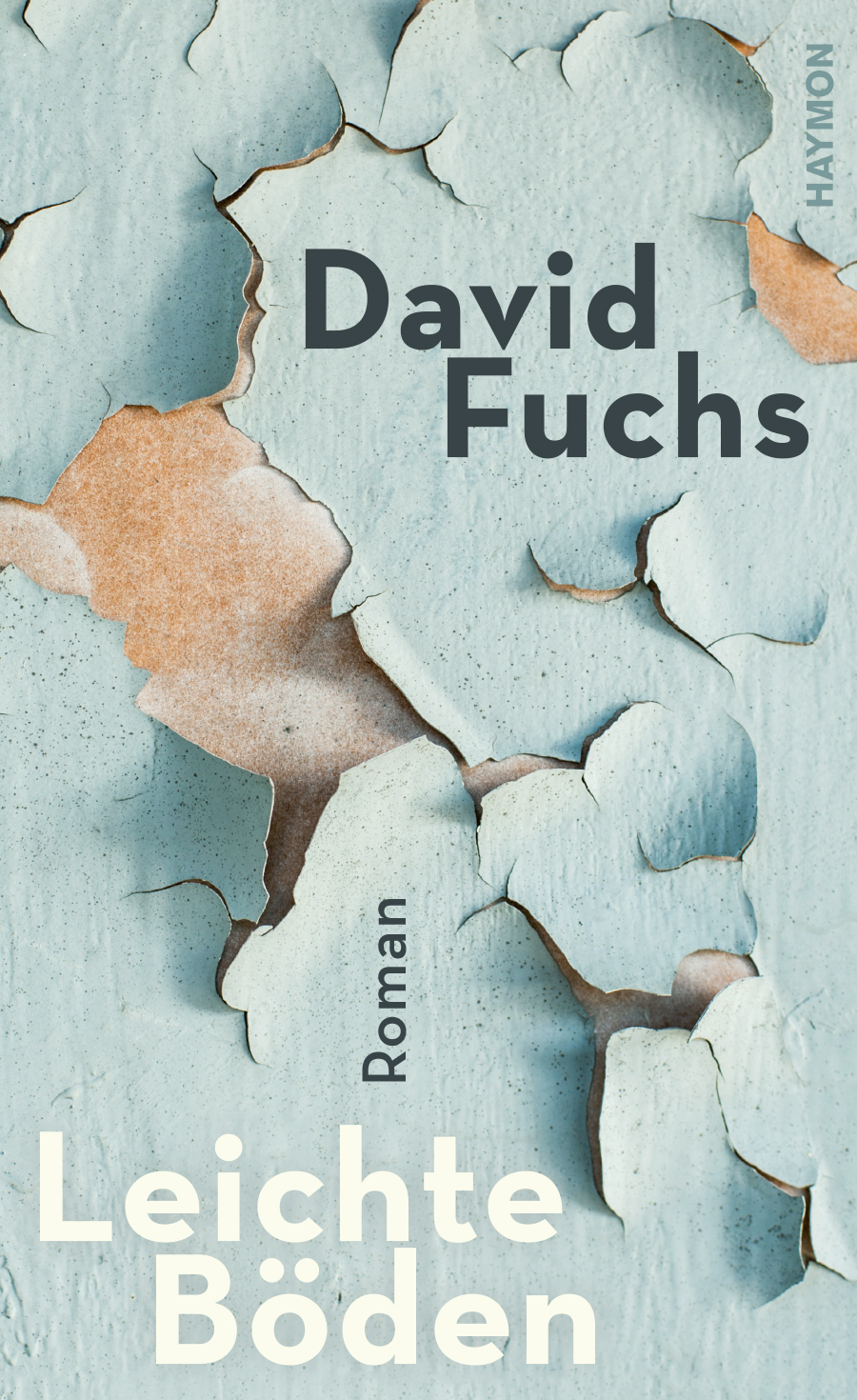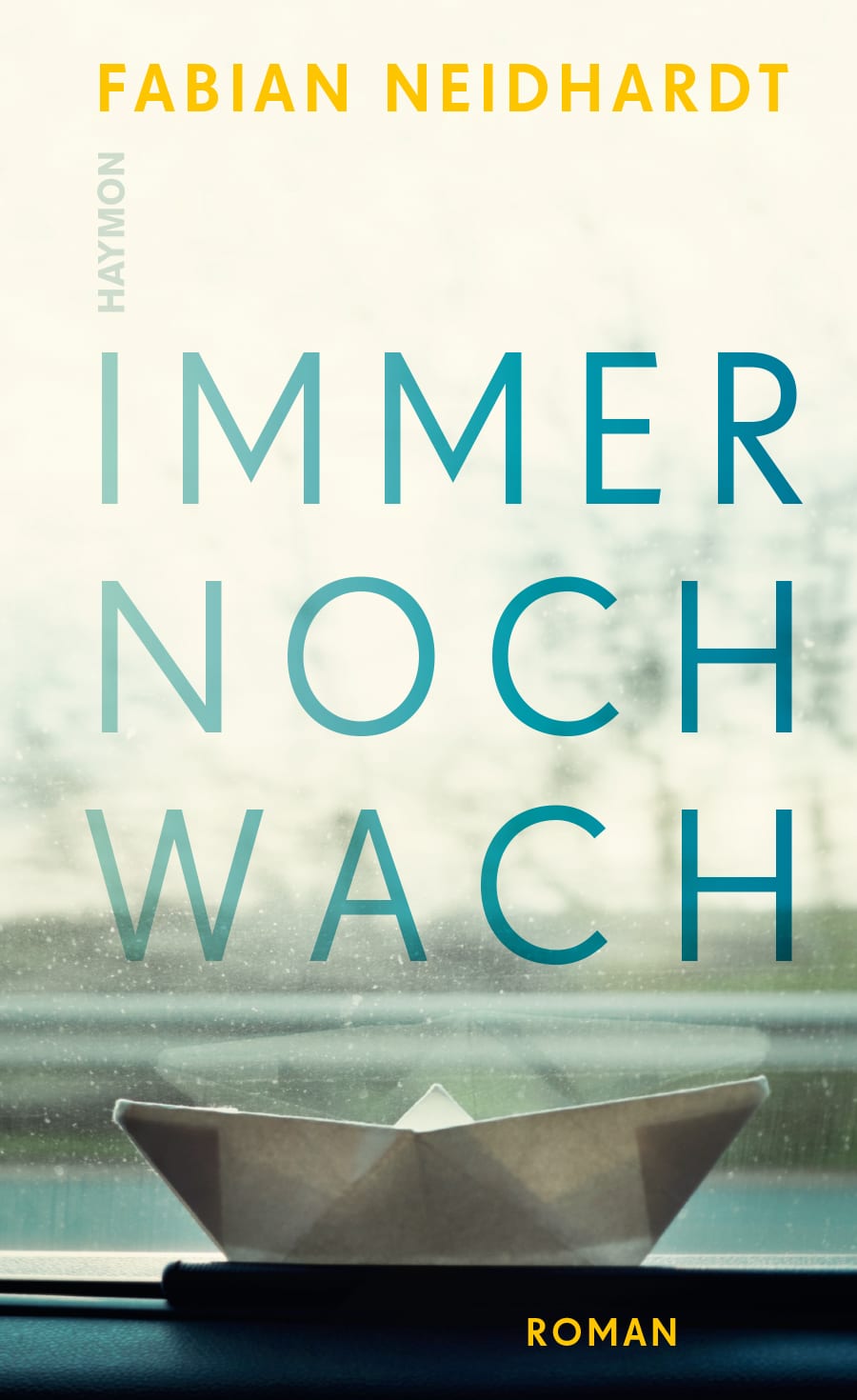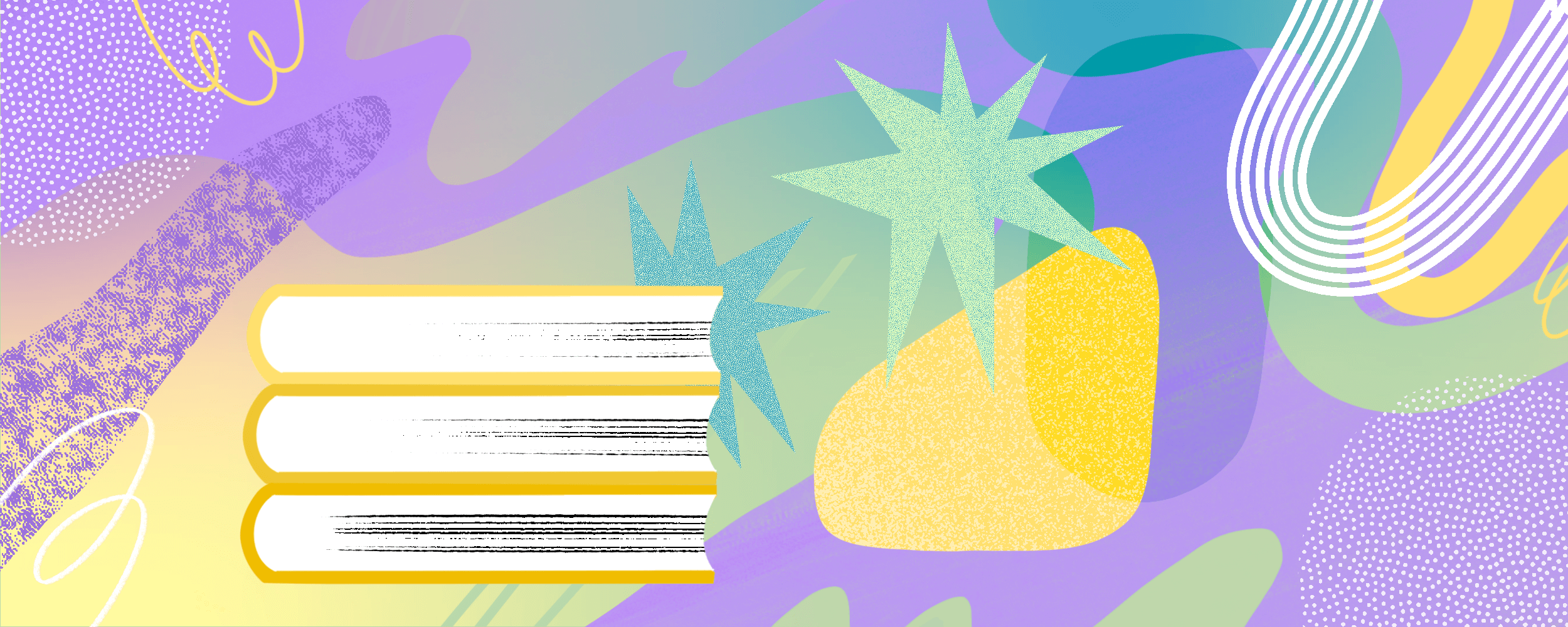
„Im Krankenhaus sind wir Nebenfiguren in der Lebensgeschichte unserer Patient*innen“ – David Fuchs im Interview
Sechs Nächte, vier Wände, zwei Unbekannte, eine Frage: Haben alle Menschen das gleiche Maß an Fürsorge verdient, ganz ungeachtet ihrer Vergangenheit? Dieses moralische Dilemma steht in David Fuchs’ neuem Buch „Zwischen Mauern“ im Mittelpunkt. Wir haben uns mit dem Schriftsteller, der auch als Palliativmediziner in Linz arbeitet, über die Arbeit an seinem dritten Roman, das Krankenhaus als „Bouillonwürfel des Lebens“ und schrullige Kuriositäten des Ärztealltags unterhalten.
In deinem neuen Roman spielt eine sogenannte Sitzwache eine zentrale Rolle. Worin besteht die Aufgabe einer Sitzwache?
Eine Sitzwache ist eine Person, die z.B. in einem Krankenhaus dafür da ist, am Bett eines/einer Kranken – häufig Menschen mit Demenz – zu wachen, d.h. daneben zu sitzen, sich – wenn möglich und gewünscht – mit den Menschen zu unterhalten; vor allem aber, um dafür zu sorgen, dass niemand stürzt oder sich anderweitig in Gefahr bringt.
Warst du selbst schon einmal Sitzwächter?
Nein, war ich nicht, aber ich hätte mir nicht selten gewünscht, dass es eine Sitzwache gegeben hätte. An der Palliativstation haben wir viel Personal, auch Ehrenamtliche, aber z.B. an internistischen oder neurologischen Stationen ist die Betreuung von verwirrten Patient*innen oft eine große Herausforderung.
Welche Bücher würdest du dir für eine Nachtwache in den Rucksack packen?

Es müssten Bücher sein, in denen man immer wieder kurz lesen kann, die man weglegen und wieder zur Hand nehmen kann, wenn es passt. Neben mir liegt z.B. gerade „Glaube, Hoffnung und Gemetzel“ von Nick Cave und Sean O’Hagan, das sich gut eignen würde – eine Serie von wunderbaren Gesprächen über Kunst, Musik und das Leben. Einen Lyrikband hätte ich sicherlich auch mit dabei: einen, den ich schon gut kenne, den ich einfach irgendwo aufschlagen und in dem ich mich sofort zu Hause fühlen kann: „im felderlatein“ von Lutz Seiler oder „Die Worte, die Worte, die Worte“ von W.C. Williams.
In „Zwischen Mauern“ meldet sich die Protagonistin Meta ehrenamtlich für die Aufgabe. Warum, glaubst du, entschließt sie sich dazu?
Es gibt viele Motive, um ehrenamtlich tätig zu werden, wahrscheinlich so viele, wie es Ehrenamtliche gibt. Meta hat sich wahrscheinlich dazu entschieden, weil sie hofft, Sinn in dieser Tätigkeit zu finden, den sie in ihrem Beruf nicht findet. Sie geht das durchaus naiv an – im positiven wie im negativen Sinn.
Metas Vorstellungen über ihren freiwilligen Dienst ändern sich nach wenigen Nächten zwangsläufig. Kommen ähnliche Situationen in der Praxis oft vor?
Viele Menschen beginnen mit hohem Idealismus im Gesundheitsbereich zu arbeiten oder starten eine Ausbildung. Dass es dann zu einer Konfrontation mit der Realität kommt und diese hohen Erwartungen bis zu einem gewissen Grad gedämpft werden, liegt in der Natur der Sache. Wichtig ist in der Praxis, diesen Idealismus behutsam auf den Boden der Realität zu bringen – die Personen sollen ja viele Jahre hier arbeiten. Andererseits kann natürlich ein bestehendes Team profitieren, wenn alte Gewohnheiten hinterfragt und neue Möglichkeiten aufgezeigt werden.
Der Roman dreht sich auch um ein moralisches Dilemma. Warum zweifelt sie letztendlich daran, in das Pflegeheim zurückzukehren?
Metas Weltbild ist zu Beginn des Romans recht schwarz/weiß. Was sie sich letztlich erkämpfen muss, ist ein Gefühl für die Graustufen dazwischen, für einen gangbaren Weg in einer nicht idealen Situation. Das ist übrigens auch etwas, was vielen Leuten in aktuellen aufgeheizten Diskussionen gut zu Gesicht stünde.
Es gibt eine illustre „Ahnenreihe“ von Ärzt*innen, die sich erfolgreich schriftstellerisch betätigten, mit William Carlos Williams hast du deinem Roman auch die Lyrik eines „Ärztedichters“ vorangestellt. Geht mit dem Arztberuf ein besonderer Blick auf unser Dasein einher?
Menschen gewähren uns Zugang zu intimen und entscheidenden Momenten ihres Lebens, auch zu ihren Körpern, zu ihrer Psyche, und das bedingt einen besonderen, einen im besten Sinn privilegierten Blick auf unser Dasein, der nicht ohne Einfluss auf das eigene Leben bleibt. Das betrifft natürlich nicht nur Ärzt*innen, sondern gleichermaßen die Pflege und andere Gesundheitsberufe.
In einem Interview hast du einmal eine Schriftstellerin zitiert, die schrieb: „Ein Text sollte sein wie ein Bouillonwürfel. So konzentriert und eingekocht und der Leser gibt dann sein Wasser dazu.“ Ist das Krankenhaus als Ort konzentrierter existentieller Erfahrungen manchmal wie ein Bouillonwürfel des Lebens?
Im Krankenhaus sind wir Nebenfiguren in der Lebensgeschichte unserer Patient*innen, und das sehr oft an entscheidenden Wendepunkten in ihrer Existenz, z.B. am Beginn oder eben, wie in meinem Fall, am Ende des Lebens. Diese hohe Dichte an schönen, an schrecklichen, jedenfalls aber wichtigen Momenten, die wir miterleben, ist schon sehr besonders und ein großer Schatz.
David Fuchs im Haymon- Videointerview 2018
Du wirst bestimmt häufig gefragt, ob und wie dein Ärztedasein dein Schreiben beeinflusst. Wie verhält es sich umgekehrt, hat die Schriftstellerei deinen Alltag im Krankenhaus verändert?
Ich glaube, dass ich durch das Schreiben mehr Bewusstsein für die Geschichten meiner Patient*innen entwickelt habe, auch für die Sprache, in der sie diese Geschichten erzählen. Es tut auch gut, diesen zweiten Beruf zu haben, diese ganze andere Welt zu kennen, um nicht aus dem Blick zu verlieren, dass das Krankenhaus, wenn es auch einen großen Teil meines Lebens bestimmt, nicht mein ganzes Leben ist.
Auch in deinem letzten Roman „Leichte Böden“ geht es – neben einigen anderen – um die Frage, ob jedem Menschen ungeachtet seiner Vergangenheit gleich viel Fürsorge zusteht. Ist dein Schreiben auch ein Weg, einen Umgang mit dieser Frage zu finden, die sich in deiner Rolle als Arzt eigentlich gar nicht stellen darf?
Es ist eine wichtige und vor allem eine sehr alltägliche Frage, die mich deswegen auch schriftstellerisch beschäftigt. Jeder Mensch verdient die gleiche Fürsorge, und wir urteilen nicht; allerdings geht es nicht spurlos an uns vorüber, welches Verhalten Patient*innen zeigen, welche Vergangenheit sie haben oder wie sympathisch sie uns sind. Alle Menschen werden krank, und so sind wir eben mit einem Querschnitt der Gesellschaft konfrontiert.
Spannend finde ich, wie es uns gelingen kann, damit umzugehen und wichtig ist mir, dass wir uns auch eingestehen dürfen, dass es bei manchen Menschen einfach sehr schwierig ist, das Maß an Fürsorge und Professionalität aufrechtzuerhalten, das wir uns wünschen.
Was Außenstehenden oft als kalte, sterile Institution erscheint, wird in deinem Roman trotz des etwas verlassenen Settings als facettenreicher und menschelnder Lebensraum gezeichnet. Wir lernen eine interessante Parallelwelt kennen, die von strengen Routinen, aber auch von schrulligen Kuriositäten geprägt ist. Ist die landläufige Vorstellung, die wir uns von Gesundheitseinrichtungen (und deren Angestellten!) machen, oft zu abstrakt und unpersönlich?
Ja klar. 😊 Der Alltag ist menschelnder, auch humorvoller und schrulliger, als man sich das vielleicht gemeinhin vorstellt. Ich behaupte ja immer, dass „Scrubs“ die Krankenhausserie mit dem vielleicht höchsten Grad an Realismus war.
Hallende menschenleere Gänge, vereinzeltes Schnarchen, Ächzen, Rascheln hinter den Türen, allein klackern wir durch das nächtliche Pflegeheim: Der Handlungsort von „Zwischen Mauern“ versprüht eine einzigartige Atmosphäre, die einen in ihren Bann zieht. Und einen ein bisschen auf sich selbst zurückwirft. Fällt in der Nacht das Abstreifen des privaten Menschen für die Rolle, die man als Personal einnimmt, schwerer?
Ich arbeite selbst schon seit einigen Jahren nicht mehr nachts, habe die besondere Atmosphäre aber immer gemocht. Die Arbeitsdichte ist in der Nacht meist nicht geringer als untertags, aber der Grad der Erschöpfung ist bei allen Berufsgruppen höher. Da mag es schon oft schwerer fallen, gut in der Rolle zu bleiben und Grenzen zu spüren.

Bist du neugierig geworden? „Zwischen Mauern“ findest du ab 19. September in deiner Lieblingsbuchhandlung . Alle Infos zum Buch findest du hier!