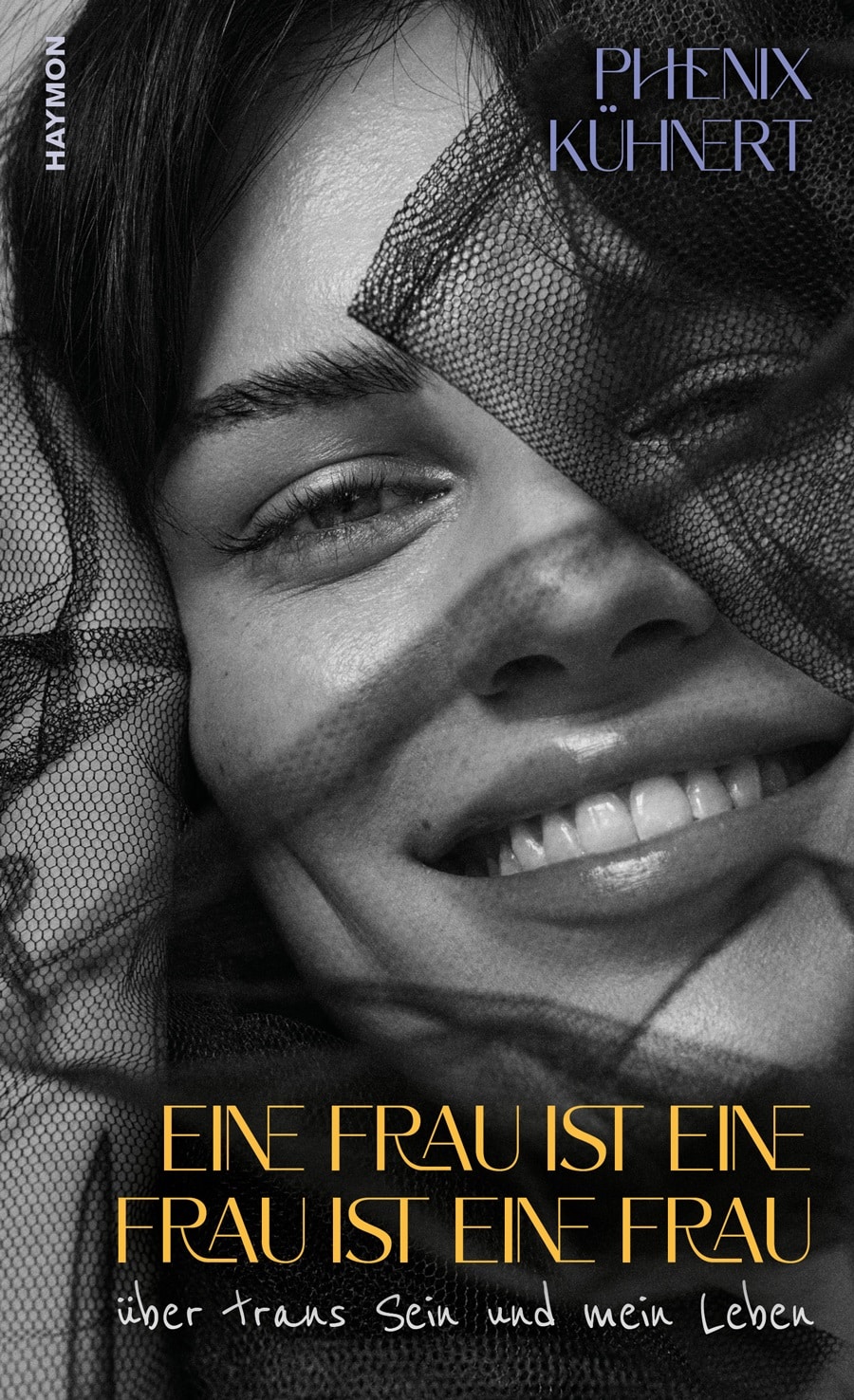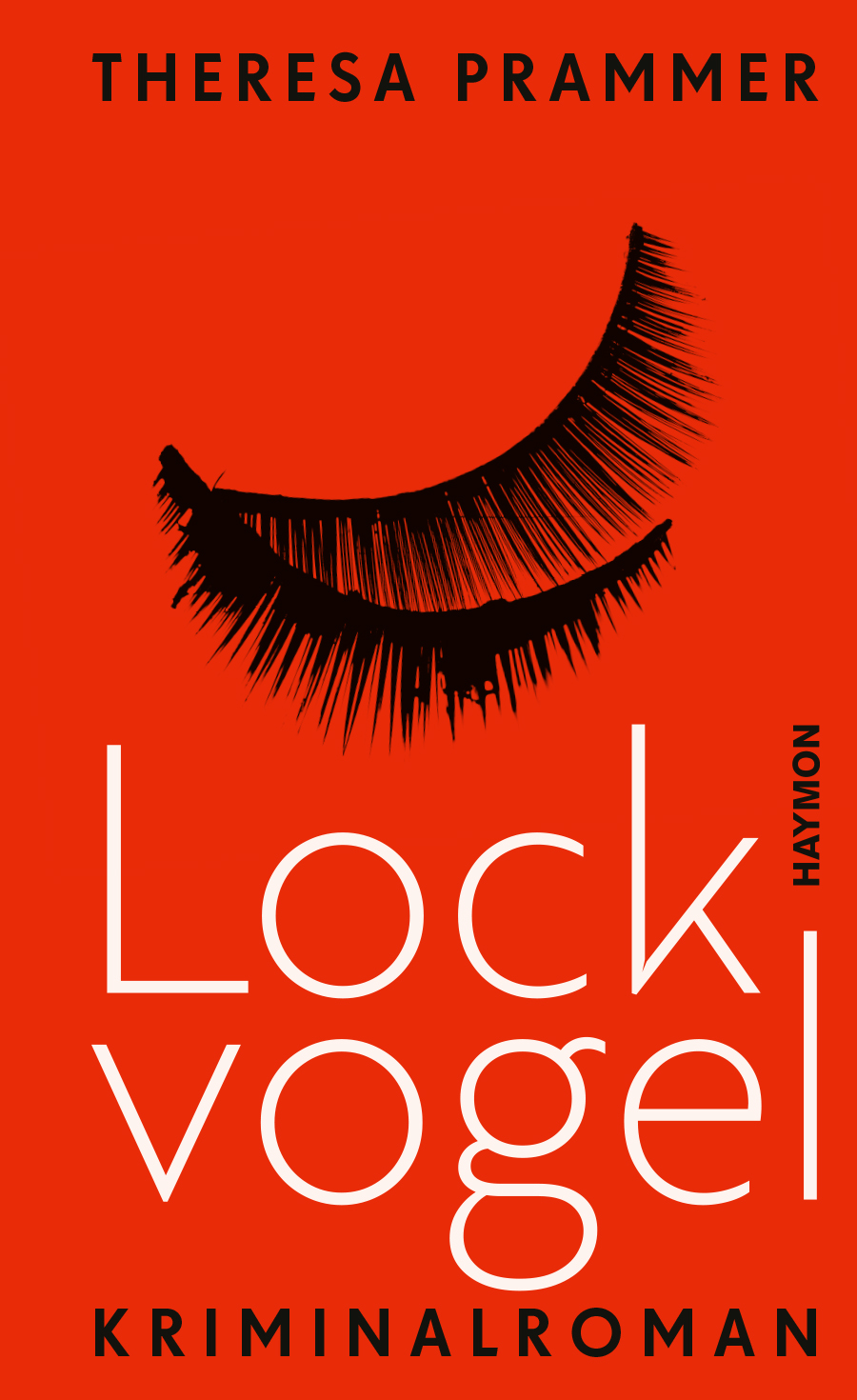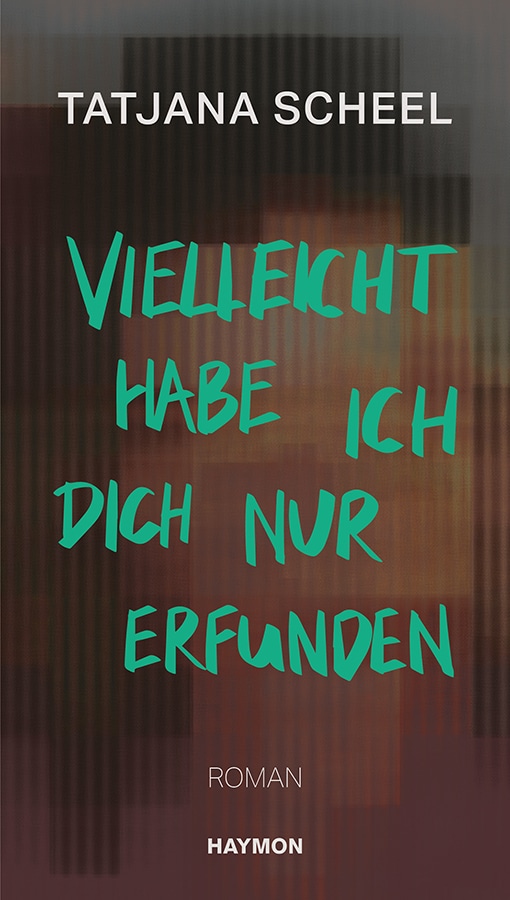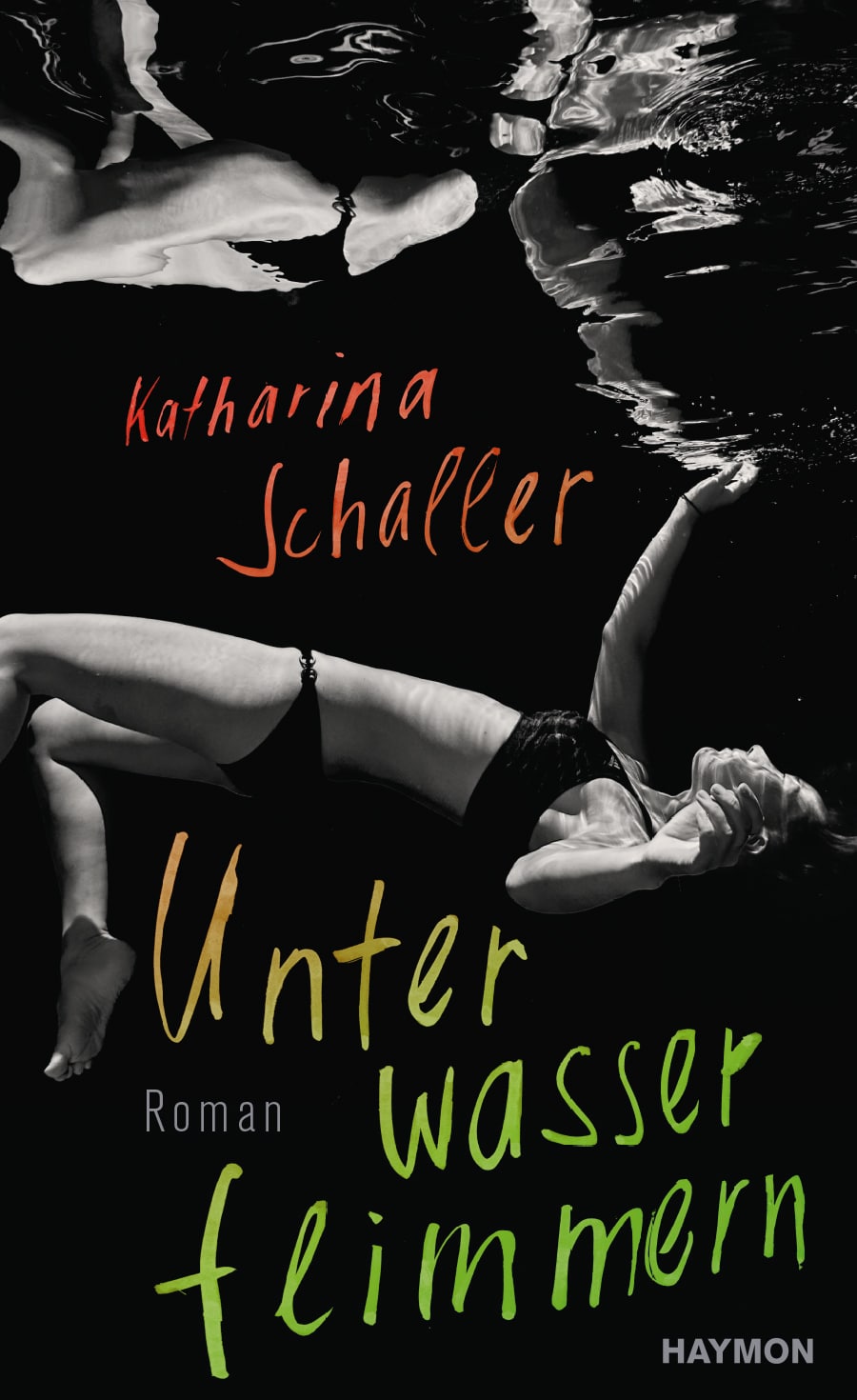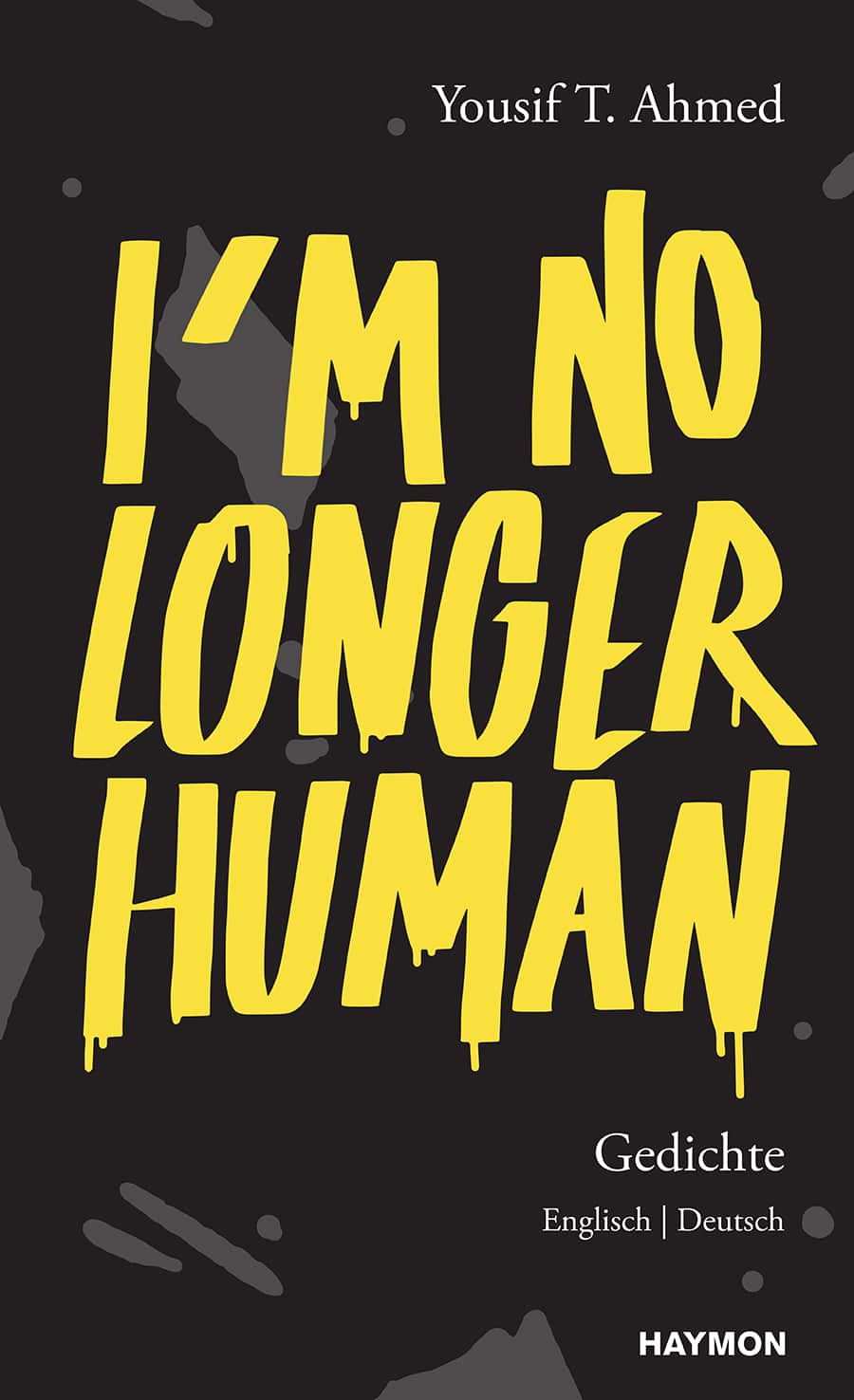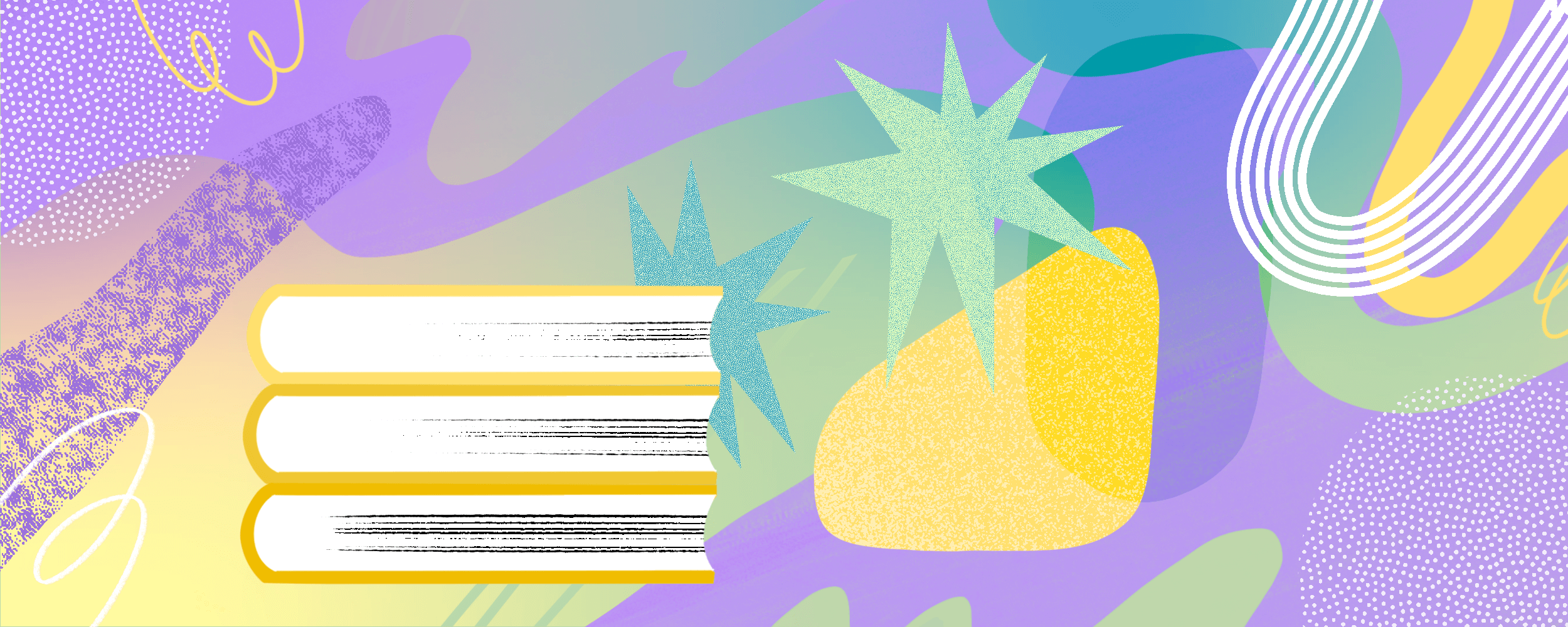
Die verkorkste Literaturbranche: Aufbruch täte not. Ein Essay von Marlen Schachinger
Literatin und Literaturwissenschaftlerin Marlen Schachinger hat Anna Jung (Pressesprecherin bei Jung & Jung, Agentin bei Schuppach & Jung), Markus Hatzer (Haymon-Verleger) und Ralph Klever (Eigentümer des Klever-Verlages) zum Gespräch gebeten. Entstanden ist daraus ein aufschlussreicher Essay über die Notwendigkeit der Veränderung im österreichischen Literaturbetrieb – und darüber, wie wichtig es ist, den Leser*innen zuzuhören.

Marlen Schachinger studierte Komparatistik, Germanistik und Romanistik in Wien und ist als Literaturwissenschaftlerin und Literatin tätig. Sie ist die Leiterin des 2012 gegründeten Instituts für narrative Kunst in Wien und setzt sich u.a. mit der Theorie des Schreibens und der feministischen Literaturgeschichte auseinander. Auf ihrem Blog Mitlese teilt sie allerlei neugierige Ein- und Ausblicke auf die Literaturlandschaft. – Foto: Landeshauptstadt Magdeburg
Die literarische Landschaft sieht sich 2022 mancher Herausforderung gegenüber, was keineswegs ein Schaden ist, sondern vielmehr eine Chance, dringend nötige Veränderungsschritte bewusst zu setzen; und mit Elan, vor allem aber mit dem nötigen Mut in die Zukunft zu gehen. Ohne dieses Engagement werden Literaturverlage die nächsten zehn Jahre kaum überleben. Nicht bloß wegen der enorm gestiegenen Papierpreise, sondern auch da nach wie vor das Gros der Leser*innen weiblich und im besten Alter von 50+ ist. Bibliotheken, Veranstalter*innen und Buchhandel sind folglich ebenso herausgefordert wie Politik und Bildungslandschaft jüngere Generationen mit bibliophiler Leidenschaft anzustecken. Gelingt es nicht bald, breitere Leser*innen-Gruppen in anderen Altersspektren zu erreichen und sie nachhaltig für Literatur zu begeistern, wird es in Zukunft schwierig werden. Die mangelhafte Sprachkompetenz der unter 18-Jährigen ist erschreckend, ihr Vokabular derart begrenzt, dass ihnen die Literatur mehrerer Jahrhunderte kaum mehr zugänglich ist, und die Altersgruppe zwischen 30 und 45 fehlt auffallend bei allen literarischen Veranstaltungen. Die gesamte literarische Landschaft ist gefordert, rasch die nötigen Schritte zu setzen. Neben dem bewussten Engagement zur Unterstützung der Lehrenden in den Schulen durch Künstler*innen bedarf es auch eines Eingehens auf die Anliegen junger Menschen, auf ihre Themen in den Verlagsprogrammen sowie des Signals, dass man sie ernst nimmt. Nicht weil die Literatur an und für sich gerettet werden müsse – um die Narration mache ich mir keine Sorgen, bloß um die Landschaft rund um eine Kunstform.
»Die Literaturlandschaft hat sich verändert, weil sich auch die Art zu lesen verändert hat«, so Anna Jung, Pressesprecherin bei Jung & Jung, Agentin bei Schuppach & Jung und einmal die Woche noch immer Buchhändlerin in München. »Das Wort, das im letzten Jahr am häufigsten in Zusammenhang mit Literatur gefallen ist, war Eskapismus. Alle wollten nur noch etwas Eskapistisches lesen.«
Oder um es andersherum zu sagen: Literatur vermag die Gegenwart zu spiegeln, sie hat die Fähigkeit, einem in unerträglicher Zeit Freiräume zu eröffnen, in denen gedacht und geträumt werden darf. Sie ist eine Chance, Themen auf das Tapet zu bringen, welche nicht die Tageszeitungen füllen, weil sie morgen oder übermorgen schon Schnee von gestern sind, sondern in die Tiefe dessen zu gehen, was uns auch morgen noch bewegen und berühren wird. Gegenwärtig ist also Eskapismus gefragt; das meint keineswegs den ›Sommerkuss in Saint Tropez‹ und auch der Mohnnudel-Mord wäre ein Missverständnis. Es referiert weitaus eher auf die Universalpoesie der Romantik.
Zugegeben, die Dringlichkeit, endlich in die Gänge zu kommen, sehen nicht alle. Manche sind durchaus bereit, die Zeit diese Angelegenheit für sich erledigen zu lassen, weil sie sowieso bald in Rente gehen oder das rasche Tempo dieser Welt sie erschöpft hat.
Anna Jung bringt die Herausforderung im literarischen Feld markant auf den Punkt: »Der Wille zur Modernisierung ist in der ganzen Buchbranche nicht unbedingt das, was immer schon da gewesen wäre, sondern eher, was nach wie vor fehlt: mehr Wille zur Veränderung, weniger Sich-Sträuben gegen alles, was sich verändert, weniger Sich-Querstellen, wenn es neue Konzepte gibt, die mit Digitalisierung zu tun haben, mit Zusammenschlüssen. Überhaupt, Ideen, wie man sich gegenseitig besser helfen könnte, unterstützen könnte – da ist immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Alle hocken in ihrem Brei, wie sie ihn immer schon gewöhnt sind, wollen, dass alles so weitergeht, wie es immer schon gewesen ist. Diese Bequemlichkeit kommt natürlich auch ein bisschen aus der Situation, dass die österreichischen Verlage größtenteils subventioniert werden.«
Eine Konsequenz dieser Förderung, die zwischen fünf- und hundertzwanzigtausend liegt, sei, dass Verlage »nicht so wahnsinnig auf die Zahlen schauen« müssen, es bestehe keine ökonomische Notwendigkeit, sich ununterbrochen anzupassen und zu verändern wie in Deutschland: »Wie viel mehr Mut dort vorhanden ist! Die müssen sich ständig etwas einfallen lassen, damit sie im Fokus bleiben«, und Anna Jung fährt in ihrer vergleichenden Analyse fort, indem sie die Krux benennt: »Während die österreichischen Verlage sich damit zufriedengeben, dass sie nur in Österreich bekannt sind, nur in Österreich gelesen werden. – In Deutschland interessiere die österreichische Literatur nun mal niemanden.«
Grund genug, im Interview die ketzerische Frage zu stellen, ob folglich in den deutschen Verlagen nur zufälligerweise zahlreiche österreichischen Autor*innen vertreten seien.
»Genau. Zufällig. – Wie kann das sein?«, und Anna Jung stimmt in mein schallendes Gelächter ein. Das durchaus auch etwas Hilfloses hat. Wenigstens von meiner Seite.
In weiterer Folge führt dies dazu, dass österreichische Literat*innen eingemeindet werden – ›Echt jetzt? Musil war Österreicher?‹, und die Namen, die statt des Kärntners gesetzt werden könnten, würden aufgelistet sicherlich eine gute Seite ergeben.
Überleben? Es geht nicht darum, zu ›überleben‹! Sondern darum, Zukunft zu gestalten.
Das Problem ist also nicht die Literatur, ihre Sprache, ihre Struktur, nicht einmal ihre Sujets, das Problem ist eine Verlagslandschaft, die vor Erhalt der sogenannten ›großen Verlagsförderung‹ zu prekär und zu überlastet arbeiten muss und die danach zuerst zu erschöpft, alsdann zu saturiert ist, um mit neuen Maßnahmen mutige Schritte zu setzen.
Viele, nicht alle!
Natürlich nicht.
Die allgemeine Unbeweglichkeit der österreichischen Verlagslandschaft trifft auf jeden Fall auf den Haymon Verlag nicht zu, der sich jüngst in seinem 4-köpfigen Leitungsteam zu manch mutigem Schritt entschloss. Ausgangspunkt waren dabei logischer- und vernünftigerweise die Leser*innen; oder um genau zu sein: der Mangel an jüngeren Leser*innen.
Markus Hatzer, Verleger des 1982 gegründeten Haymon Verlags, und sein Team nahmen diese Beobachtung zum Anlass, den Verlag während der letzten eineinhalb Jahre umzugestalten: »Haymon reloaded« entstand, wie der Prozess intern genannt wird. Ein Experiment sei es, ein Versuch, der gelingen oder scheitern könne, der aber auf jeden Fall nottue. Den Ausgangspunkt bildeten das verlegerische Credo und zwei Reflexionen: Wer darüber nachdenke, jüngere Leser*innen für sich zu gewinnen, sei gut beraten, nicht nur über die eigenen, sondern auch über deren Werte und Denkweisen nachzusinnen, so Markus Hatzer.
»Es geht ja nicht nur darum, als Verlag zu überleben – man redet immer davon, aber: Es geht doch darum, relevant zu bleiben, eine Wirkung zu entfalten«, sagt Hatzer und fügt sogleich hinzu: »Immer in dem Sinne, dass im Zentrum eines Verlages natürlich ausschließlich die Autor*innen stehen und die Bemühungen um die Werke dieser Autor*innen. Das ist die Grundannahme. Ein Verlag ist kein Selbstzweck und schon gar kein Vehikel für Eitelkeiten des Verlegers; weder für irgendwelche anderen Absichten noch für missionarische Dinge. Ein Literaturverlag ist meiner Auffassung nach dazu da, den Autor*innen und ihren Werken eine Verbreitung zu verschaffen. Das ist seine Aufgabe.« Und die nimmt das Haymon-Team durchaus ernst.
Neue Themen und Aspekte haben ins Programm Eingang zu finden, sieht ein Verlag sich verpflichtet, die Sicht aller auf unsere Welt zu porträtieren. Und diese Sicht ist glücklicherweise mittlerweile divers und nicht per se maskulin, heteronormativ und weiß.
Markus Hatzer betont, er sei zwar kein Freund der Quote per se, kein Fan der starren Regeln, aber ohne diese werde sich nichts ändern. Es brauche jenes Haltegerüst: »Von allein funktioniert das nicht! Wir stellen uns der Anforderung ›Diversität‹. Da geht es nicht nur um Männer und Frauen, sondern auch um People of Color, indigene Menschen.« Und durchaus selbstkritisch stellt Markus Hatzer die ›guten‹ Jahre für Autorinnen bei Haymon – »das waren 20% Frauen, 80% Männer« –, den schlechten – »gar keine Frauen« – gegenüber. Das sei ein Faktum, dem habe man sich zu stellen und die Zukunft dementsprechend zu verändern. Mehr Frauen ins Programm, mehr literarische Arbeiten, welche den Blickwinkel der People of Color-Autor*innen oder LGBTQ*-Literat*innen auf unsere Welt einbringen.
Aktives Handeln, so Markus Hatzer, sei daher gefordert, man müsse die (internen) Regeln ändern und dies durchaus mit einer gewissen Radikalität: »Ich kann natürlich nicht für andere Verlage sprechen, aber bei denjenigen, bei denen ich Einblick habe, ist es genau dasselbe: Bevor man diesen Willen zur Veränderung nicht als ›Gesetz‹ formuliert, funktioniert es nicht. Es reicht nicht, dass man sagt: ›Wir machen Bücher.‹ Das genügt nicht. Man muss – auch als Verlag –, meiner Meinung nach, Farbe bekennen und sagen: Das ist uns wichtig.«
Wer hat hier Skrupel?
Ralph Klever, Eigentümer des gleichnamigen Klever Verlags, kennt gleichfalls das Problem. Seine Programmstruktur fußt auf drei Säulen: Prosa, Essay, Lyrik. Dieser folgt auch seine Auswahl an Literat*innen, und wiewohl er durchaus wahrnehme, dass die Mehrheit der Schreibenden weiblich sei, bekomme er entschieden mehr Manuskripte von Autoren. Er wisse nicht zu sagen, woran das liege, vielleicht hätten »Autorinnen mehr Skrupel, ihre Manuskripte in die Welt zu schicken als ihre Kollegen?« Im Nachsatz fügt er sein Bedauern hinzu, denn eine Konsequenz daraus seien Programme mit hohem Männer-Anteil. Dabei habe er sich doch von Anfang an Ausgewogenheit zum Ziel gesetzt: jüngere und ältere Literat*innen, den Arbeiten von Männern wie Frauen eine Stimme geben …
Als Literatin kenne ich den Blick – man sieht sich vor dem Aussenden eines neuen Entwurfs in den Verlagen um, prüft, wer zu einem passe. Und als Autorin fällt es einem naturgemäß auf, wenn in einem Verlag 80 % der Titel (oder mehr) von kreativen Köpfen stammt, die maskulin, weiß und hetero sind. Statt darauf ein Postporto zu kleben, kaufe man sich lieber 5 Kilo Kartoffeln. Davon lebt man länger; um die Wahrheit zu sagen.
Vielleicht wäre gerade für Verlage, die eine solche Schieflage mit Erschrecken erkennen, der Schritt ratsam, den Anna Jung für das A und O des Literaturbetriebs hält: den Dialog, das direkte Gespräch. Weshalb nicht als Verleger an Literatinnen herantreten? Von mir aus auch an Agent*innen, um sich bei ihnen nach Manuskripten zu erkundigen? Weil es immer so war, dass man das nicht tat? Weil einem skrupellose Männer, überzeugt von ihrer Bedeutung für den Globus, eh die Tür einrennen und sich als gekränkte Diven gebärden, erklärt man ihnen, es sei besser, sie würden noch ein wenig an einem Manuskript arbeiten, statt jede Flatulenz sogleich publiziert haben zu wollen? Oder um es mit Ralph Klever zu sagen: »Als würden sie Angst haben, dass sie nicht mehr diskutiert werden, wenn sie nicht jedes Jahr ein Buch machen.«
Wahre Größe kennt keinen Warenwert
Das Gespenst, alle bisher geleistete Arbeit werde obsolet, sei man nicht permanent präsent, hat wohl bei allen schon einmal um die Ecke gelugt; und die Älteren in der Branche sorgen dafür, dass die Jüngeren diese Angst rasch lernen. So entsteht eine wunderbar hyperaktive Aufgeregtheit, die weder zur Kollegialität noch zur Nachhaltigkeit führt und am wenigsten zur Kunst.
Es sei doch entsetzlich, so Anna Jung, dass es in einer Branche, in der es um Sprachkompetenz und Dialog gehe, so weit gekommen sei, dass man nicht mehr miteinander rede, alles bloß noch per E-Mail erledige: »Oder auch nicht. Wenn einer keine Lust hat, dann kriegt man halt einfach keine Antwort. Nie. So kann alles unter den Tisch fallen, was man nicht beantworten möchte.« Aktiv rausgehen, die persönlichen Kontakte suchen, ohne diese Dialogkompetenz gehe es nicht (mehr). Sitzen und warten und hoffen, dass sich schon irgendwer für ein Buch interessiere, das sei schlicht unmöglich.
Ein Widerspruch zum obigen kritisierten Präsenz-Wahn? Nicht wirklich, denn Anna Jungs Aussage betrifft primär die Arbeit der Verlage und Agenturen, der Veranstalter und Literaturpreise. Für Literat*innen, vor allem wenn sie in kleineren Verlagen publizieren, ist die Notwendigkeit, sich engagiert in die PR einzubringen, nicht von der Hand zu weisen: Nur so floppt ein Titel nicht, nur so kann es gelingen, ihn gut zu positionieren. Insbesondere, da die Aufmerksamkeitsspanne, die einer Novität eingeräumt wird, seit zwanzig Jahren konstant sinkt. Ralph Klever, der die Pandemie als Beschleuniger des Nachdenkprozesses definiert, fordert auch diesbezüglich ein Umdenken: Kleinere Verlage können und sollten nicht wie große Konzerne agieren. Die Pandemie habe bewiesen, der Betrieb funktioniere durchaus ohne jene großen Messen. Nun sei es relevant, zu reflektieren, was wahrhaftig wichtig und notwendig sei: »Wir sind alle überfordert mit der Kurzlebigkeit: Damit, dass Bücher so schnell auf den Markt geworfen werden, immer nur für eine knappe Saison aktuell sind, dann verschwinden, schon zieht die Karawane wieder weiter. Das macht uns Kopfzerbrechen, und ich glaube, wir sind alle nicht glücklich damit.«
Eine Konsequenz jener Hektik ist das Gieren der Autor*innen nach Verträgen mit großen Verlagen und viel Vorschuss – das müsse sein.
Nein, liebe Kolleg*innen. Muss es nicht. Oder um es mit Anna Jung zu sagen: »Es hat sich eingeschlichen, dass manche Riesenvorschüsse zahlen. Der Graben ist wahnsinnig groß zwischen denen, die gar keinen Vorschuss bekommen, denen, die einen Tausender kriegen und denjenigen, die an die Hunderttausender-Grenze stoßen. Das ist ja wirklich eine absurde Summe für einen Roman! Es ist auch absurd, was teilweise für Debüts bezahlt wird. Natürlich sind das Beträge, die nie im Leben eingespielt werden. Das kann nur auf Kosten aller anderen gehen!«
Wieder einmal wäre es an der Zeit für mehr Fairness, weniger Kapitalismus, mehr Fair Pay! Es tut not, diesen Wahnsinn zu unterbinden, der die Arbeit der Mehrheit zu Peanuts degradiert und dem Schaffen einiger weniger den Nimbus des Heldenhaften verleiht.
Insbesondere junge Schreibende erwarten sich jedoch mittlerweile solche Verträge, damit sich ›das Schreiben auszahle‹ – so Anna Jung: »Wie viel man danach verkauft, das ist schon wieder eher wurst.« In deren Vorstellung. Denn die Wahrheit sieht anders aus: Wer einen Vorschuss nicht einspielt – was jenseits der Zehntausend illusorisch ist –, wird zur Eintagsfliege. Für Verlage kein Eklat, es stehen ja eh die nächsten Chancen bereits auf der Matte; für Autor*innen, denen Literatur jedoch an und für sich etwas bedeutet, kann das zur Tragödie werden. Wer also primär in jenem Feld arbeiten möchte, um rasch zu Geld zu kommen, der oder die sollte darüber nachdenken, ob er oder sie nicht im falschen Feld danach buddle. Als Immobilienmakler, IT-Manager, Bauunternehmer oder Krimineller wären einem hurtiger der Erfolg beschieden; wenigstens solange man nicht ins Stolpern gerät, sich verplappert oder vertippt. (Was meines Erachtens immer zu spät geschieht, aber das ist ein anderes Thema.)
Auch ein großer Verlag – muss nicht sein. Man nennt in jenen Häusern unter der Hand die billigen Ränge nicht umsonst ›Wegfalltitel‹: Sie sind dazu programmiert, das Plansoll zu erfüllen, aber engagieren wird sich keiner und keine für diese Programmtitel.
Meines Erachtens ist daher Platz eins oder zwei, drei, vier oder fünf im kleinen Verlag absolut vorzuziehen. Diese Sichtweise hat naturgemäß wenig mit zu erwartenden Tatiemen zu tun, sondern damit, wie man zur eigenen Arbeit steht: Da sie mir wahrhaftig ein Anliegen ist, finde ich, es sei vorzuziehen, sich einen Partner, eine Partnerin zu suchen, der oder die diesem Werk gleiche Zeit, Kraft, Energie und Aufmerksamkeit schenke wie ich. Andere mögen das anders sehen, das steht jedem frei …
Was Anna Jung ungemein ärgere, sei, dass jüngere Verlagsinitiativen mit anderen Konzepten hierzulande zuerst einmal nicht ernst genommen werden, per se, um nicht zu sagen lächerlich gemacht. Statt arrogant das Näschen zu rümpfen, weil jemand sich mit anderen Konzepten erprobt, »sollten wir froh sein, dass es die gibt!«, bringt Anna Jung es auf den Punkt. Seien es Bahoe Books in Wien oder der Mairisch Verlag in Hamburg, der explizit auf den Kontakt zu Leser*innen setze, »Voland & Quist« mit seinem Fokus auf Spoken-Word-Lyrik, auf junges Erzählen. Und Markus Hatzer fügt zur Liste der Initiativen mit anderer Struktur die Plattform & Töchter sowie den Zuckersüß Verlag hinzu. Bei Letzterem gibt es übrigens »Das Buch vom Feminismus« und »Das Buch vom Anti-Rassismus« für Kids ab 10 Jahren: Könnten tolle Geschenke für Unter-dem-Baum sein, nicht wahr? Intersektional, inklusiv, knallbunt und aus dem amerikanischen Englisch, verfasst von Jamia Wilson bzw. aus dem Französischen von Tiffany Jewell und Aurélia Durand. Allesamt People of Color.
Wider die Enge im Denken
Diversität darf kein Feigenblatt sein, kein Sich-Anbiedern an aktuelle Diskussionsprozesse. Das betont auch Markus Hatzer: Es gehe nicht darum, ›im Trend‹ zu navigieren, sondern es gäbe eine Notwendigkeit sich mit der Thematik auseinanderzusetzen:
»Wir müssen uns bewusst machen, dass wir – mehr oder weniger – in einem latent rassistischen Denken erzogen worden sind, und wir müssen uns überlegen, wie man darauf reagiert. Ich habe darauf auch abwehrend reagiert, am Anfang. Aber wenn man dann Bücher dazu liest, merkt man, es geht um die Frage, was ist von kolonialistischem Denken noch übrig, vom nationalsozialistischen Denken, in unserer Gesellschaft: Was sind die Probleme unserer gemeinsamen Psyche. Wie arbeitet man das auf. Das sind wichtige Themen für die Zukunft. Oder dass man trans Personen vieles abspricht, das ist ein großes Problem. Und das möchte ich auch bei Haymon in der Programmierung abbilden: Menschen zu Wort kommen lassen, die man bislang nicht zu Wort kommen ließ. Da nehme ich mich als Haymon gar nicht aus.«
Bedeutsam erscheint Ralph Klever, dass »der Betrieb seit den 1990er-Jahren viel weiblicher geworden ist. Heute sind Frauen nicht mehr nur in den Presseabteilungen zu finden.« Verlegerinnen erobern sich Raum, und das sei gut so, sagt Ralph Klever.
Ja, im deutschsprachigen Raum an und für sich, aber hierzulande? In Österreich? Da ist noch sehr viel Weite für feminine Abenteuerlust in der Verlagslandschaft gegeben! Mir jedenfalls will ad hoc keine Handvoll Verlegerinnen einfallen, während das Gros der Lektor*innen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiblich ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ausschließlich das nötige Startkapital das Problem ist oder ob es auch an mangelndem Mut und Männerbünden liegt. Die erlebt man in der Literaturlandschaft ja durchaus (Siehe auch: #24FaktenFrauenLiteraturwelt der igFemAT).
Balanceakt 2.0
Derzeit seien »alle im Betrieb recht zufrieden«, subsumiert Anna Jung die Situation in Agenturen und Verlagen: »Zufriedener als sie es die Jahre zuvor waren. Diese vielen Jahre, in denen immer nur gejammert wurde, dass alles immer schrecklicher wird. Das hat sich ein bisschen gelegt. Was natürlich zum großen Teil daran liegt, dass die ganze Buchbranche von der Situation, in der wir alle stecken, eigentlich profitiert hat, weil es den Buchhandlungen – jedenfalls denen, die sich bemüht haben, das Beste daraus zu machen, besser geht als vorher. Die Verlage haben wahnsinnig viel Geld gespart, indem sie nicht auf Messen fahren mussten, indem nicht gereist wurde und indem besser verkauft wurde und es Subventionen gab – zumindest in Österreich.«
Während die einen also finanziell besser denn je dastehen und nun die Beine hochlegen, realisieren andere erst jetzt, wie groß das Zuviel vergangener Jahre war, wie anstrengend ihnen der Balanceakt zwischen den gegenwärtigen Anforderungen aus ihrem privaten Umfeld und ihrem beruflichen Alltag ist. Vor allem diese kommen zu dem Schluss, so wie es war, könne und solle es nicht weitergehen.
Ich weiß ja nicht, wie sich Ihr Umfeld befindet, aber ich habe zu keiner Zeit so oft im unteren Teil einer E-Mail von Bandscheiben, Laptop Shoulders, Erschöpfungszuständen, Herzunruhe, Panikattacken, Sehstörungen und Zukunftsträumen gelesen wie derzeit.
Wer immer am Limit werke, so Ralph Klever, sich ewig im Hamsterrad abstrampele, dem fehlen die notwendigen Momente, um innezuhalten, um darüber nachzudenken, wie an diesen Rädern denn gedreht werden könne, sodass Arbeit mit Freude von der Hand gehe und auch noch Zeit sei, um sich Gedanken um die Zukunft zu machen, den eigenen Weg selbstbewusst zu bestimmen.
Aufgrund der konstanten Überforderung, die gerade kleinere Verlage, kleinere Agenturen, aber auch viele Autor*innen tagtäglich erleben, sei die Kompetenz des Delegierens dringend nötiger Lernbedarf: Abgeben, sich vernetzen, zusammenarbeiten, das, so Ralph Klever, könne er sich durchaus vorstellen, insbesondere, wenn Kompetenzen einander ergänzen. Oder wenn ein Delegieren gegen Umsatzbeteiligung Arbeitsbereiche abdeckt, durch die man sich selbst eher quält.
Eigensinnige Trüffelsuche
Wie für viele in unserer Branche ist auch für Ralph Klever die erste Assoziation bei dem Wort ›Qual‹ die »unspannende Buchhaltung«: »Mein Ziel war es nicht, der große Geschäftsmann zu werden und als solcher in die Geschichte einzugehen. Ich bin Büchermacher und werde das auch bleiben, ich will nichts anderes sein. Deswegen war Expansion nie mein Ziel.«
Bewusst setzt er in seinem inhaltlichen Programm daher auf die Nische: Eigenständig etwas Eigenwilliges auf die Beine stellen, nennt er es. Was in seinem Fall bedeutet, nicht auf den Roman zu setzen, der wird in anderen Häusern sowieso stets die Nase vorne haben und bestens bedient werden, sondern auf die gemeinhin vernachlässigte Gattung Essay, diese literarische Form an der Schnittstelle zwischen Sachtext und Literatur, wobei die Grenzen durchaus fließend sein können, darauf habe er sich spezialisiert. Trüffelsuche, Goldgräbertum also! Statt Mainstreamwahn.
Nach dieser Haltung sehnt sich auch Anna Jung und empfiehlt sie vor allem den Journalist*innen: Es gehe doch nicht an, dass man den sowieso immer geringer werdenden Platz für eine Rezension einem Werk einräume, bloß weil andere es auch bereits rezensiert hätten! Es sei nur mehr ein Wettlauf um die erste Kritik eines ›Muss‹-Titels, keiner sei mehr auf der Suche nach den Trüffeln in der Menge. Mehr Mut, mal aus der Reihe zu tanzen, vielleicht auch Schräges zu besprechen statt ewigem Mitläufertum im Mainstream: Das wäre schön. Wann, so fragt Anna Jung im Interview, werden wir wieder stolz sein, weil wir etwas entdeckt haben?

Das Cover der Haymon Vorschau Herbst 2021. – Illustration: Gizem Winter
Haymon reloaded – ein Exempel
Um dieses Entdecken geht es auch bei »Haymon reloaded«. Der Verlag zählt zu den größeren in Österreich, drei Lektor*innen sind für das Programm mitverantwortlich: Nina Gruber, Linda Müller und Katharina Schaller. Sie waren auch in den Diskussionsprozess eingebunden – wenn schon Augenhöhe, dann konsequent. Es sind Veränderungen, die einem beim ersten Blick in den Katalog sogleich auffallen: Der Innsbrucker Verlag duzt die Leser*innen, die bewerbenden Zitate zu den Neuerscheinungen stammen nicht von den üblichen drei Verdächtigen, sondern hier gibt eine Lektorin Auskunft, weshalb man sich für jenes Werk entschied, dort bezieht der Verleger Stellung oder die Projektleiterin. Das hat Charisma, denn es zeigt die Menschen, die hinter den Autor*innen arbeiten, verleiht ihnen ein Gesicht. Sie werden greifbar. Und mit ihnen auch die Werke, die bald erscheinen; interessanter meines Erachtens, als gäbe eine*r Bekannt-aus-Film-Funk-Fernsehen (und daher vermeintlich des Zitats würdig) einen oft genug aussagelosen Befund über ein nicht-gelesenes Werk von sich, weil ein allgemeines Statement zu jenem Autor, zu jener Autorin abgedruckt wird.
Noch etwas fällt in dieser Verlagsvorschau auf: Die Covergestaltung der Vorschau erinnert an eine Graphic Novel, zwei Mädchen oder junge Frauen sind einander zugewandt, davor zwei weitere Frauen, ein Mann an einer Tür, die Hautfarben variieren, wie sie auch in unser aller Wirklichkeit verschieden getönt sind.
Ich denke daran, wie ich in den frühen 1990er-Jahren bewusst für meine Kids französische Kinderbücher bevorzugte, nicht bloß der Zweisprachigkeit wegen, sondern auch, weil ich darin bereits eine Buntheit der Welt abgebildet fand, die im deutschsprachigen Raum noch ignoriert wurde. Gizem Winter entwarf übrigens das Vorschau-Cover, und dieses verdient mehr als einen knappen Blick. Mit der Gestaltung der Buchcover werden freie Grafiker*innen beauftragt. Insbesondere bei den neuen Titeln von Marlen Pelny, Mirthe van Doornik und Sisonke Msimang, Yousif Ahmed kann sich deren Bildsprache sehen lassen! Verglichen damit wirken die via Foto gestalteten Umschläge der Krimis altbacken. Noch ein Wort zum gewählten ›Du‹: Als Literatin weiß ich um die Dringlichkeit der Du-Perspektive, die einen Bezug schafft, kenne die Notwendigkeit, in der PR sichtbar zu werden. Für Haymon heißt das: Wir haben etwas zu sagen. Und zwar dir. Nicht irgendwem. Und dieses Gesagte wird dich nicht kalt lassen. Es wird dich verändern: »Vielleicht wird dir nicht jedes unserer Bücher gefallen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir dir sagen wollen: Du hast eine Stimme. Du sollst gehört werden. Du sollst dich in die Mitte des Raumes stellen … Und wir hier? Wir warten auf dich!«
So steht es im Katalog, so wirkt es auch. Da ist jemand bereit, sich in einen Dialog zu wagen, statt bloße Waschzettelwerbung zu veranstalten.
Zwei solche Kataloge erscheinen in jedem Verlag pro Jahr – das ist in unserer Branche so üblich: eine kleine Herausforderung für die großen Verlage, ein Mammut für die mit einer oder zwei Personen besetzten Editionen. Muss das wahrhaftig sein, zwei Mal pro Jahr? Wozu? Wenn wir doch alle wissen, dass insbesondere im Herbst dieser Katalog ohnedies im Vorfeld der Aktivitäten zu den Buchpreisen – zumindest in der Aufmerksamkeit der Journalist*innen – untergehen wird. Ralph Klever, dem dieser Umstand schon länger ein Ärgernis ist, sieht aber dennoch keinen Weg daran vorbei: Man stünde mit der Entscheidung, fürderhin nur noch einen Katalog pro Jahr zu produzieren, allein auf dem Feld. Das könnte einem zum Nachteil gereichen, meint er.
Oder zum Vorteil: Nutzt man die Möglichkeiten des Internets, publiziert für das kommende Jahr einen Katalog und wässert alsdann monatlich via Newsletter daraus nach. Und ein konstanter Feed tut ja sowieso not. Bevor man zum Hörer greift und den Dialog sucht …
Es wäre wohl einen Versuch wert …
Übrigens kann man einen Newsletter nicht nur zur Bewerbung des eigenen Verlagsprogramms nutzen: Warum nicht auch Autor*innen von außerhalb interviewen, Dialoge führen? Der Haymon Verlag tut es, und dies bewusst, denn wer den Auftrag, es gehe um die Literatur, ernst nimmt, wird das goutieren, und wer die Leser*innen in ihrem Wunsch nach spannender Lektüre ernst nimmt, der kann ihnen durchaus Werke aus anderen Verlagshäusern empfehlen, ohne einen Zacken aus eigener Krone zu verlieren. Leser*innen werden es zu schätzen wissen, dass sich hier einer nicht in Egomanie gefällt, sondern vernetzt zu denken in der Lage ist.
Die verkorkste Literaturbranche
Es ist kaum vorstellbar, aber diese Veränderungsentwürfe und Ideen, insbesondere das ›Du‹ als Anrede, haben zu Kritik und Unkenrufen durch andere Branchenteilnehmer geführt. Es ist wie Anna Jung sagte, und es dünkt mir wahrlich ewig die gleiche Chose, wagt eine*r sich auf das Eis, wünscht man ihm*ihr den Beinbruch: Man werde so den Verlag unweigerlich an die Wand fahren. Oder das eigene Literat*innen-Leben, den Veranstaltungsort …
Markus Hatzer nimmt solche Flüsterer gelassen, versteht die Aufregung darüber ebenso wenig wie diejenige über das Gender-Sternchen z.B. und betont, es sei eben eine Phase des Experimentierens, des Ausprobierens. Für diese muss keine*r das Ei des Columbus’ bereits in Händen halten, sondern kann in Gelassenheit agieren.
»Wir stellen uns jeder Diskussion. Wir hören gerne zu«, sagt Markus Hatzer im Interview. »Und wir möchten auch Themen wie Trigger-Warnungen diskutieren – vielleicht stehen die im nächsten Jahr auf manchen Büchern? Wir halten das im Sinne einer Empathie für jene Leute, die es eh nicht so leicht haben, für sinnvoll. Hier ›Zensur!‹ zu rufen, verkennt, worum es geht.« Schließlich könne kein*e Buchhändler*in alle Neuerscheinungen lesen, weshalb es ihm sinnvoll dünke, wolle man bewusst und aus Überzeugung keine Inhalte einschränken, am Cover mancher Bücher klarzumachen, dass darin vielleicht ein Thema angesprochen werde, welches für manche Menschen in manchen Lebenssituationen nicht stimmig sei, und Markus Hatzer nennt als Exempel die Oma mit der Herz-OP und den Roman, in dem unter anderem eine Vergewaltigung vorkomme. Ein plakatives Beispiel, zugegeben; aber eines, das gut illustriert, worum es ihm geht. »Man könnte es auch ›inhaltlicher Hinweis‹ nennen.« Und es müsste nicht auf dem Cover sein, es ließe sich auch zur Impressums-Seite hinzufügen: »Die aufgeregte Diskussion über Trigger-Warnungen im Umfeld der IG-Autor*innen macht sehr deutlich, wie verkorkst unsere Branche denkt, wie unfrei man in Gedanken ist. Dass man es gar nicht diskutieren kann! Sondern gleich ›Ungeist‹ oder ›Zensur‹ geschrien wird, bloß weil einer einen Gedanken äußert. Diese Diskussion ist sehr erhellend, wie es in unserer Branche zugeht und wie ängstlich manche Leute sind, dass sie Einfluss, Definitions- und Deutungshoheit verlieren. Es ist schon auffallend, wie sich da ältere Herren sehr massiv einschalten. Deshalb sage ich jetzt auch immer ›die verkorkste Literaturbranche‹: Weil ich es so erlebe!«
Neue Wege zu gehen, das ist also nicht nur, wie Anna Jung meint, schwierig oder wie Ralph Klever befürchtet in der Experimentierphase nachteilig, es bringt auch eine Menge Unken quäkend auf den Plan. Um die kommt man nicht herum. Ihr Lied des Zweifels gilt es zu bedenken, wenn es argumentativ begründet wird, doch wenn es einzig der Abwehr oder des Neides wegen erschallt, gelassen darüber zu lächeln. Nicht jede*r muss deswegen im ewigen Gestern verharren.
Ich weiß noch gut, wie ich 2001 über frauenliebende Frauen und Transgender schrieb, weil ich die Zeit schlicht für reif hielt, und man sich alsdann in zahllosen Verlagen und Literaturzeitschriften von einem Tag auf den anderen weigerte, diese Arbeiten zu publizieren, mir eine Veranstalterin zurückschrieb: »Solchen« – dreifach unterstrichen – »Themen geben wir kein Forum!« Die schwulen Jungs hingegen, die schienen bereits um 2010 akzeptabel. Glücklicherweise hat Respekt und Billigung für andere Lebensformen zwanzig Jahre später ein wenig an Breite gewonnen, denkt sich unsere Gesellschaft nicht mehr ganz so eng. Immerhin. Und Langmut braucht jede*r in dieser Branche.
Neue Wege zu gehen, vielleicht auch einmal damit zu scheitern, das halte ich für ganz essenziell im literarischen Feld: Ohne diesen Geist könnten wir auch frühere Werke schlicht in den Scanner legen und uns als Ebner-Eschenbach, Paoli oder Mayreder, Bachmann und Haushofer gefallen …
Wegen Gegenwinds aus einer Richtung sollte man noch nicht unbedingt die Route ändern. Auch das Team des Haymon Verlags machte diese Erfahrung: »Dass viele dieser Themen kontrovers diskutiert werden, das ist normal, aber das ein so großer Bruch zwischen den Generationen hindurch geht, das hätte ich nicht erwartet. Sehr viele Ältere, nicht nur Männer, auch Frauen, sind gegen das Duzen, gegen Trigger-Warnungen, gegen Diversifizierung – das muss man wirklich so sagen. Das ist eine interessante Erfahrung, über die ich viel nachdenken muss; und die mich auch so sicher macht, dass wir am richtigen Weg sind.« Insbesondere auch der enormen Zustimmung jüngerer Menschen wegen. »Das ist einfach auch ein Zeichen des Generationswechsels, denke ich. Mit manchen unserer Veränderungen sind wir für andere Leute eine Provokation. Da kommen schnell Argumente wie: ›Das zerstört die Literatur.‹ Ich lache dann immer, und sage: Die Literatur zerstört gar nichts. Nach meinem Empfinden, gibt es Literatur seit Menschen sprechen können – oder vielleicht sogar schon früher! Aber nichts hat bis jetzt je die Literatur zerstört, die ist stärker als wir alle zusammen. Wenn wir aber als kleinerer Literaturverlag in 5, 10 Jahren noch Relevanz haben wollen, dann müssen wir uns verändern. Und das werden andere auch noch machen. Nicht auf die gleiche Art wie wir. Aber: sich verändern.«