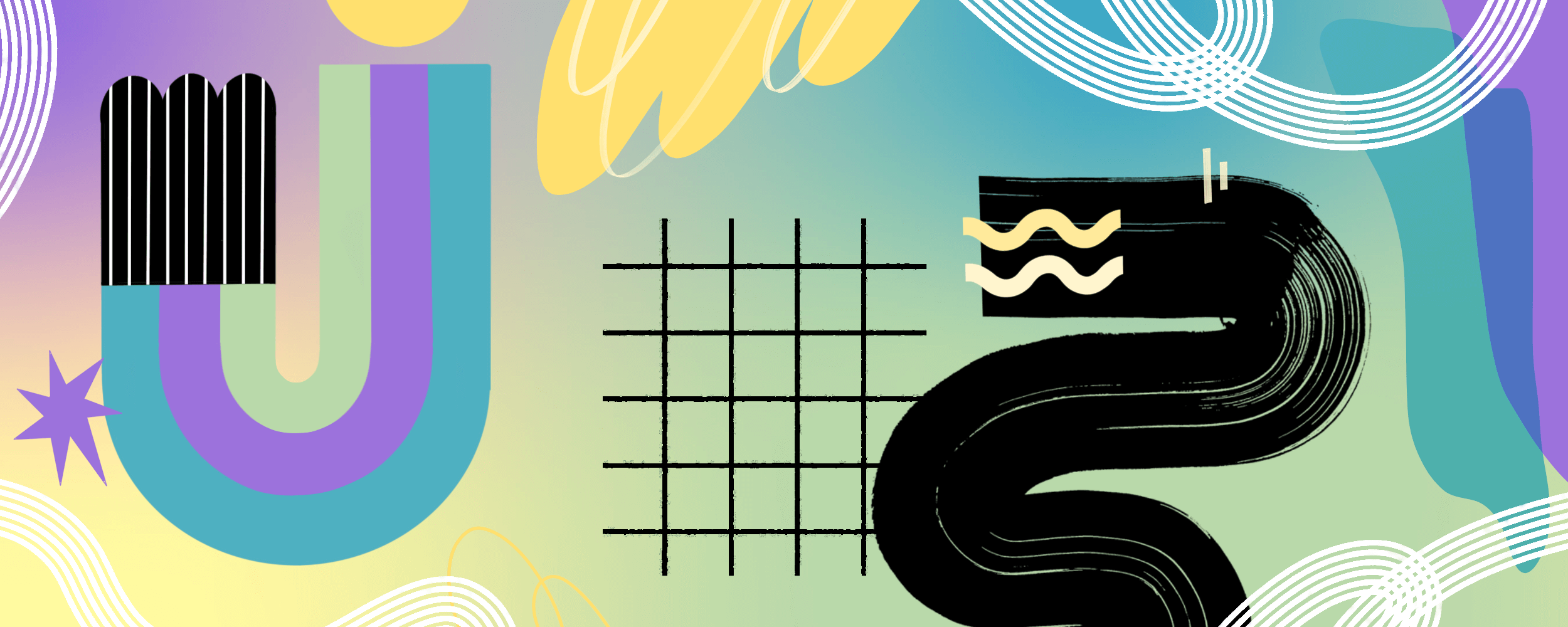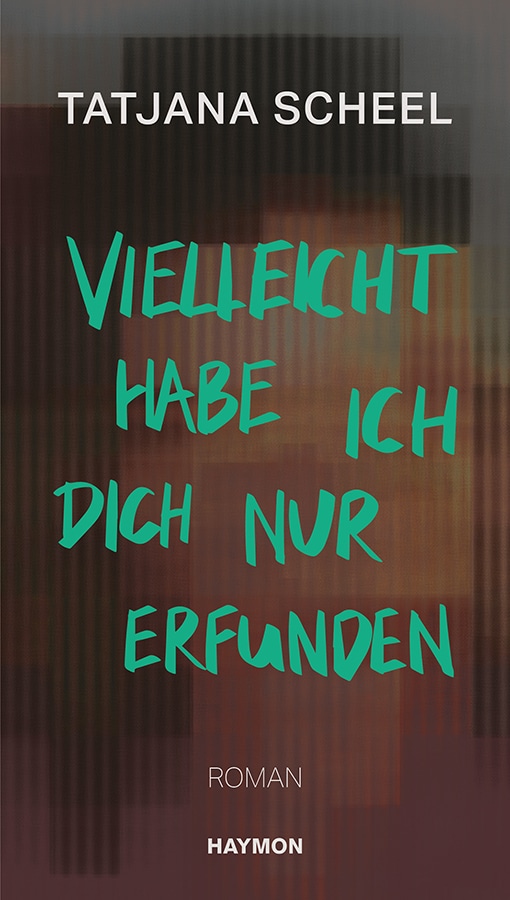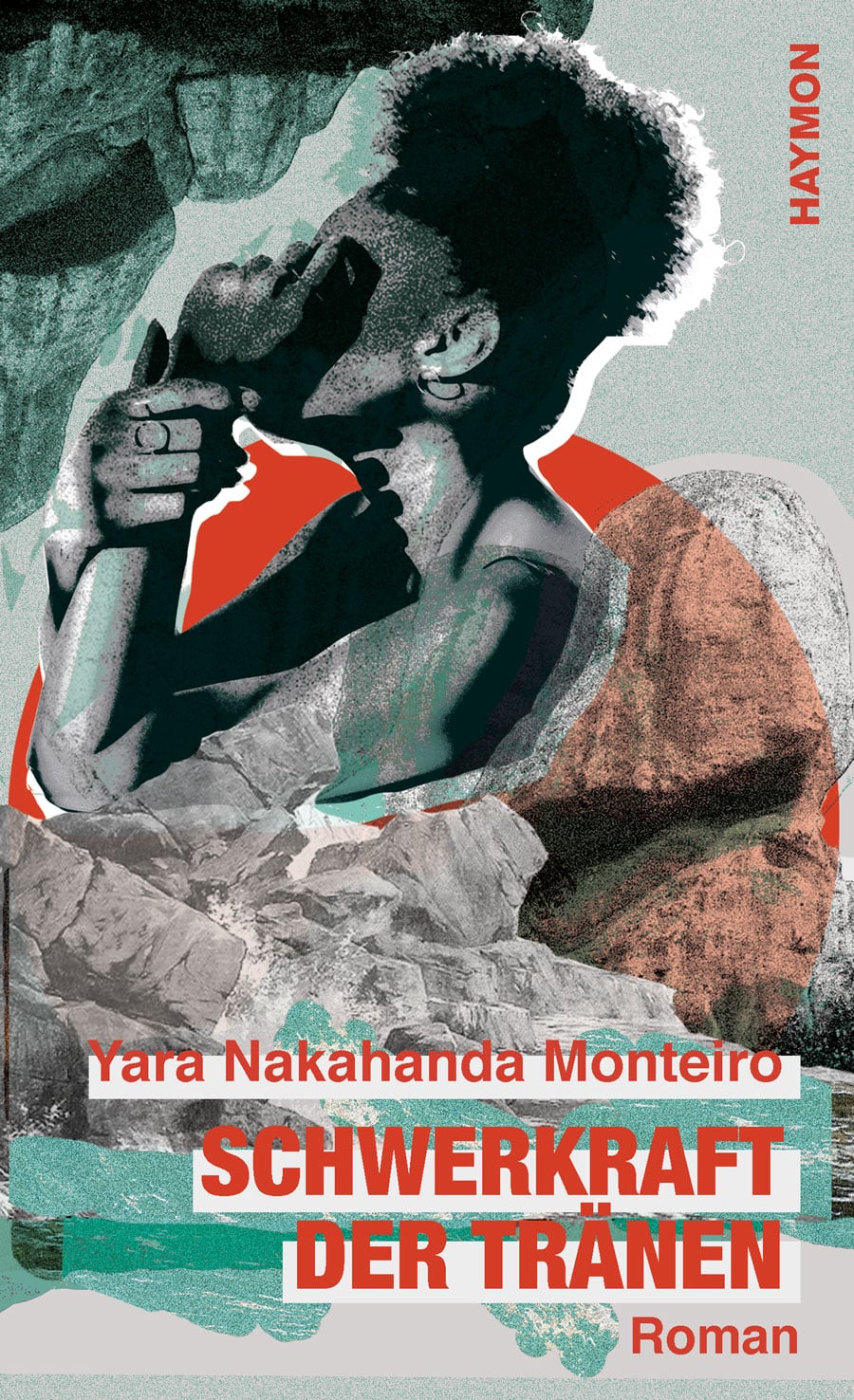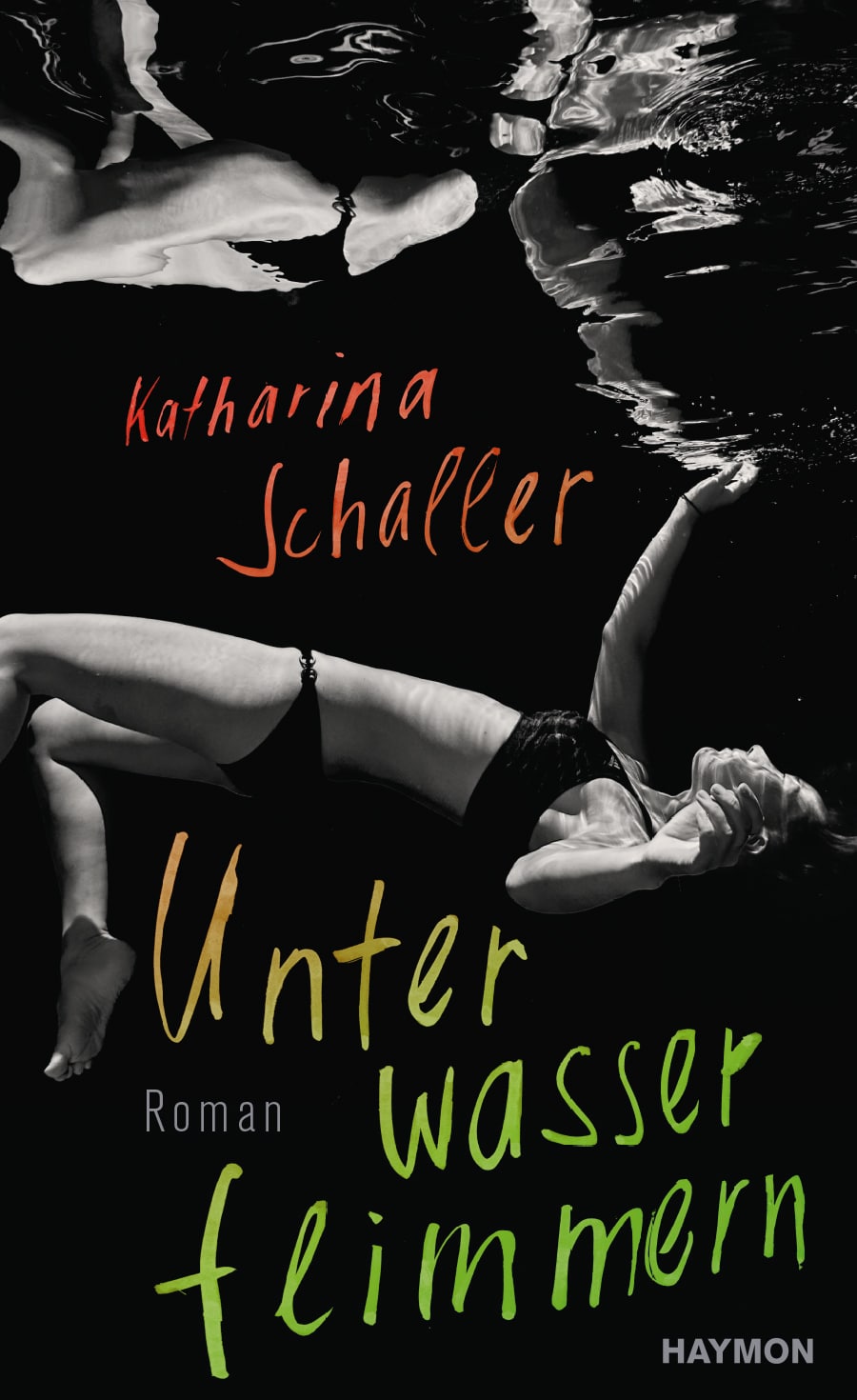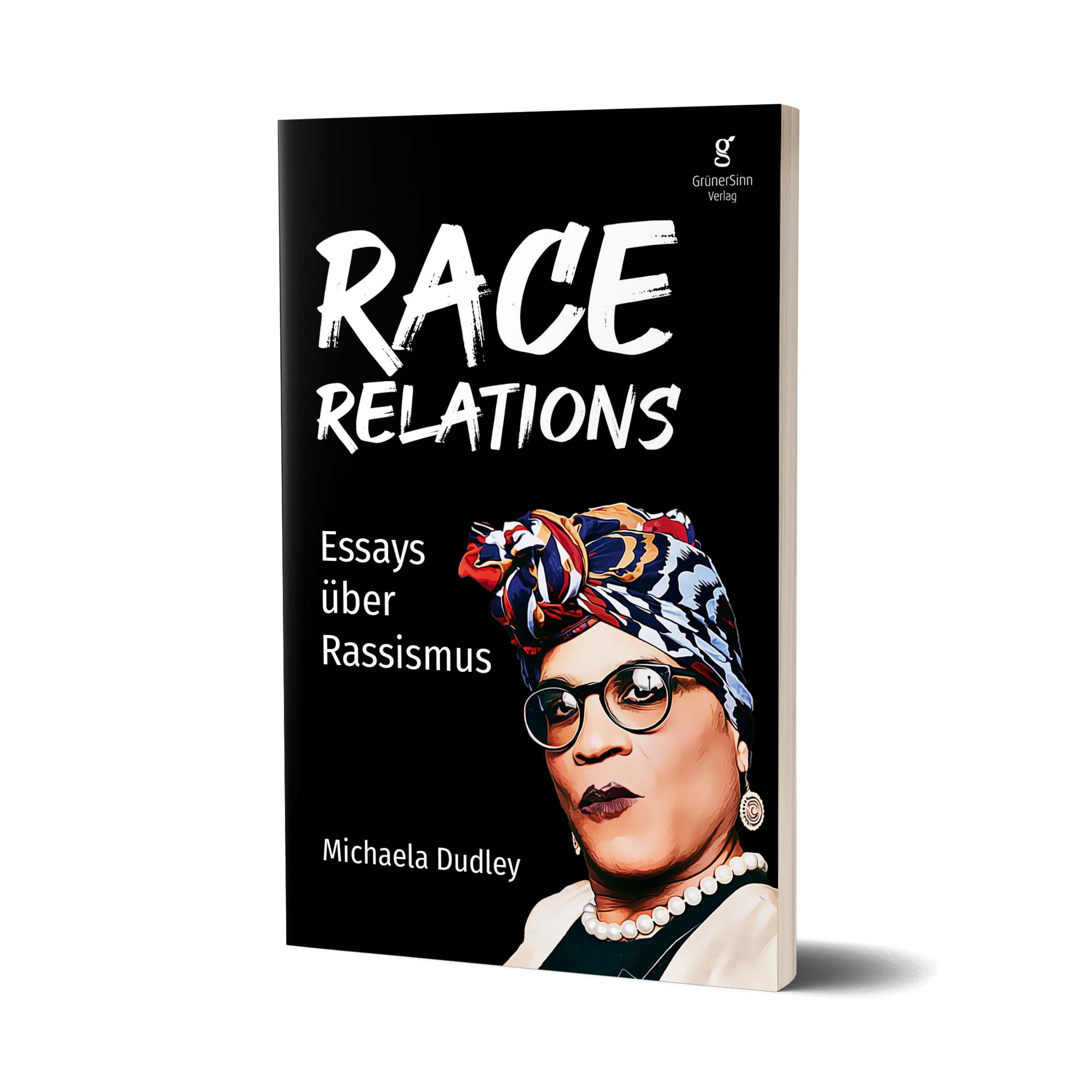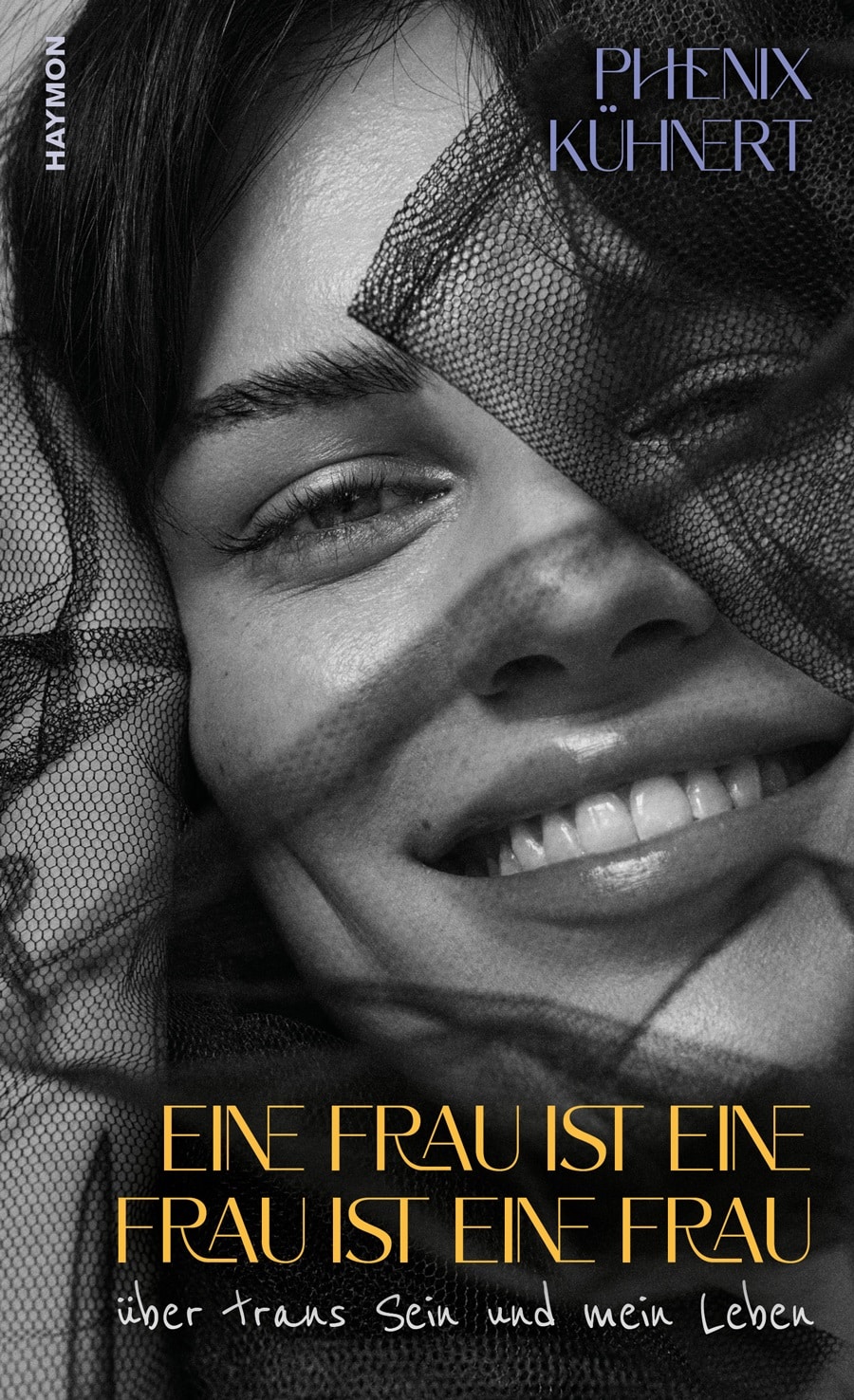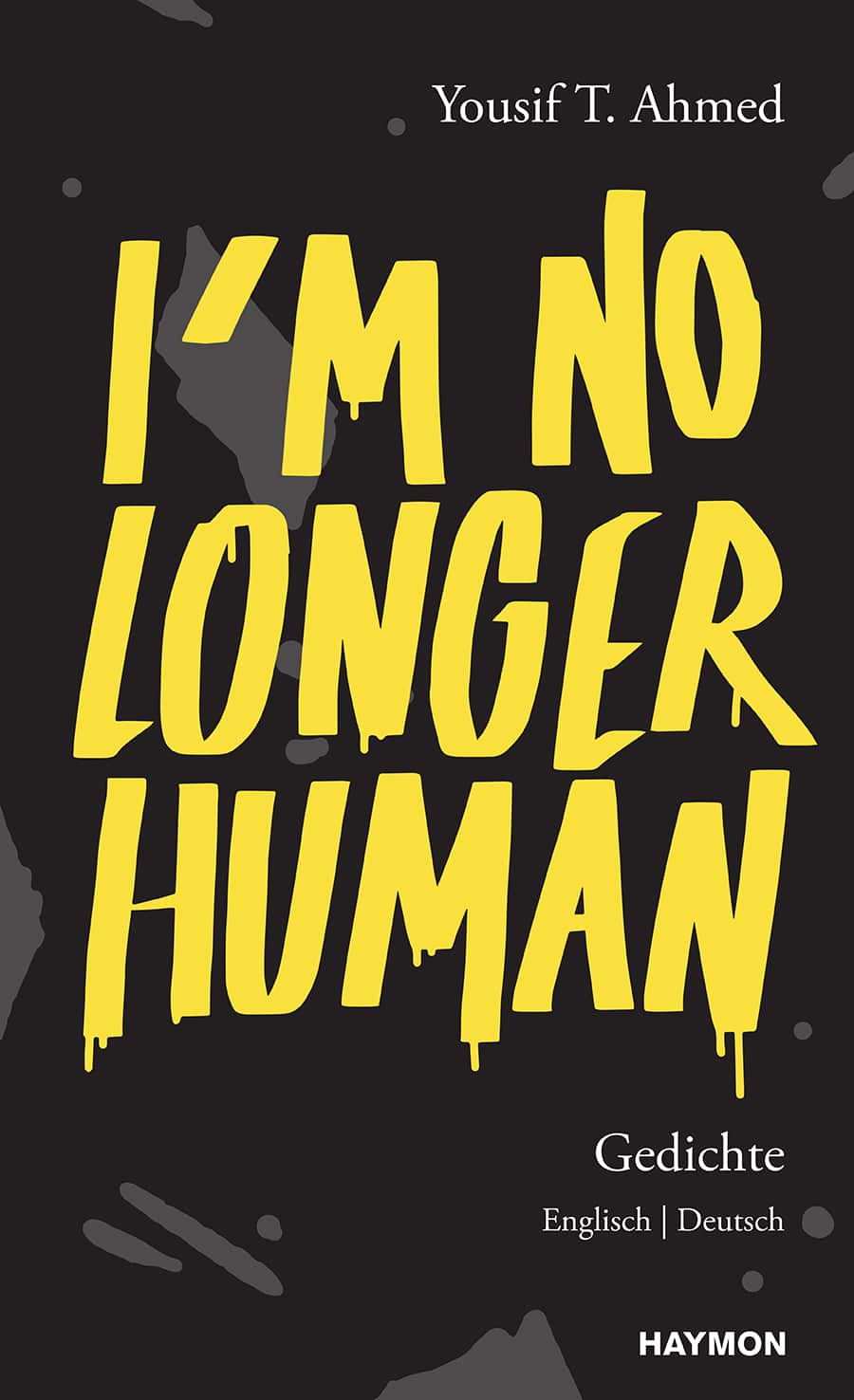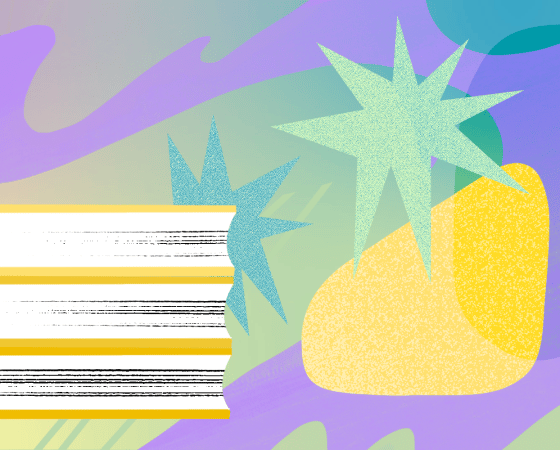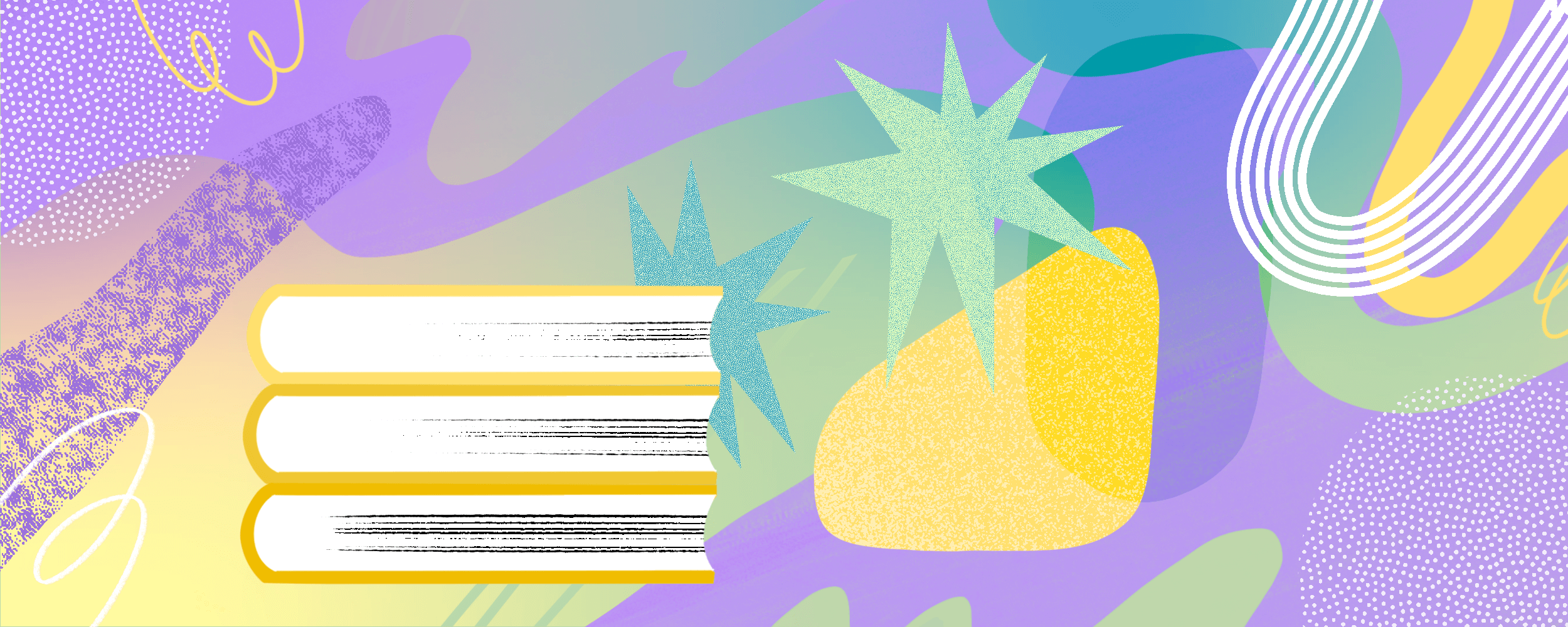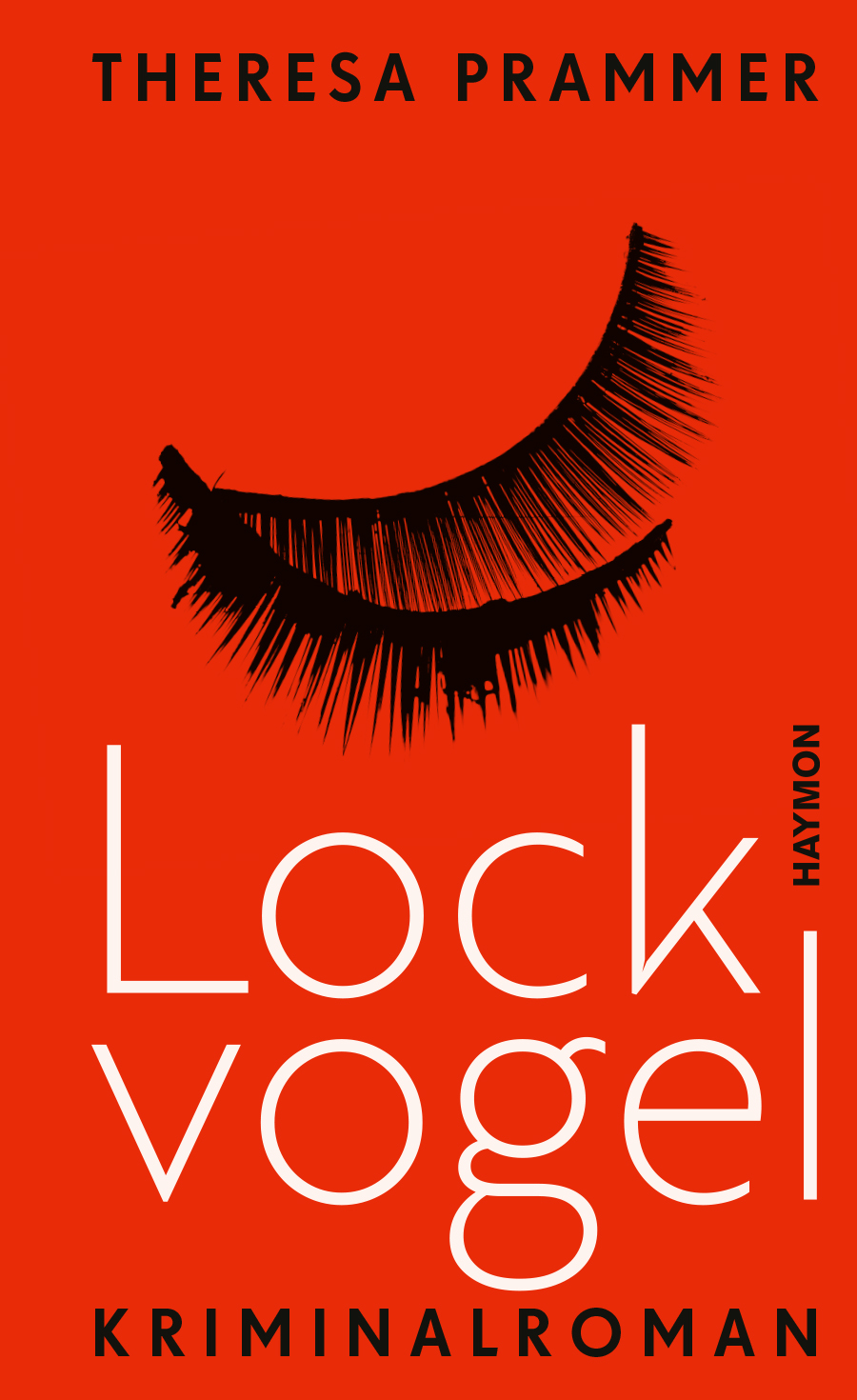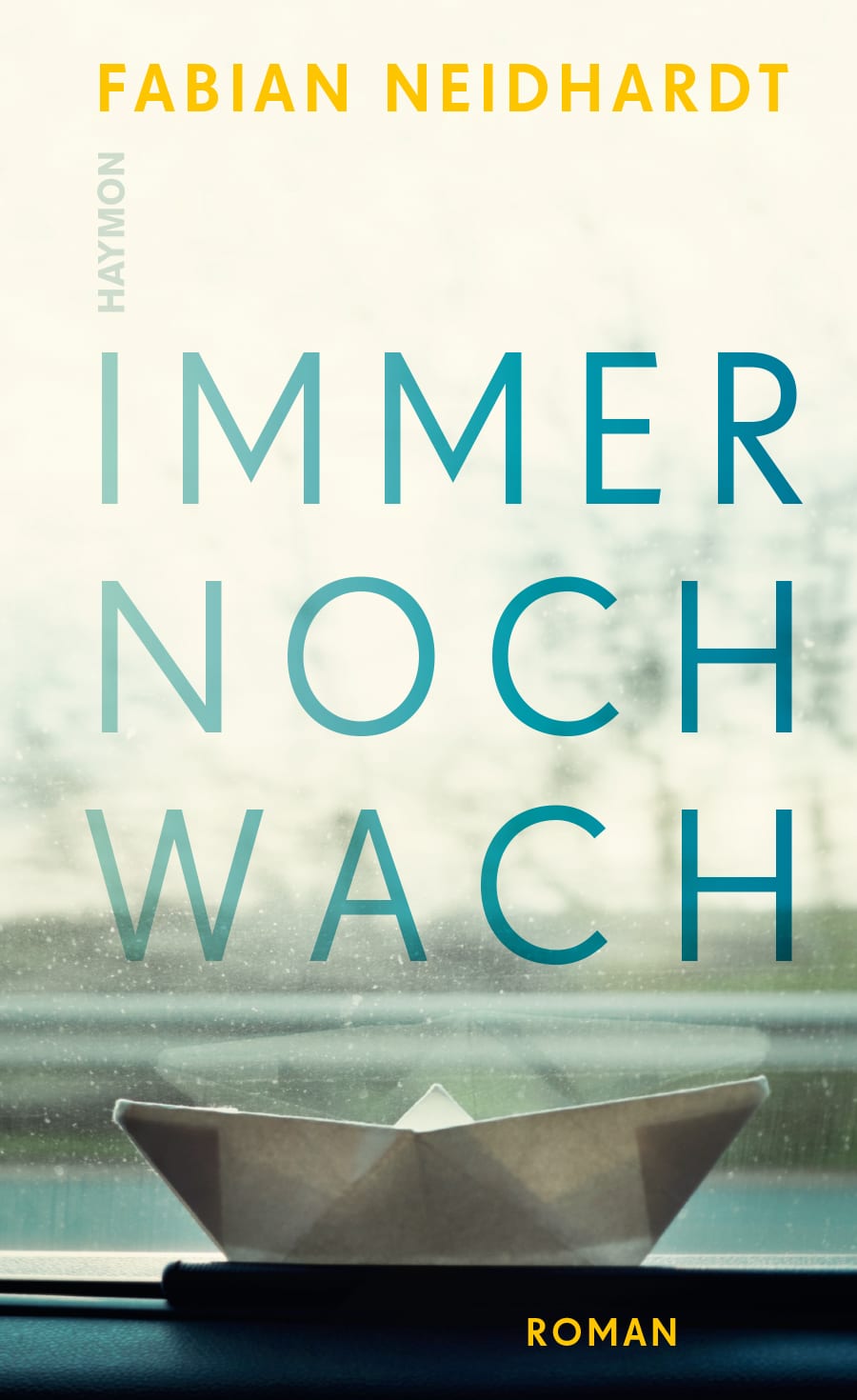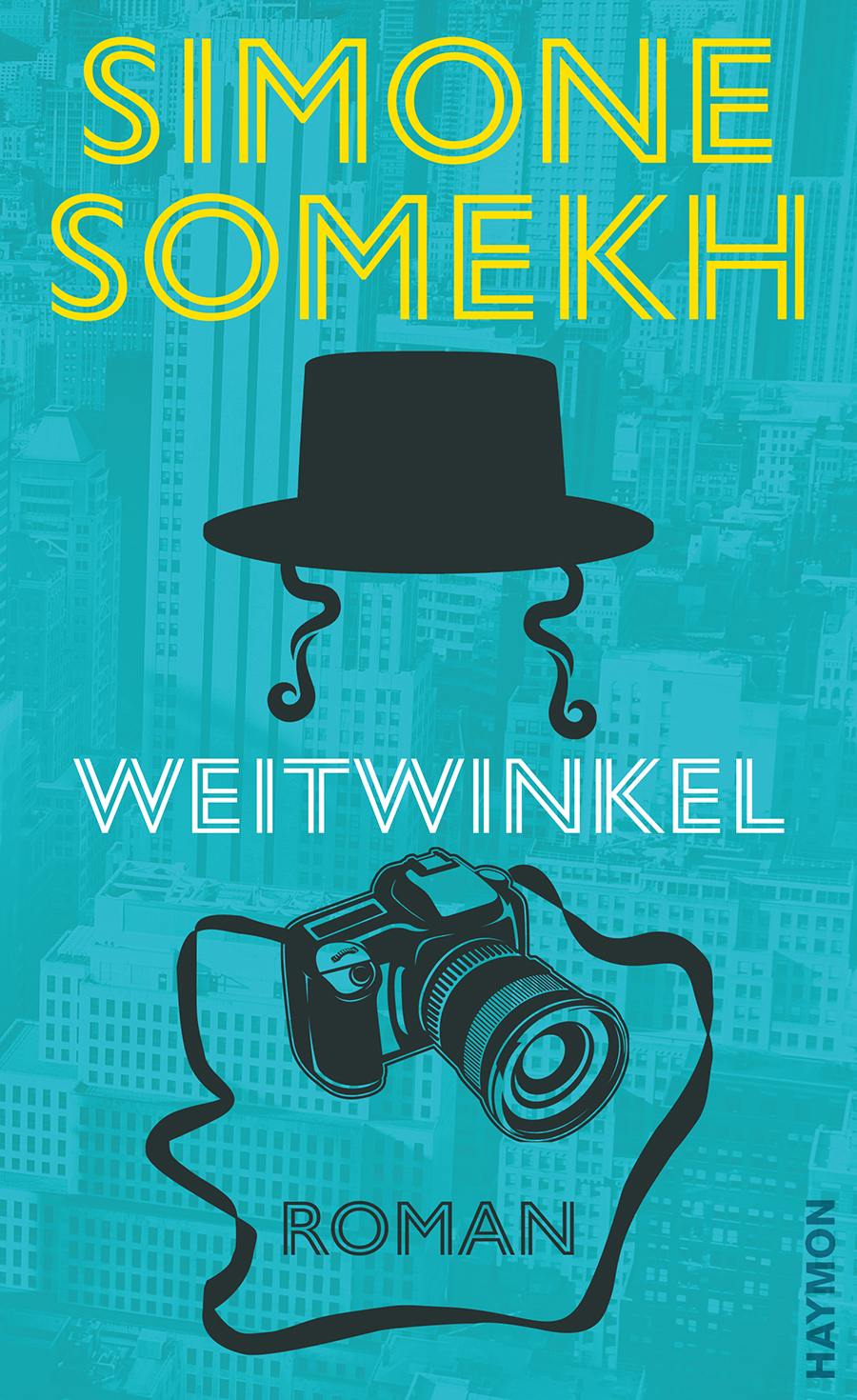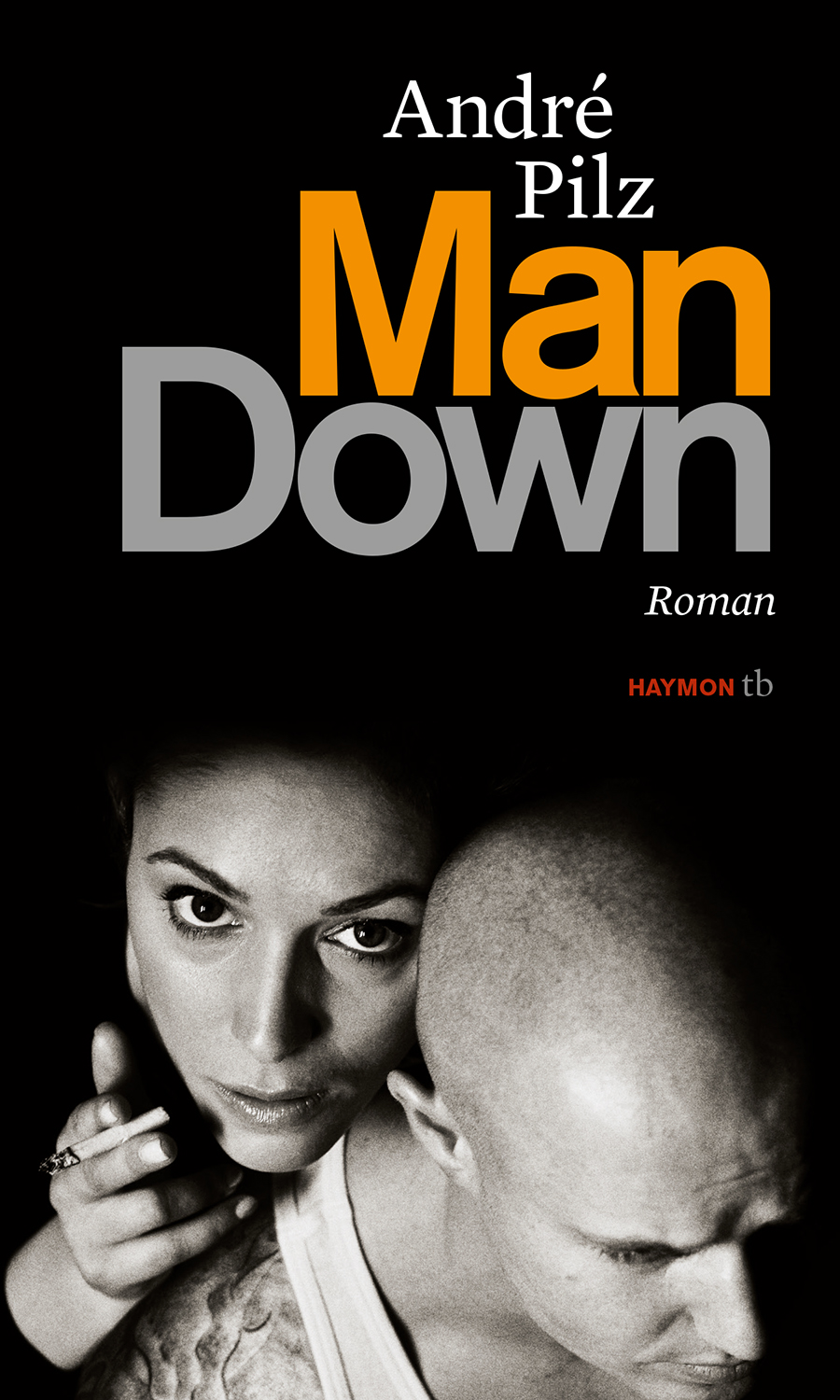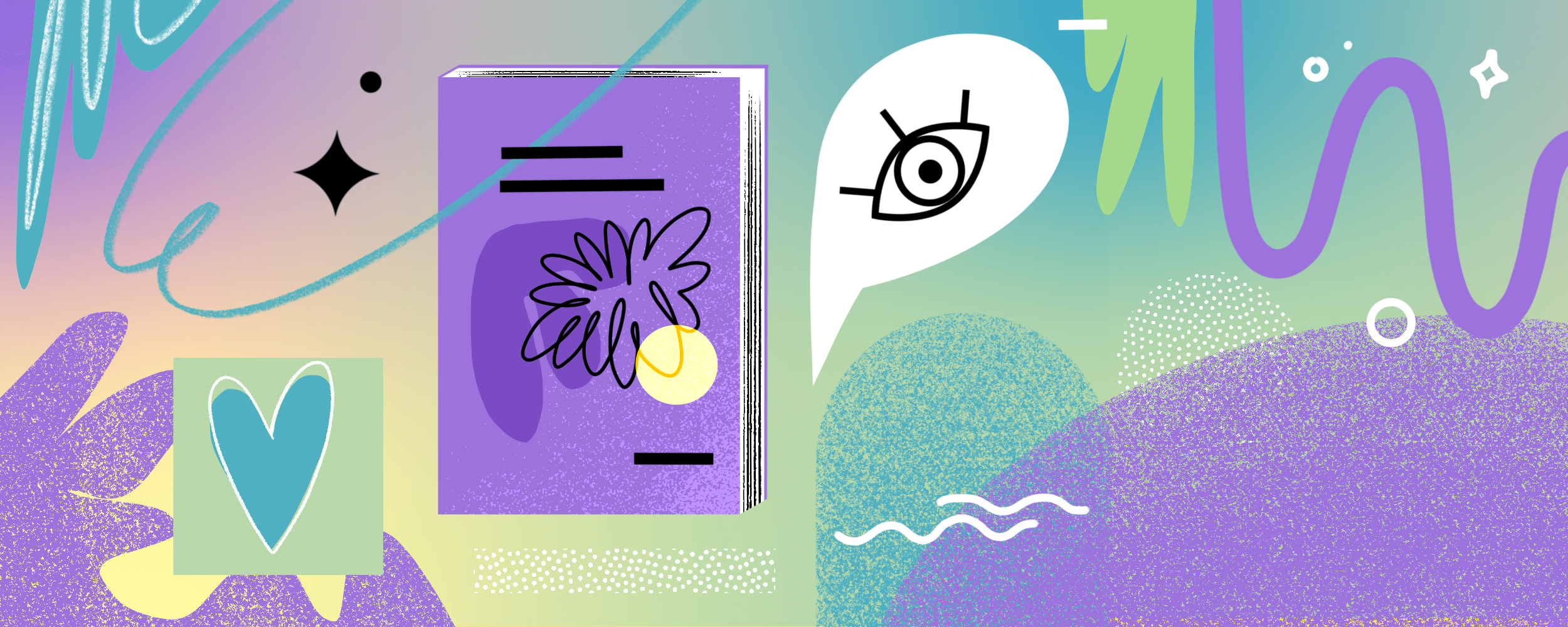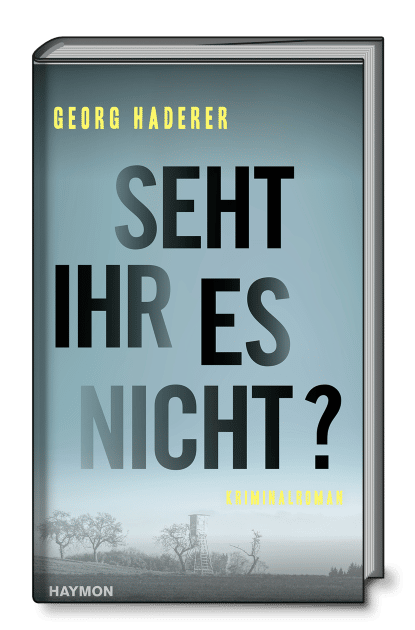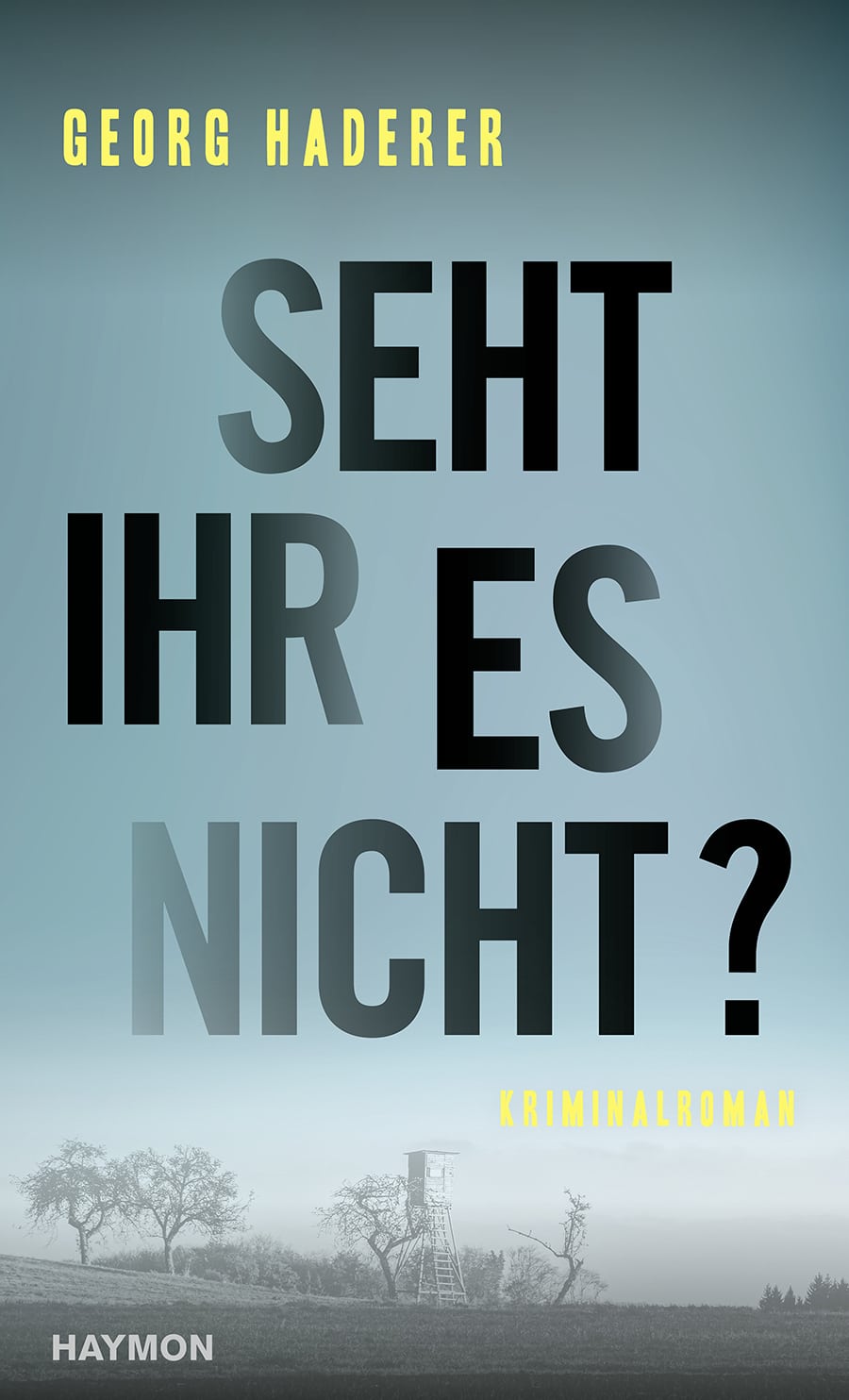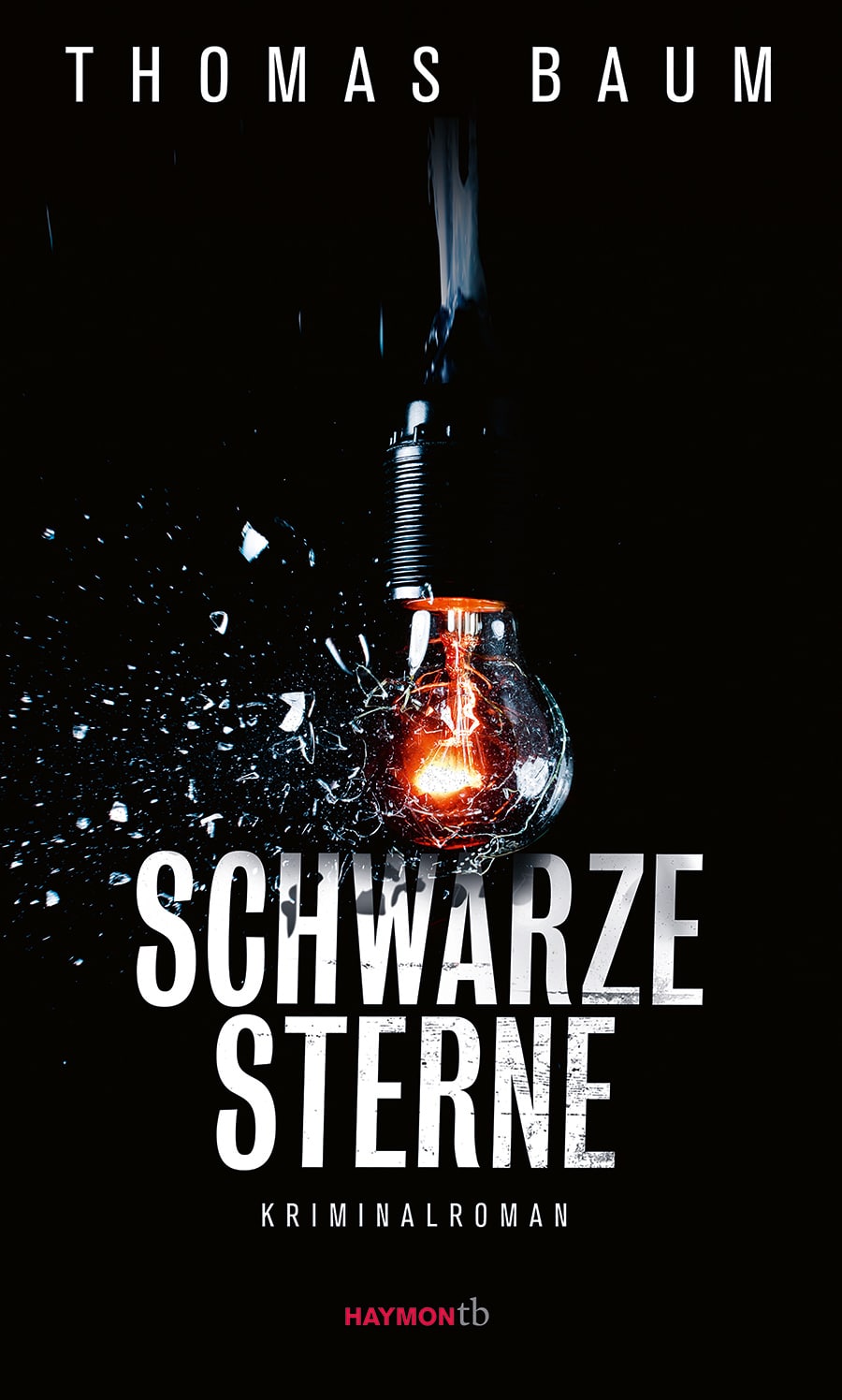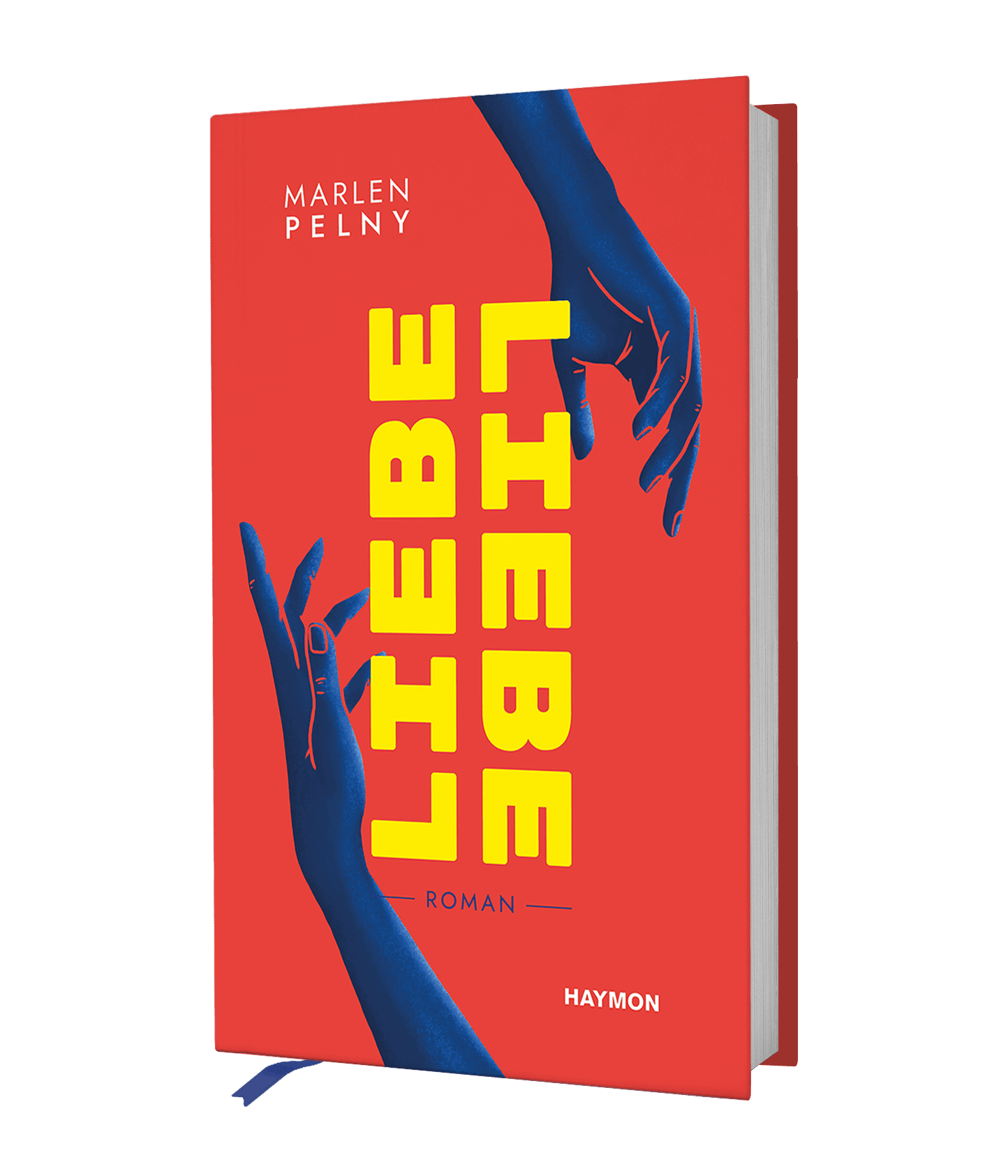„In meinen Augen ist Humor auf jeden Fall ein besserer Ratgeber als Angst.“ – Tatjana Scheel im Interview zu ihrem Roman
Wo hört Liebe auf? Und wo beginnt die Selbstaufgabe? – Diese Fragen stehen im Zentrum von Tatjana Scheels Roman „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“. Darin treffen die beiden jungen Frauen Alex und Sheela unter der Sonne Siziliens zufällig aufeinander. Die beiden sind wie zwei Planeten, die sich auf ihren Umlaufbahnen näherkommen, aber doch immer wieder voneinander entfernen. Die nicht ohne, aber auch nicht miteinander können. Nina Gruber hat sich mit der Autorin über Formen von und Mut zur Liebe, über Sehnsucht, Projektion und Humor unterhalten.
Im Zentrum von „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“ steht Alex. Wer ist sie?
Alex geht es wie vielen: Da sie selbst nicht weiß, wer sie ist, versucht sie es herauszufinden, indem sie alles Mögliche ausprobiert und in die Extreme geht, um zu verstehen, was sich für sie richtig und authentisch anfühlt. Wenn ich an sie denke, fällt mir sofort das Wort Ambivalenz ein.

Tatjana Scheel lebt als Drehbuchautorin und Schriftstellerin in Berlin und wird von dem Wunsch angetrieben, komplexe Themen mit Leichtigkeit zu erzählen. In ihrem Debütroman „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“ erzählt Tatjana Scheel von den Unwägbarkeiten menschlicher Beziehungen. – Foto: Mike Auerbach
Alex ist in fast allen Bereichen ihres Lebens ambivalent. Einerseits sehnt sie sich nach Liebe und Nähe, andererseits hat sie genau davor die größte Angst. Auf der einen Seite ist sie schüchtern und extrem (selbst-)unsicher, auf der anderen Seite ist sie aber auch abenteuerlustig, temperamentvoll und sehr offen. Im Laufe ihres Lebens wird ihr jedoch immer klarer, wer sie wirklich ist, wer sie sein möchte und worauf es für sie ankommt.
In deinem Roman geht es um vieles, ganz intensiv aber setzt du dich darin mit der Liebe auseinander. Mit ihrer schöpferischen und zerstörerischen Kraft, mit den Sehnsüchten, die wir mit diesem Begriff und diesem Gefühl verbinden. Welche Farben der Liebe finden die Leser*innen in deinem Roman vor?
Alex fehlt es, wie meiner Meinung nach den meisten Menschen, an Selbstliebe (im Sinne von Selbstwertschätzung und Selbstakzeptanz), weshalb sie auch nicht in der Lage ist, eine andere Person wirklich zu lieben. Bei dem, was sie für Sheela empfindet, geht es vor allem um eine starke Anziehung, um Leidenschaft, Abhängigkeit und um das Verliebtsein, nach dem Alex so süchtig ist. Sie liebt nicht unbedingt Sheela, sondern das Gefühl, das diese in ihr auslöst. Das Gefühl, gesehen zu werden und endlich sie selbst sein zu können. In Sheelas Anwesenheit fühlt Alex sich schöner, stärker, größer und mutiger als sonst. So ist das doch meistens, wenn wir uns verlieben. Wenn wir ehrlich sind, geht es uns dabei viel mehr um uns selbst als um die andere Person, die wir kaum kennen und auf die wir alle möglichen wunderbaren Dinge projizieren, die mit der Realität wahrscheinlich nur wenig zu tun haben. Trotzdem ein tolles Gefühl …
Welche Rolle spielt „Familie“ in deinem Buch?
Die Figuren in meinem Roman haben alle keine Familien, die ihnen großen Halt geben, weshalb sie alle in irgendeiner Form auf der Suche nach Ersatzfamilien sind. Vor allem natürlich Alex, über deren Eltern wir wenig bis gar nichts erfahren und von der wir nur ihren exzentrischen Onkel kennenlernen. In dieser Geschichte geht es also eher um die Abwesenheit von Familie und darum, wie sich das auf die Heranwachsenden auswirkt. Es geht um bestimmte Bindungsmuster, die meistens von einer Generation auf die nächste übertragen werden – wenn es dieser nicht gelingt, sie bewusst zu durchbrechen.
In deinem Roman liegen Spannung, Verzweiflung und Witz so nah beieinander, wie Liebe und Obsession in Alex’ und Sheelas Geschichte. Es gibt einiges, worüber die Figuren verzweifeln können, aber beim Lesen selbst gerät man als Leser*in ziemlich oft ins Schmunzeln. Welche Rolle spielt der Humor in deinem Schreiben?
Wenn ich meinen Fokus darauf richte, wie grausam Menschen sein können, entsteht bei mir eine ziemlich pessimistische Weltsicht, die mich in erster Linie lähmt. Daher bin ich nur selten in der Stimmung, Bücher zu lesen (oder zu schreiben), die so schwer und melodramatisch sind, dass ich danach tagelang traurig bin. Wenn ich mir hingegen bewusst vor Augen führe, wie seltsam, absurd und komisch die Menschen sich teilweise benehmen, entsteht automatisch ein humorvoller Blick, der mir hilft, hoffnungsvoll zu bleiben. Und ich brauche diese Hoffnung!
Humor lässt mich erkennen: meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit, sondern nur eine Wahrheit, und ihr Gegenteil ist oft ebenso wahr. In meinen Augen ist Humor auf jeden Fall ein besserer Ratgeber als Angst, da er uns hilft, die Dinge mit etwas Abstand zu betrachten. Das bedeutet nicht, dass man sie nicht ernst nimmt, sondern dass man sich um einen umfassenderen Blick bemüht und sich dadurch weniger mit den eigenen Ansichten identifiziert. Ich denke, wenn wir über uns selbst lachen können (was mir bisher noch zu selten gelingt), macht uns das innerlich frei, und genau diese innere Freiheit brauchen wir, um glückliche und dadurch bessere Menschen zu sein.
„Vielleicht habe ich dich nur erfunden“ ist dein Debütroman, aber keinesfalls die erste Geschichte, die du erzählst. Du bist Drehbuchautorin. Wie hat sich das Schreiben eines Romans für dich angefühlt?
Sehr gut. Ich habe mich köstlich amüsiert. Außerdem habe ich es extrem genossen, endlich mal das schreiben zu können, was ich schreiben will, ohne dass mir permanent und von allen Seiten reingeredet wird.
Eine der zentralen Fragen des Romans lautet: „What is love?“ – Wie würdest du selbst diese Frage beantworten?

Liebe, oh je, ich könnte mir kein größeres Wort vorstellen! Liebe kann so vieles sein. Anziehung und Leidenschaft wie in Alex’ und Sheelas Fall, Vereinigung, aber auch Freundschaft, Mitgefühl und Fürsorge. Liebe kann eine Entscheidung sein.
Meine Idealvorstellung von der wahren Liebe kommt in unserer Gesellschaft eher selten vor, ist aber genau das, was ich mir für unsere Welt wünschen würde: eine Liebe, die bei sich selbst anfängt und dennoch selbstlos ist. Die an keine Bedingungen geknüpft ist und sich auf alle bezieht, nicht bloß auf ein paar wenige Auserwählte, die so sind wie wir und die die gleiche Meinung vertreten wie wir. Eine solche Liebe schließt auch die Tiere, den Planeten und die gesamte Schöpfung mit ein. Eine schöne Vorstellung …
Ist das Liebe? Oder kann das weg? – Tatjana Scheel schreibt über das überwältigende Gefühl, verführt und geführt zu werden. Sie schreibt über Projektion und Begehren, Kontrolle und Macht. Über die Notwendigkeit, die eigenen Bedürfnisse zu definieren und auszusprechen, über das Schälen aus der Abhängigkeit. Und über das Glück, nackt im Wald zu tanzen. – Hier gelangst du zu Tatjana Scheels Roman „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“.