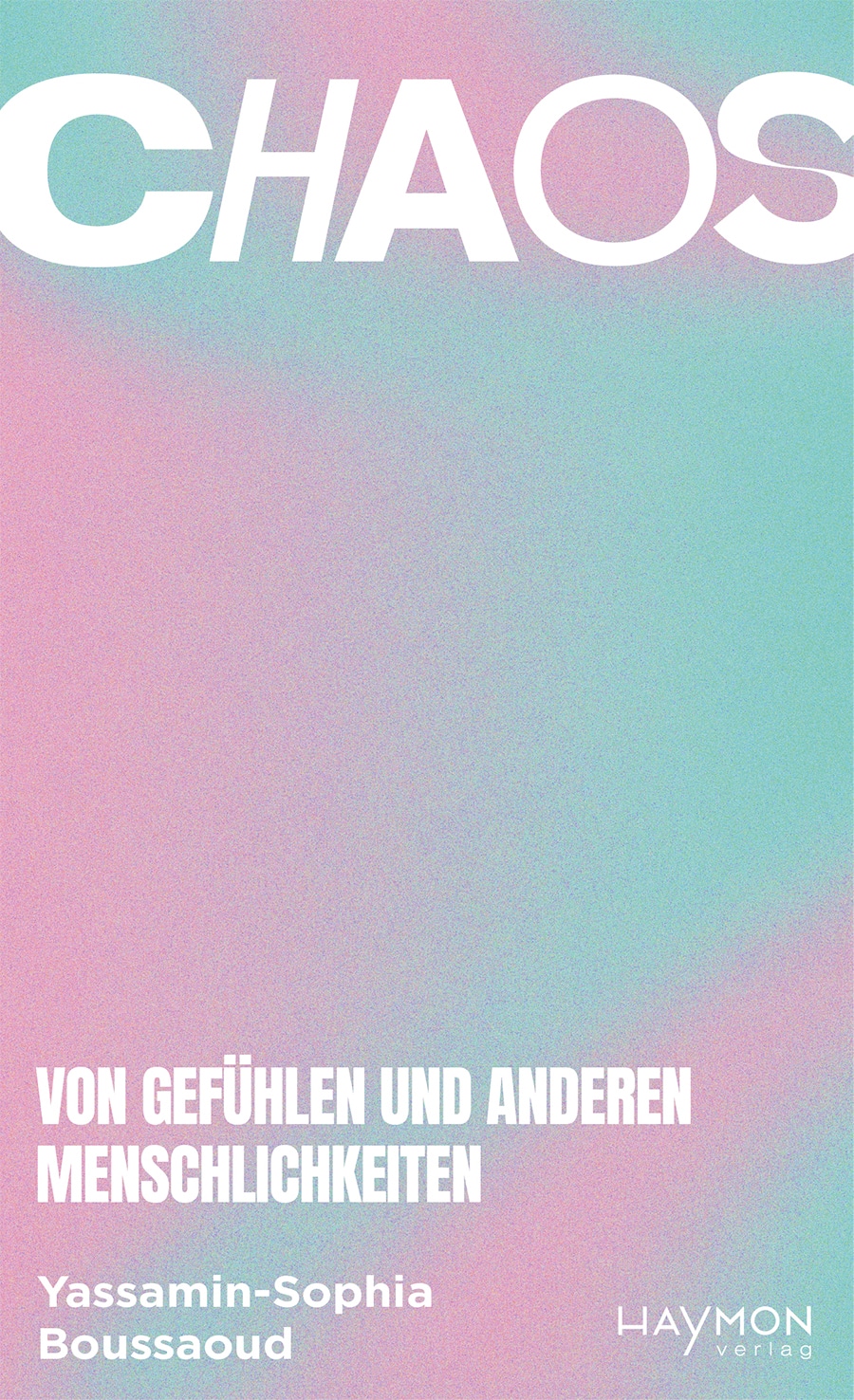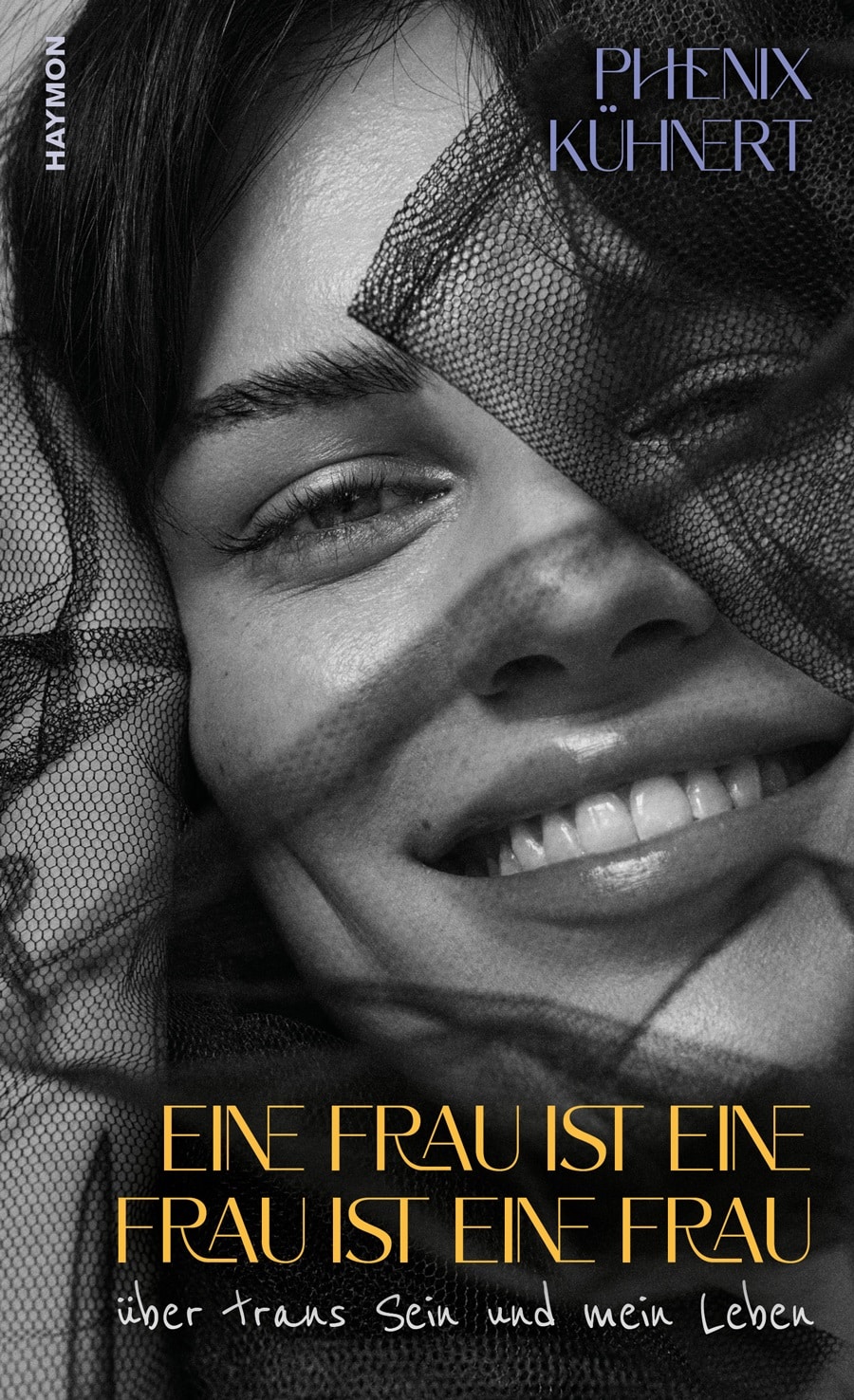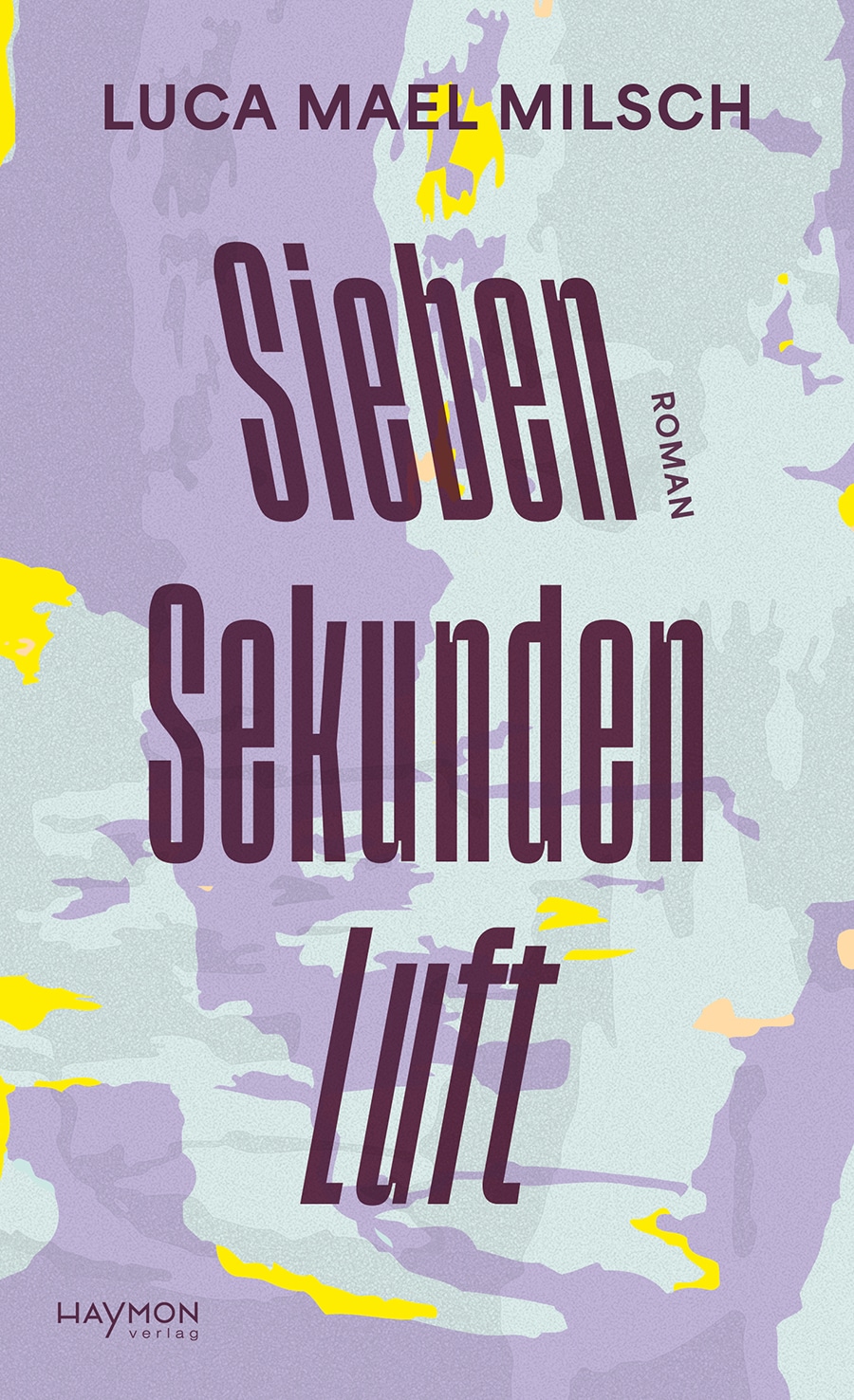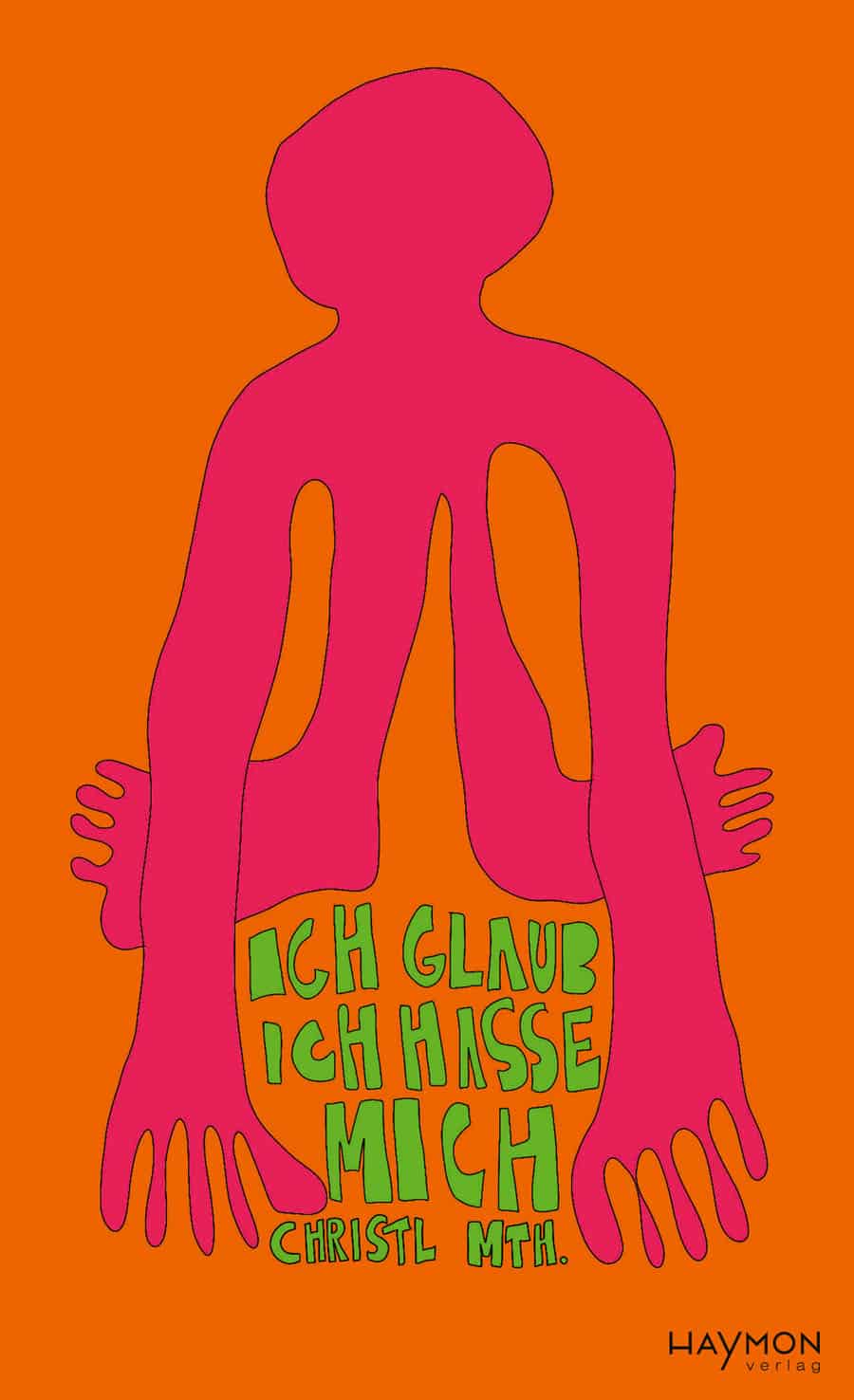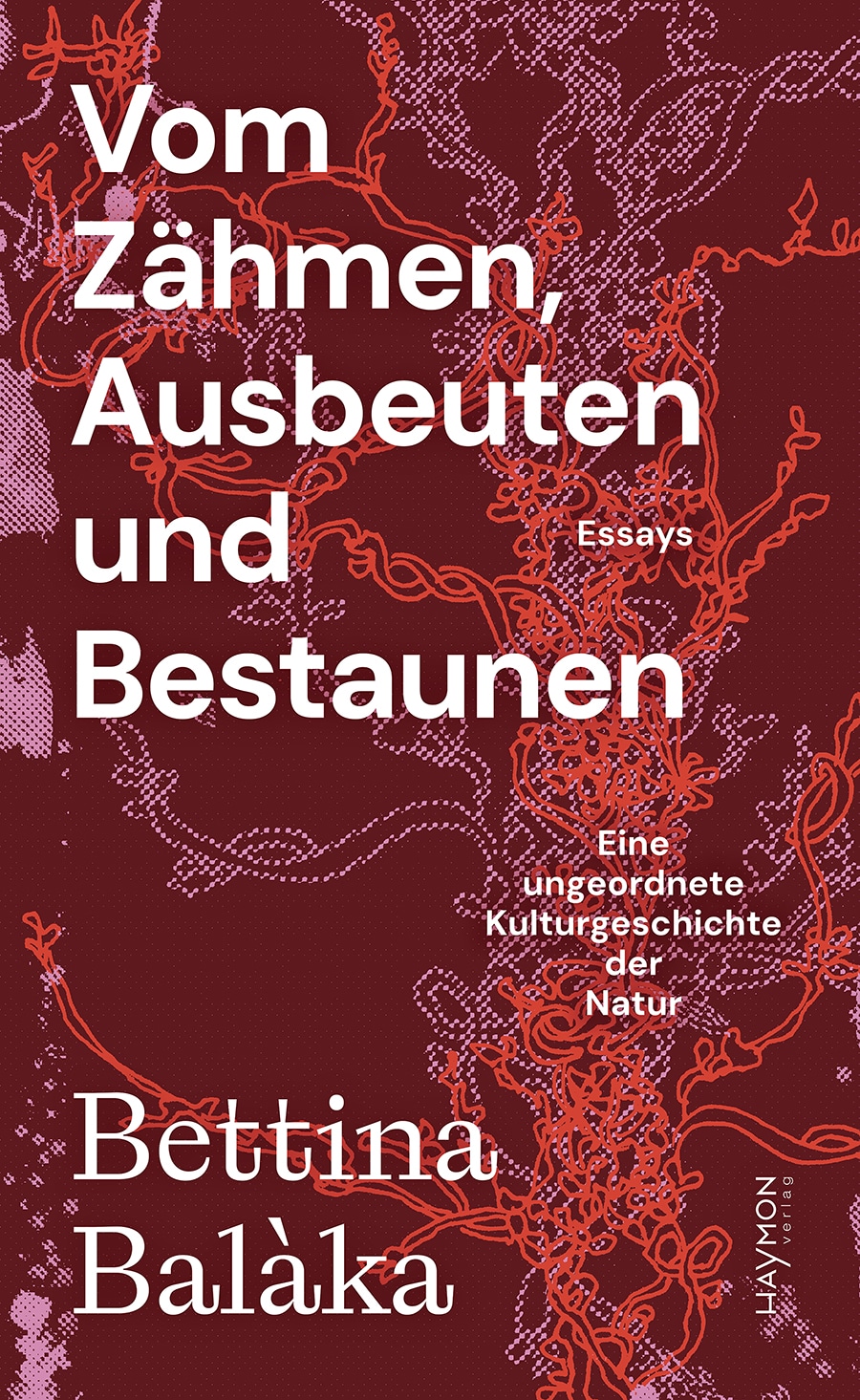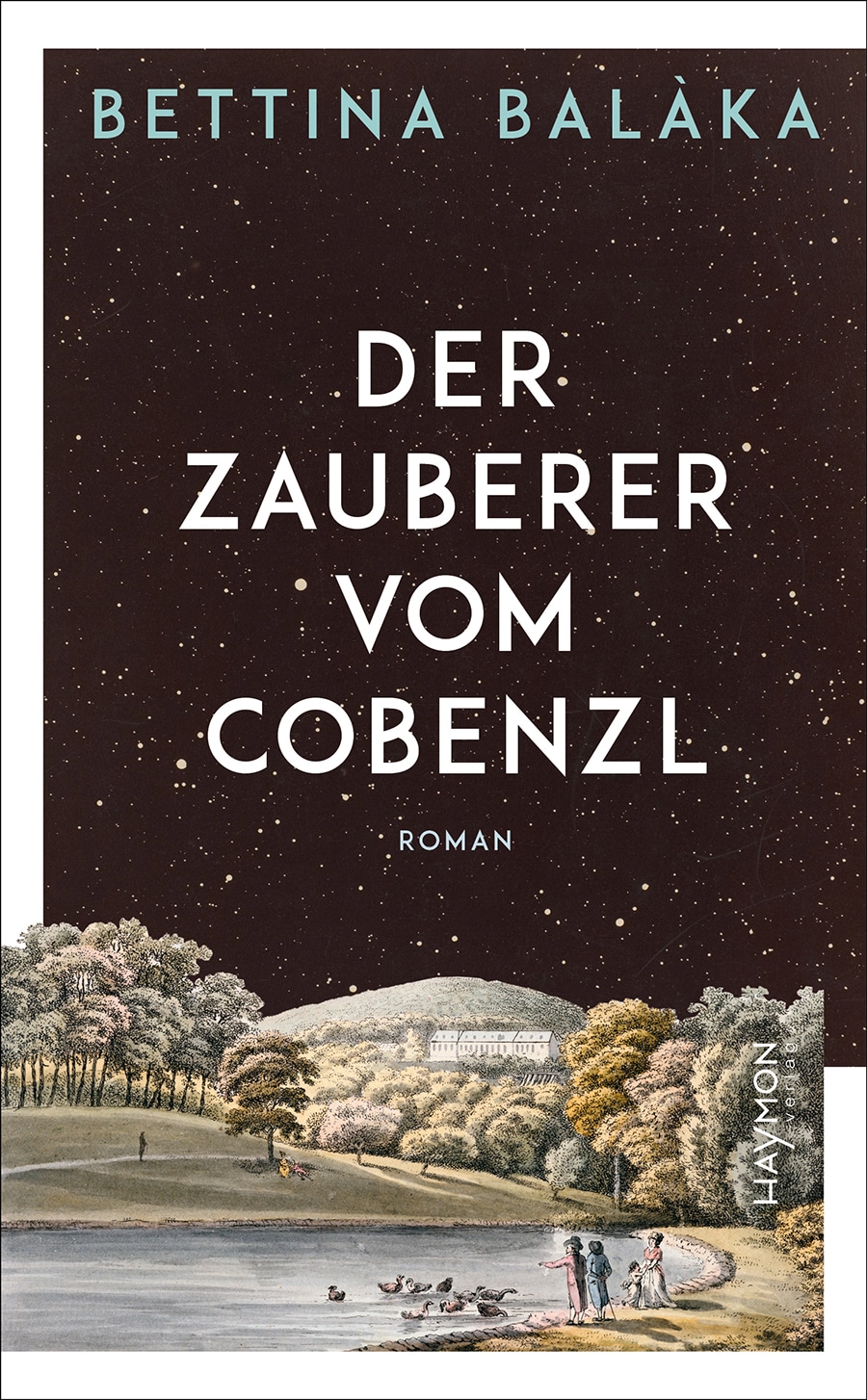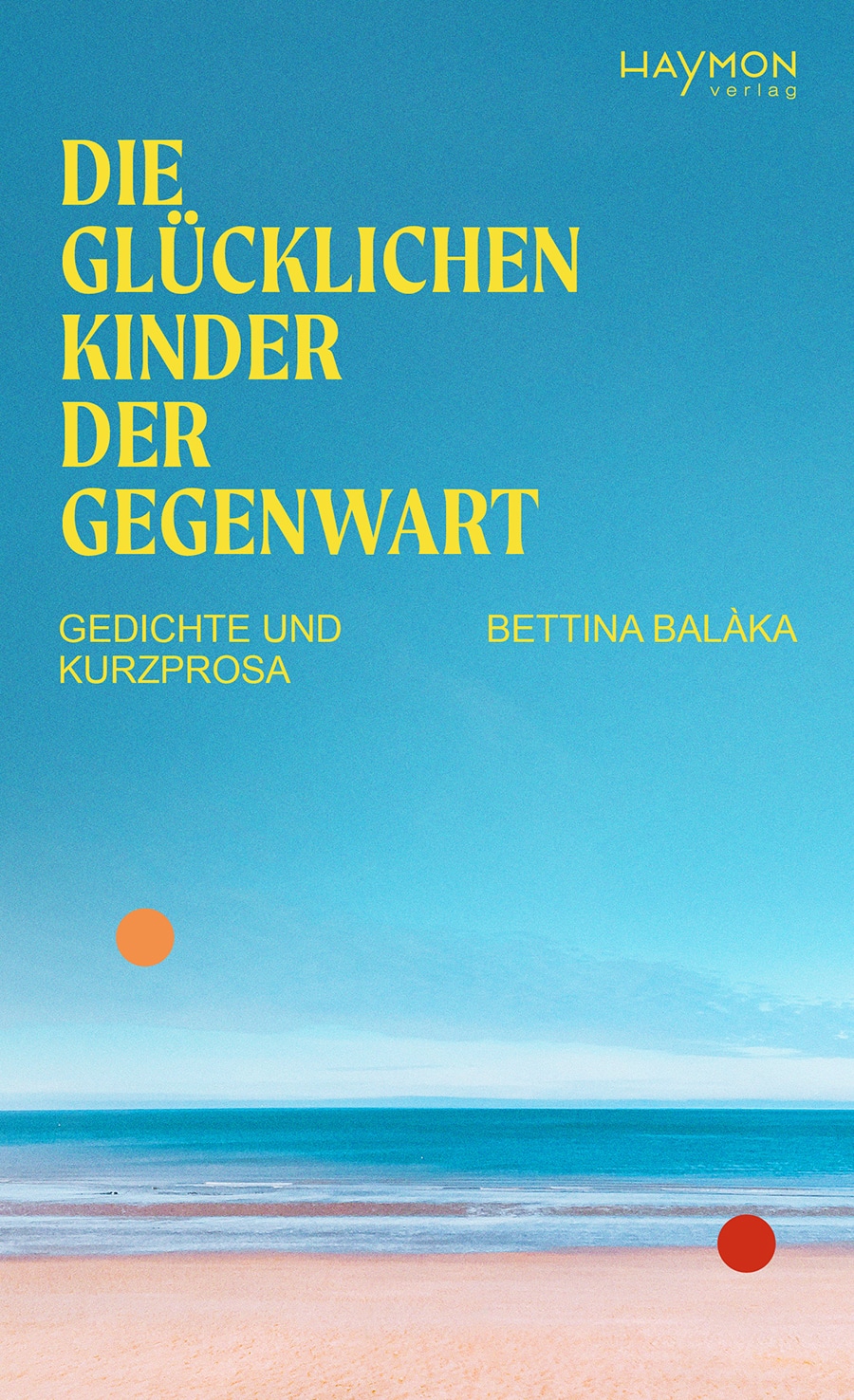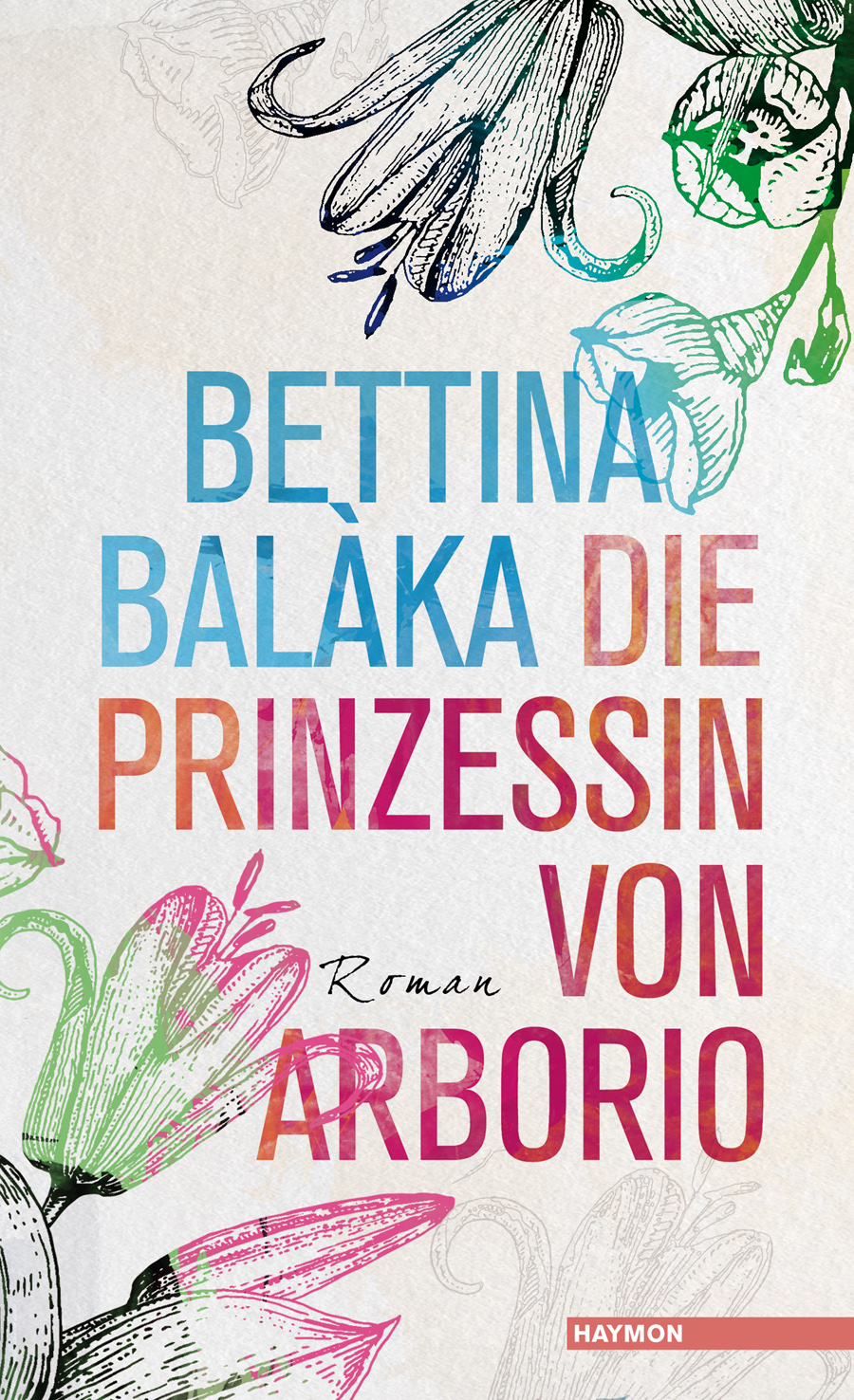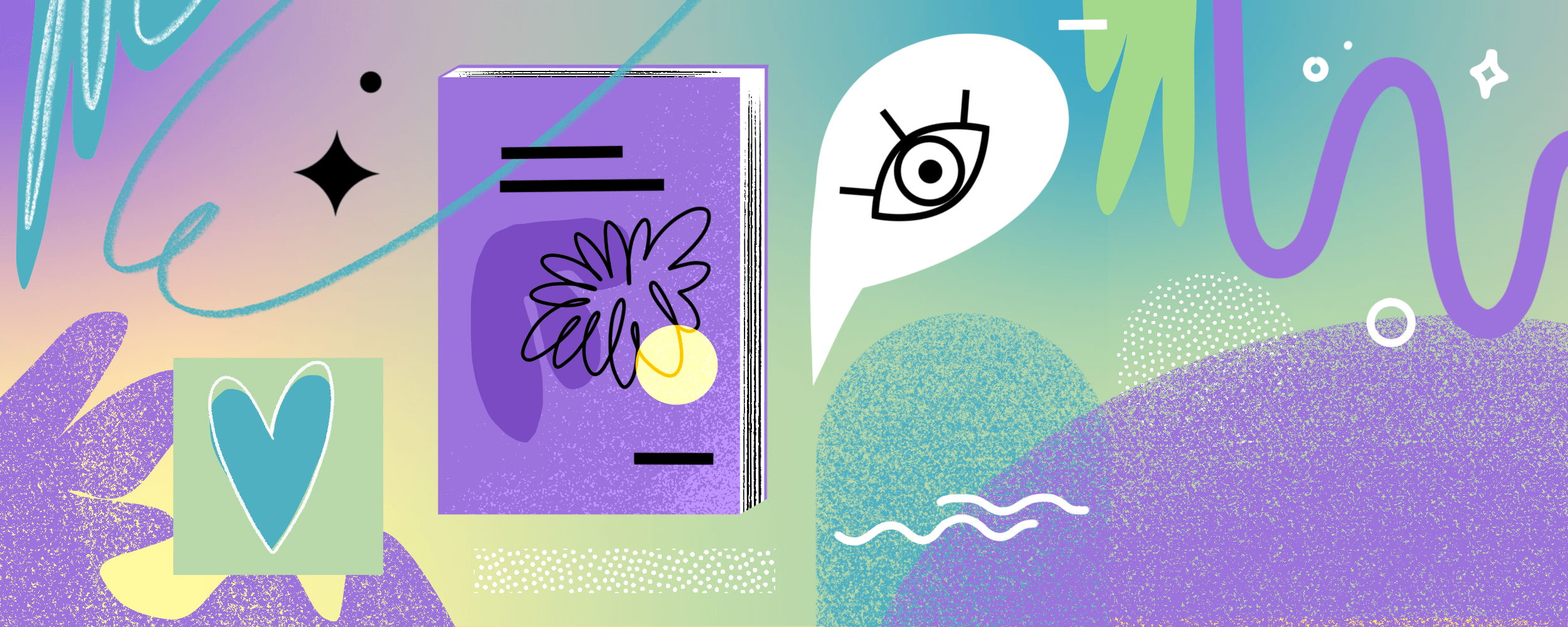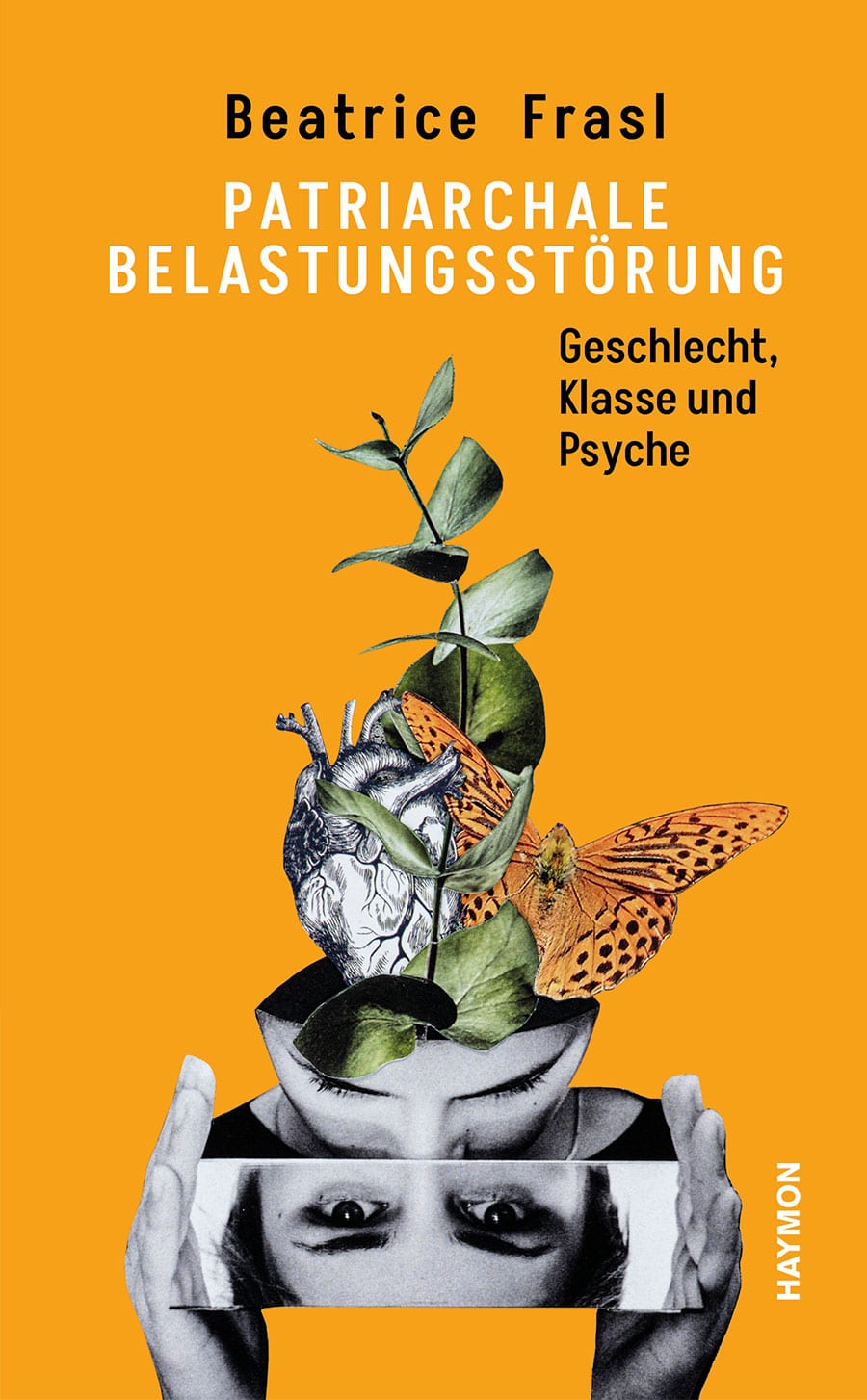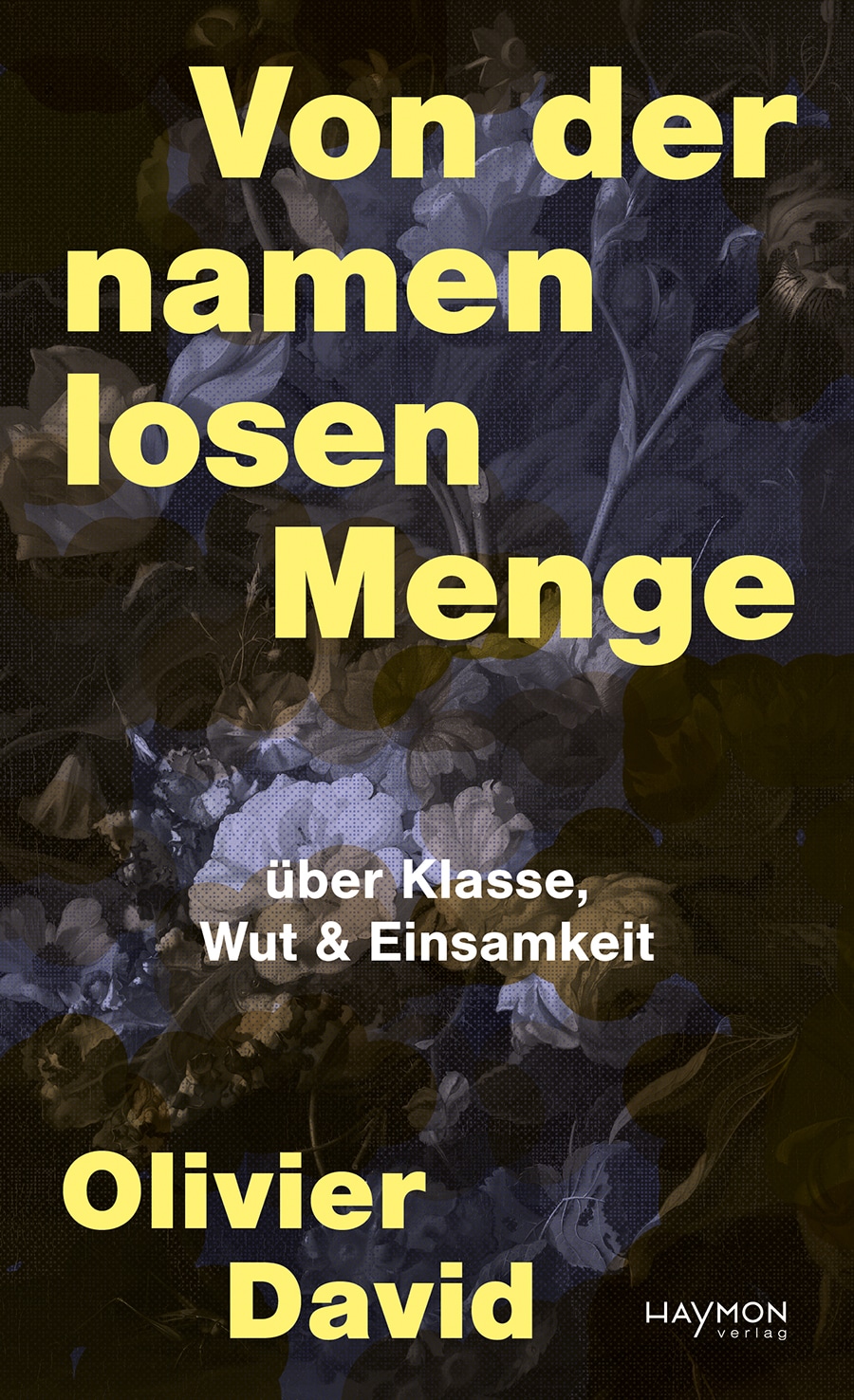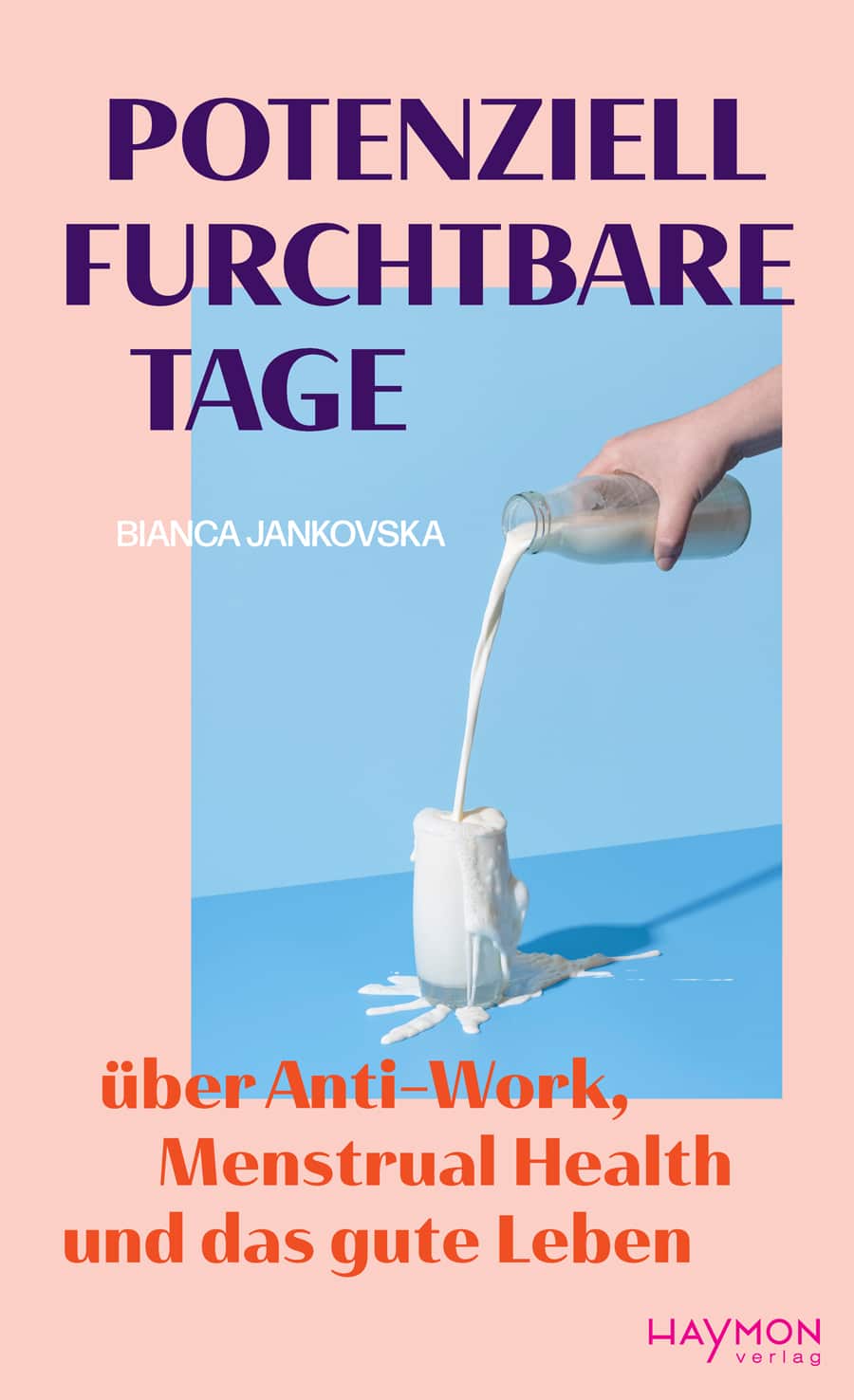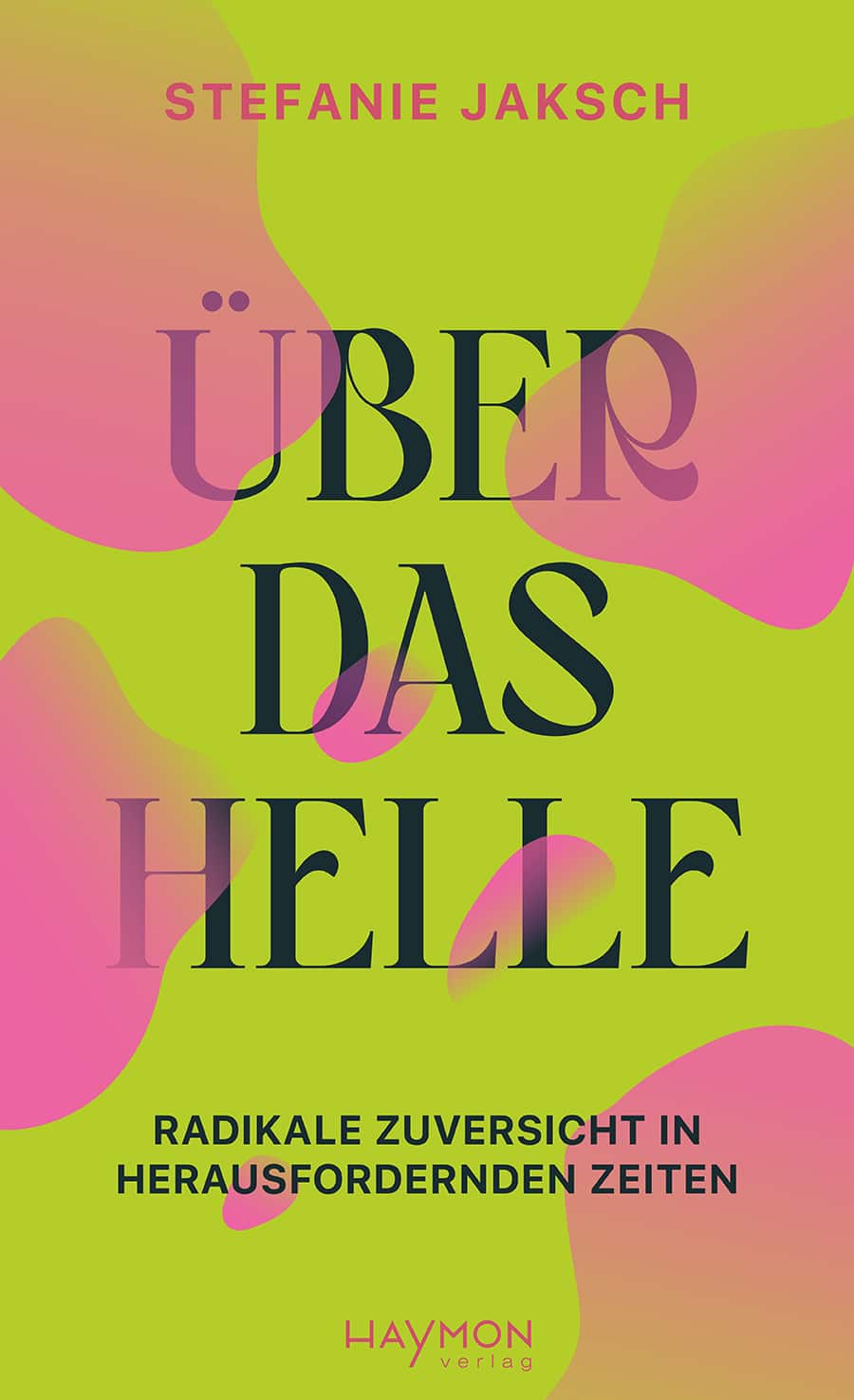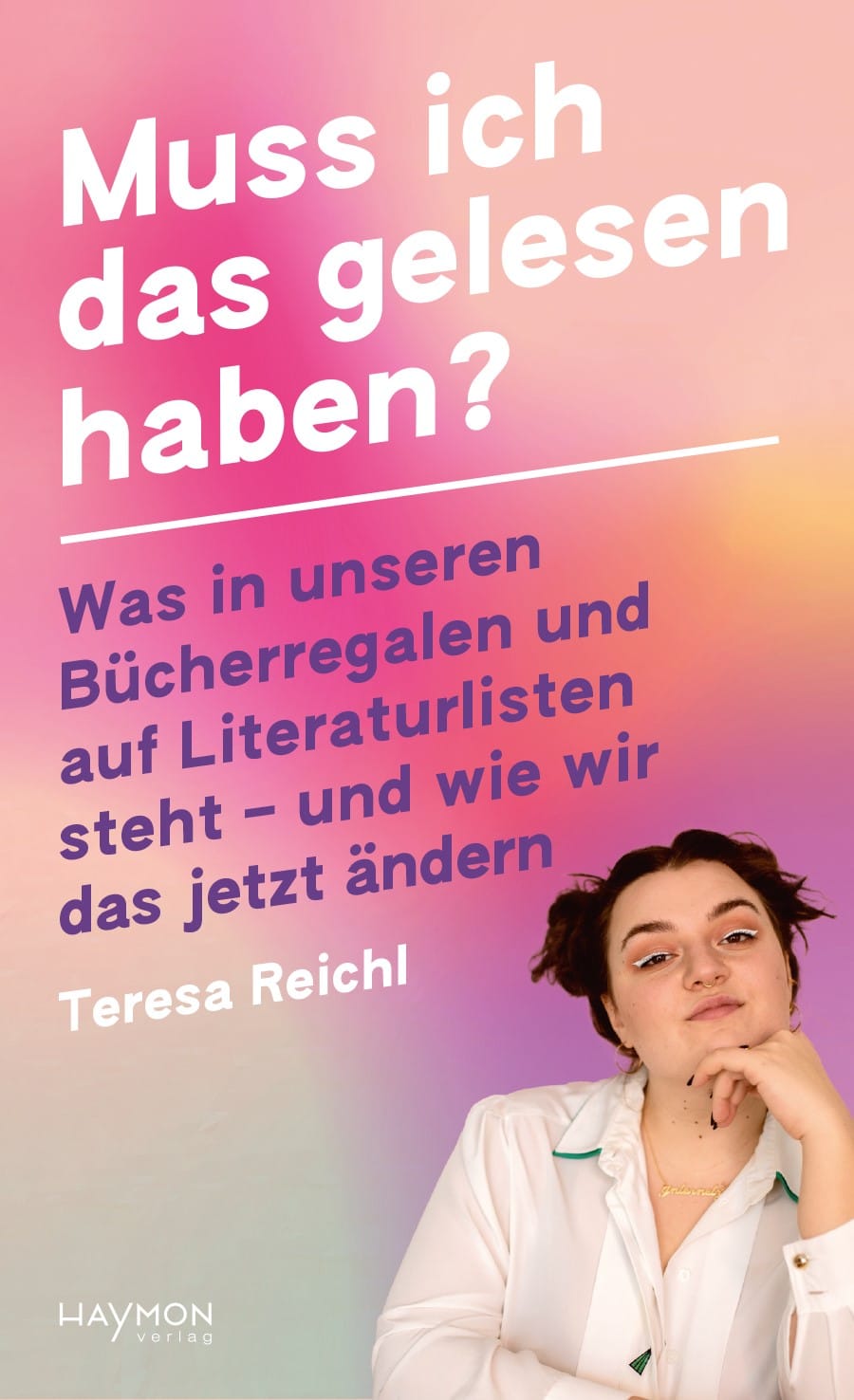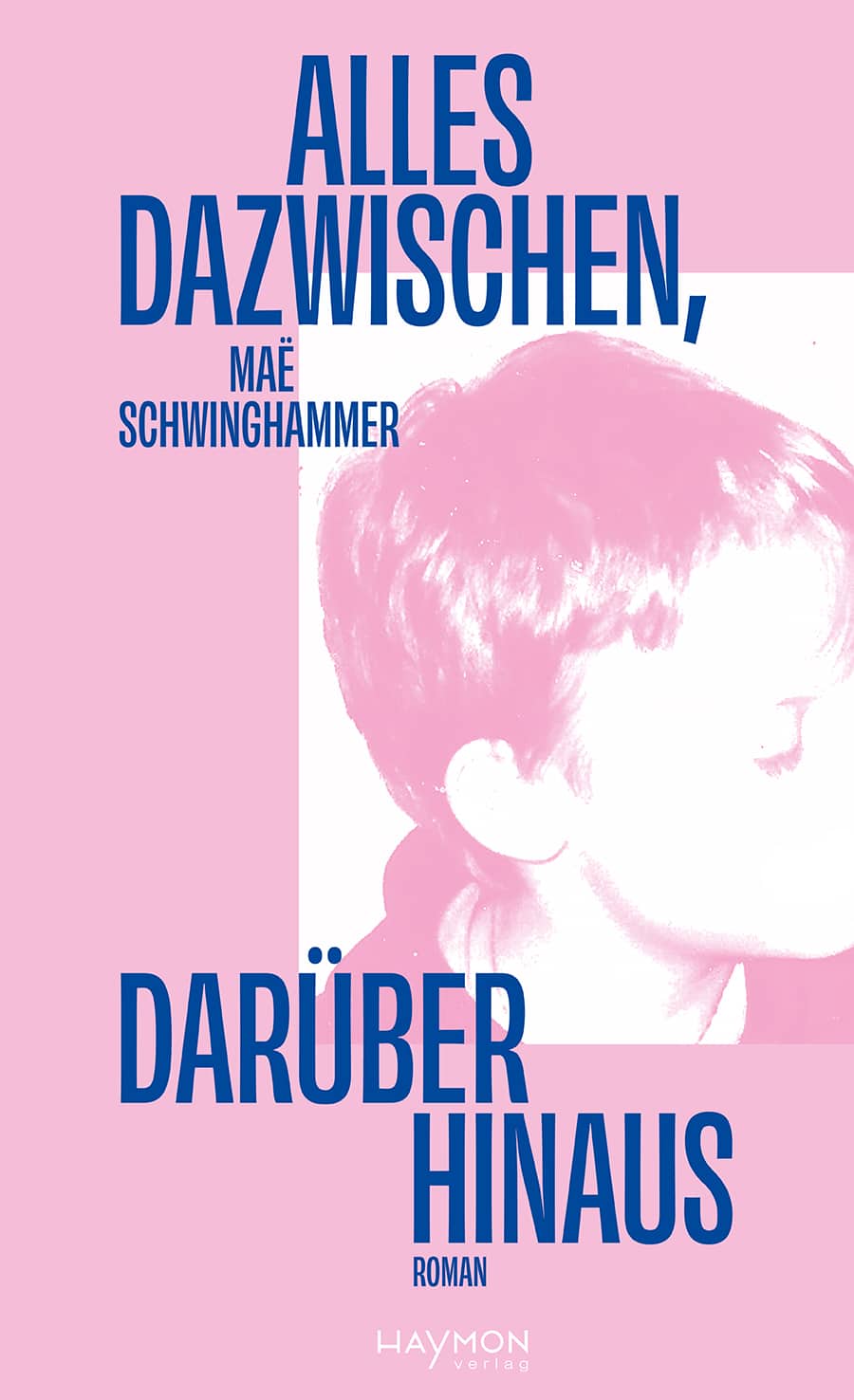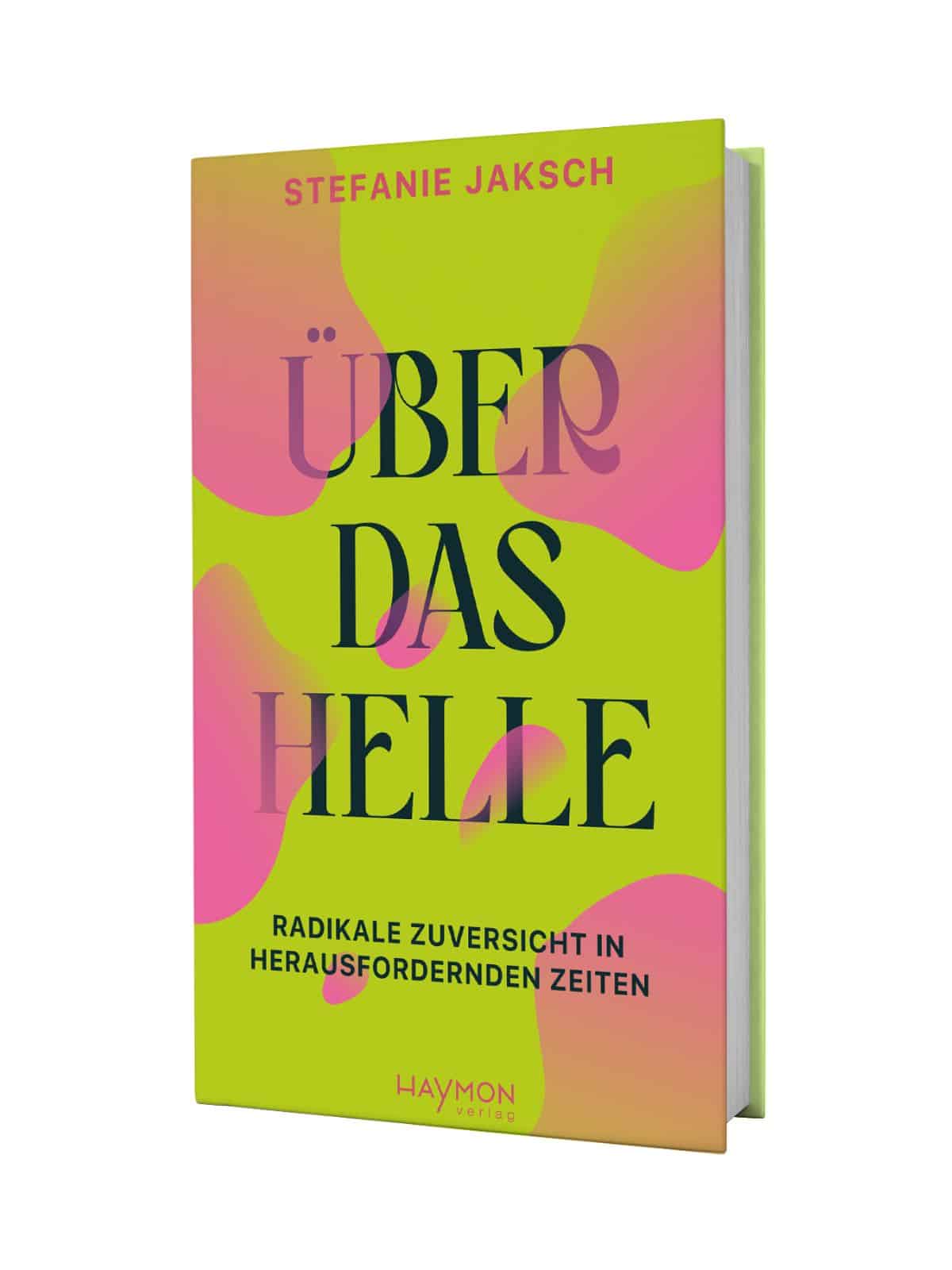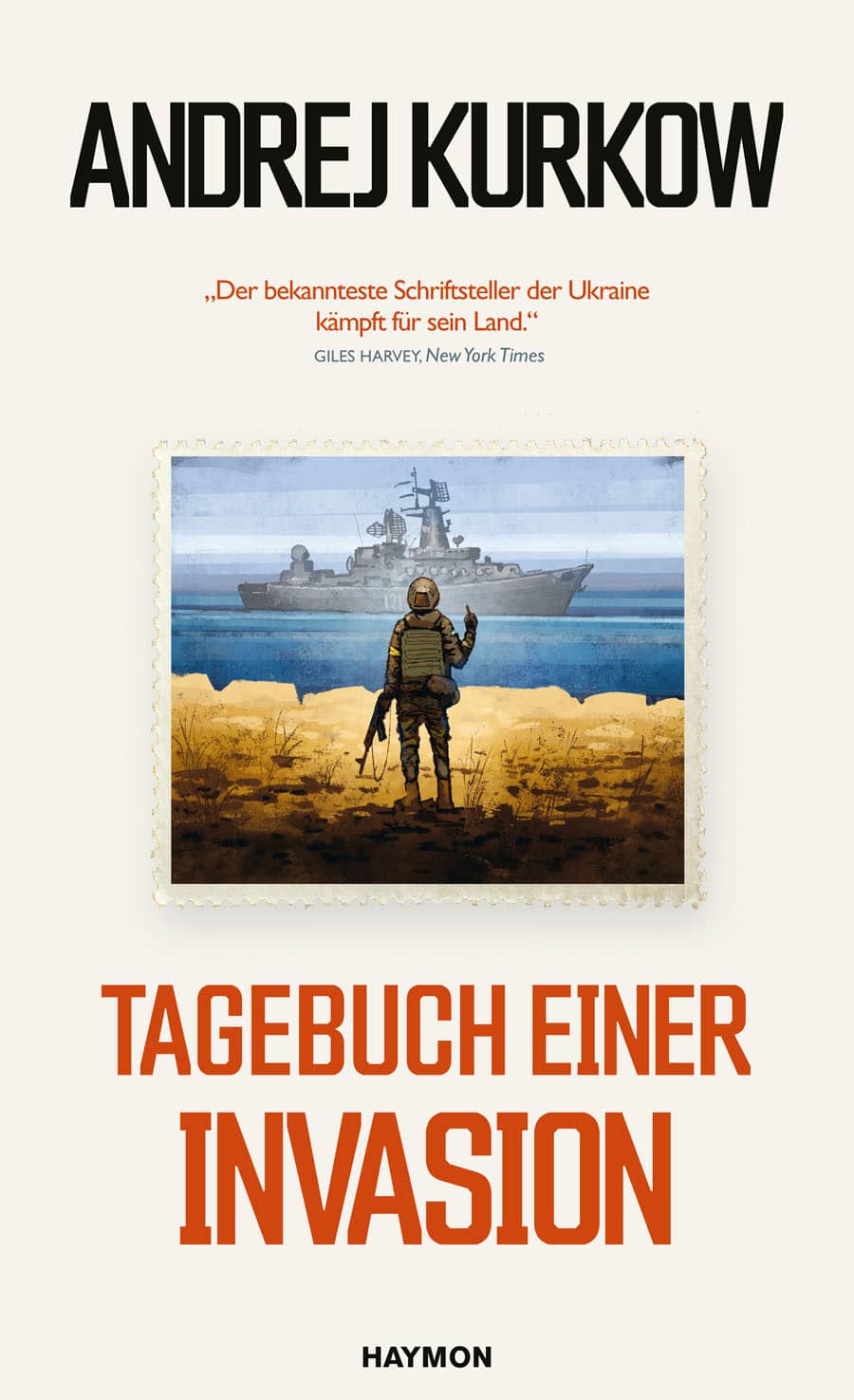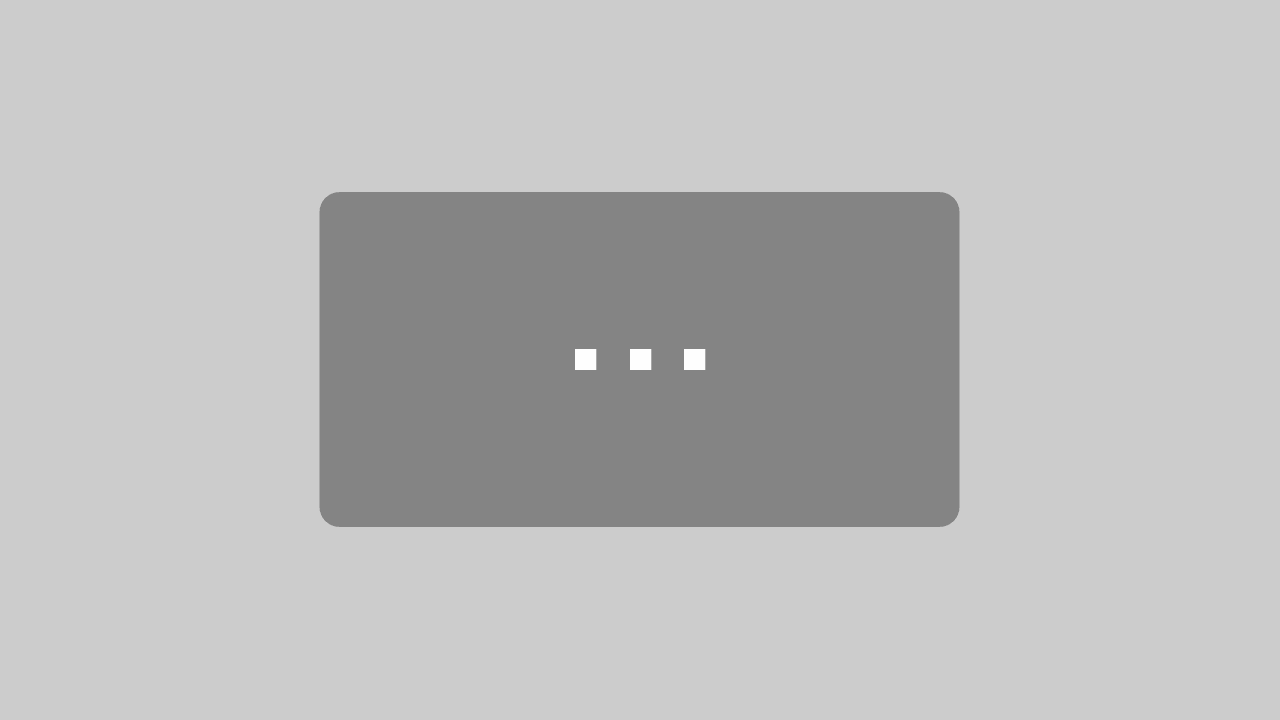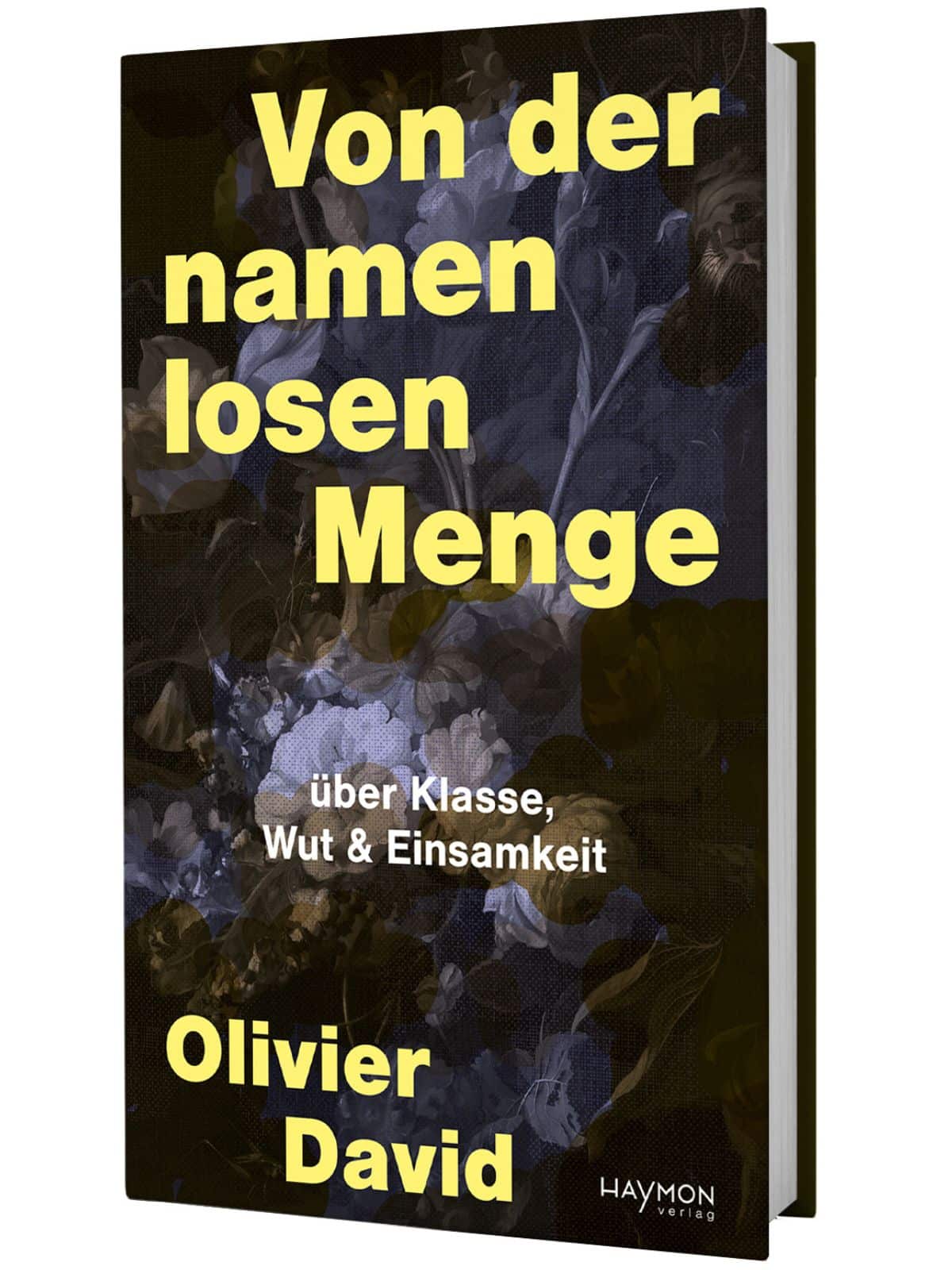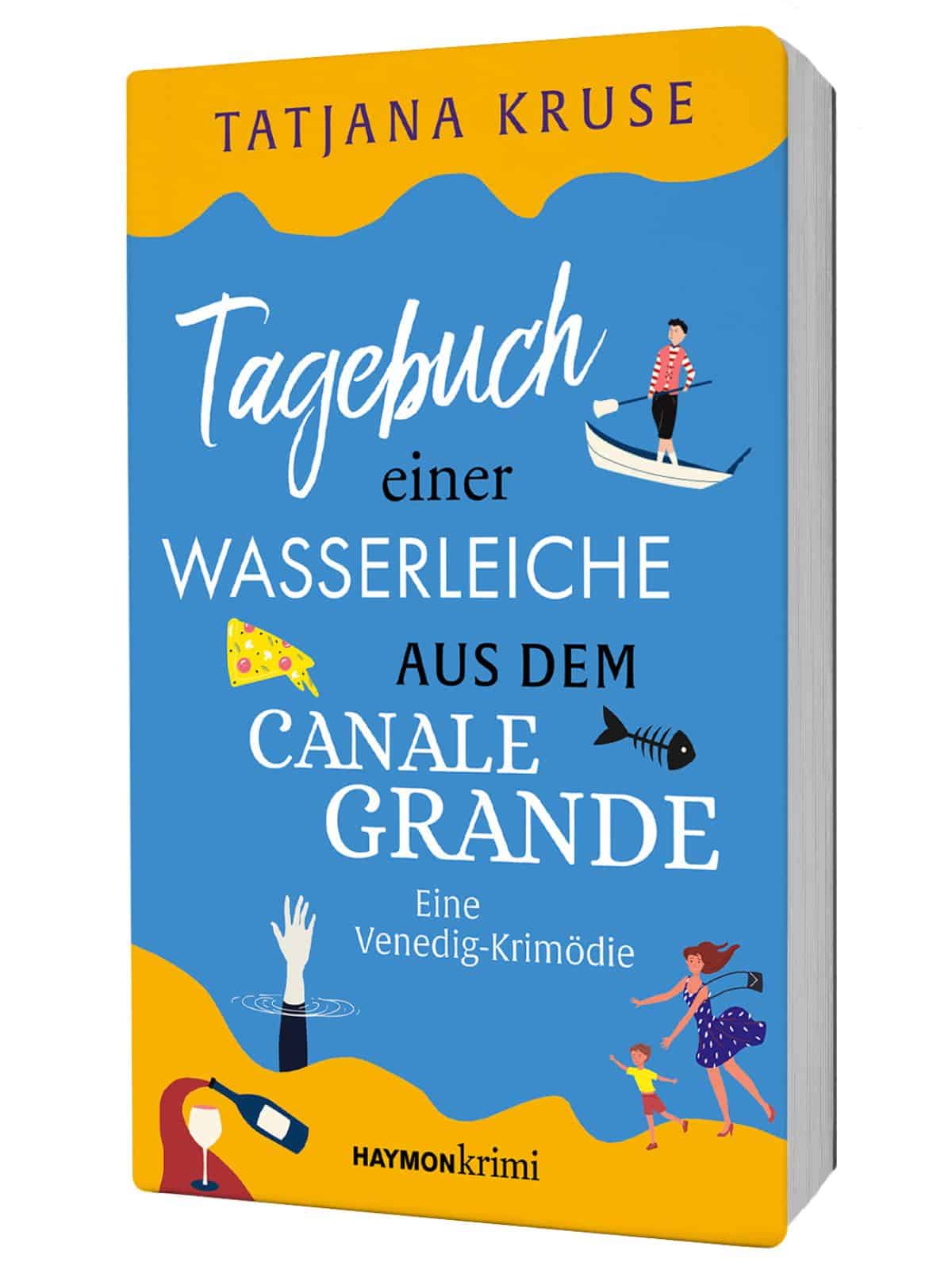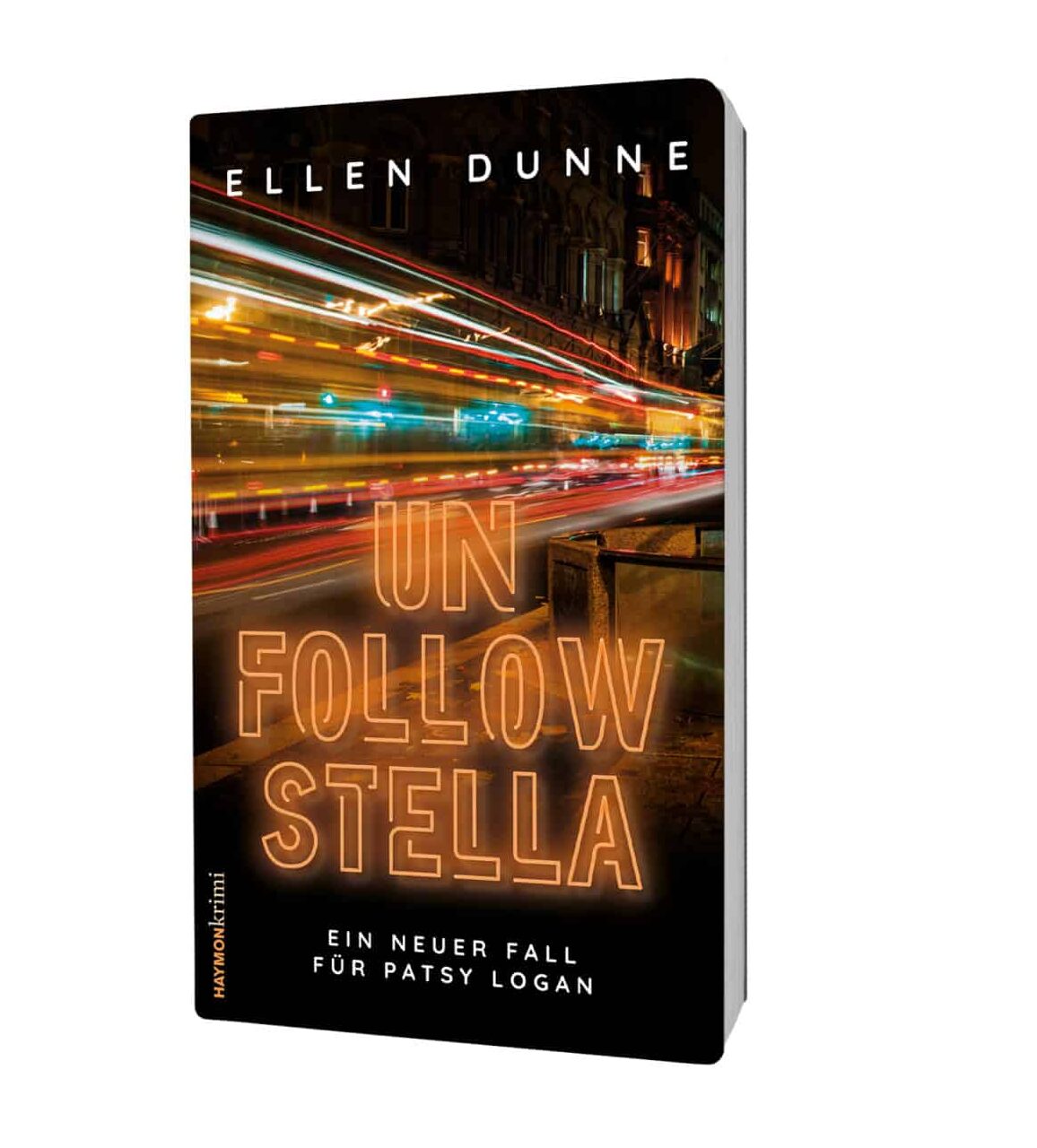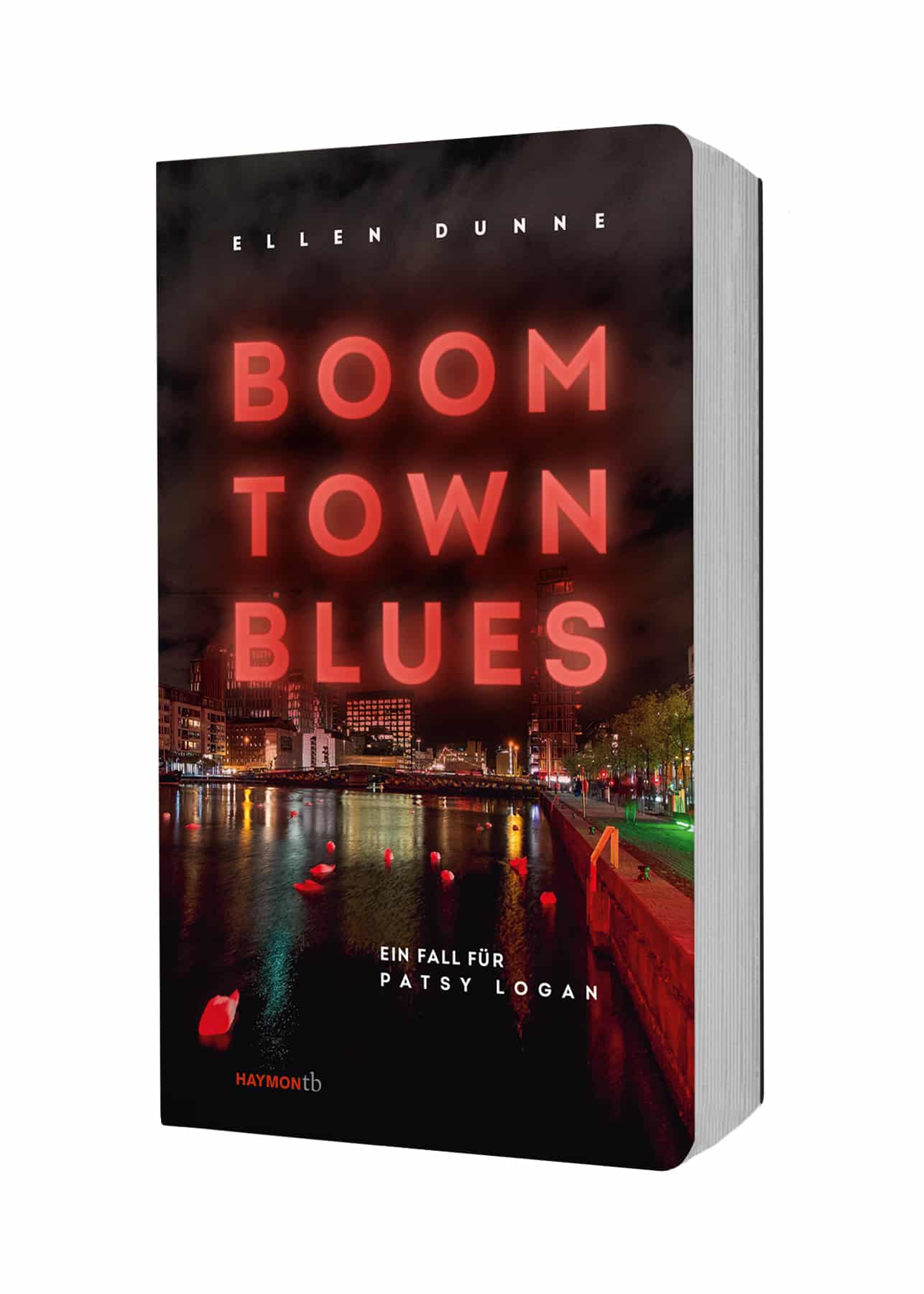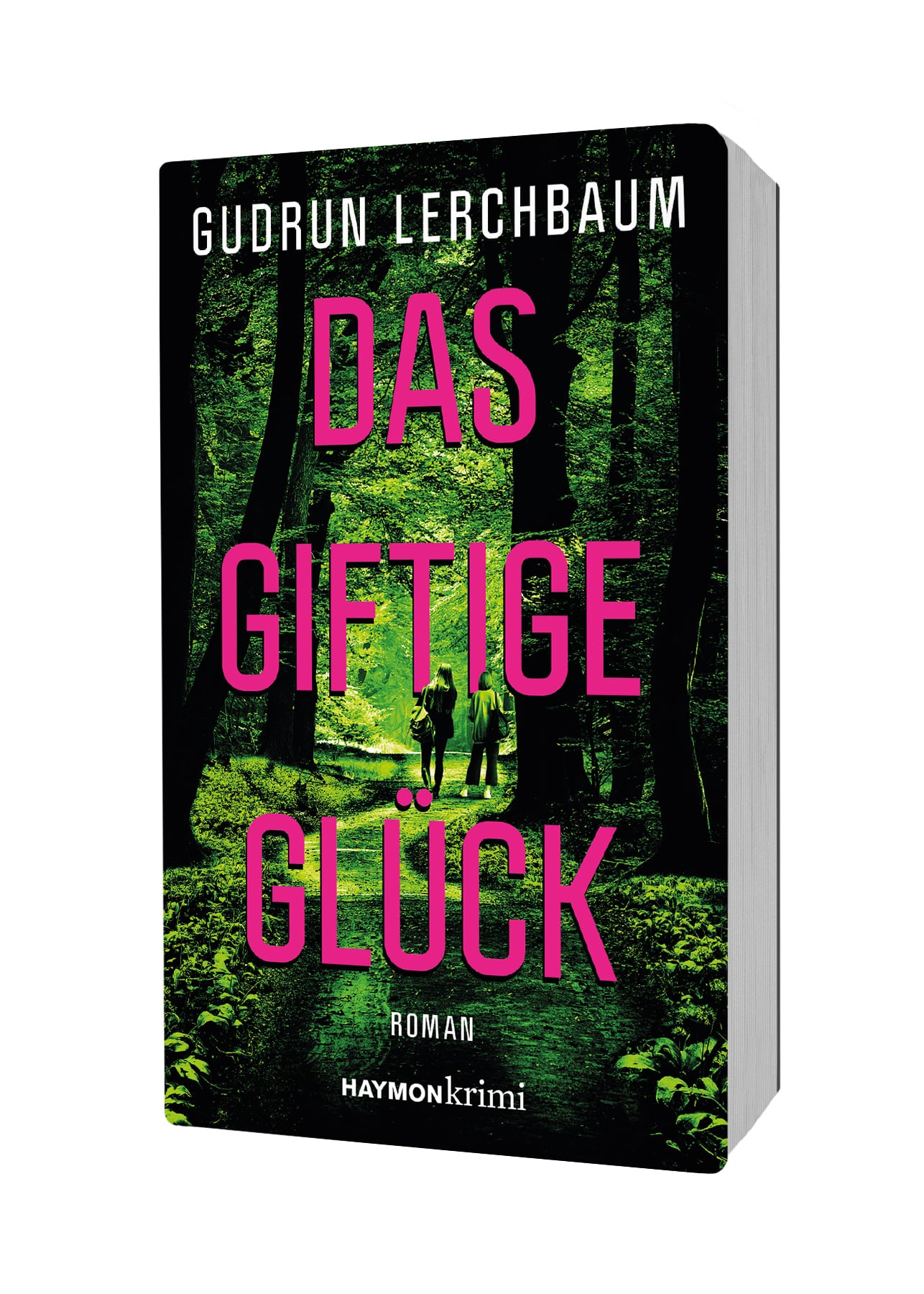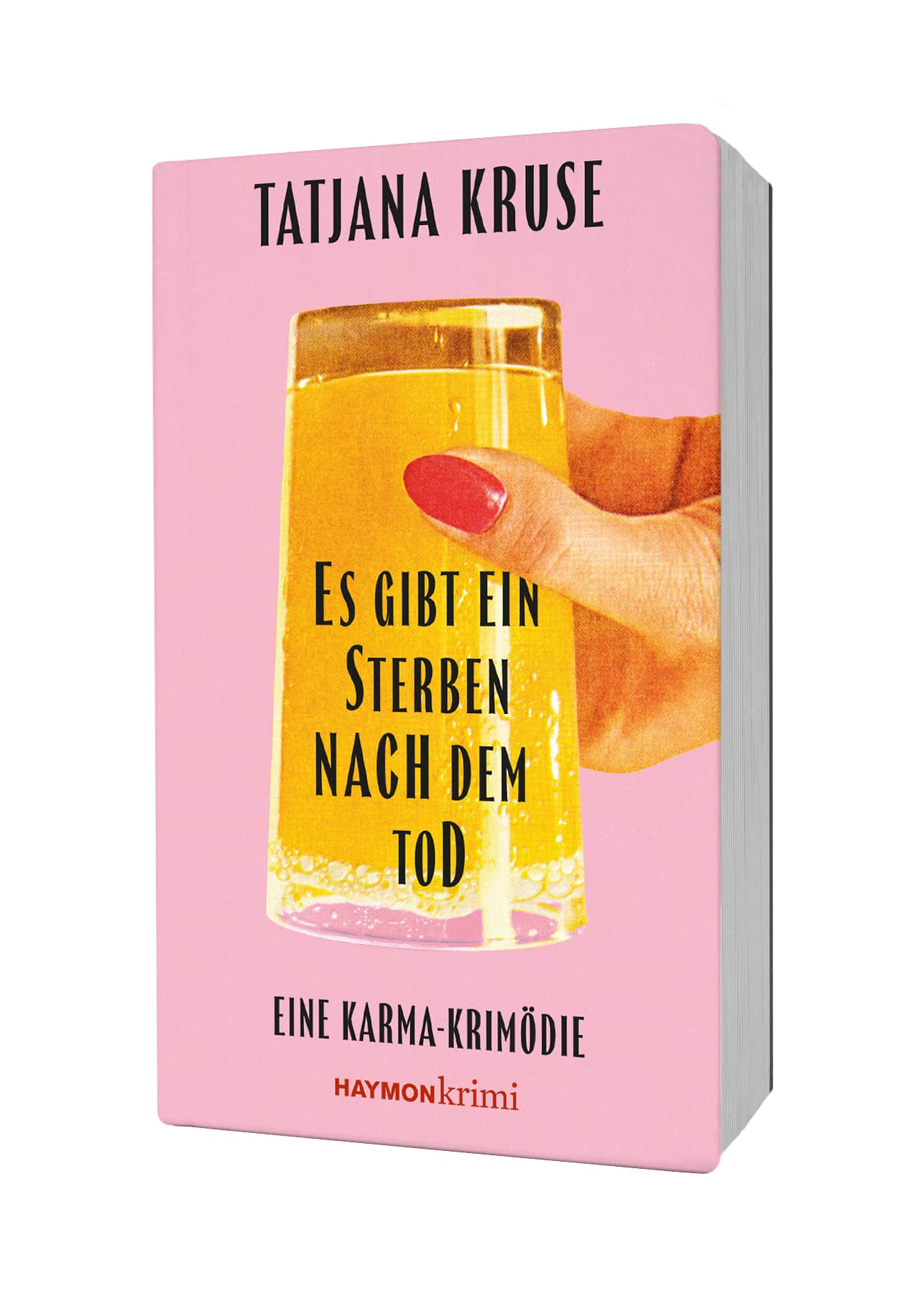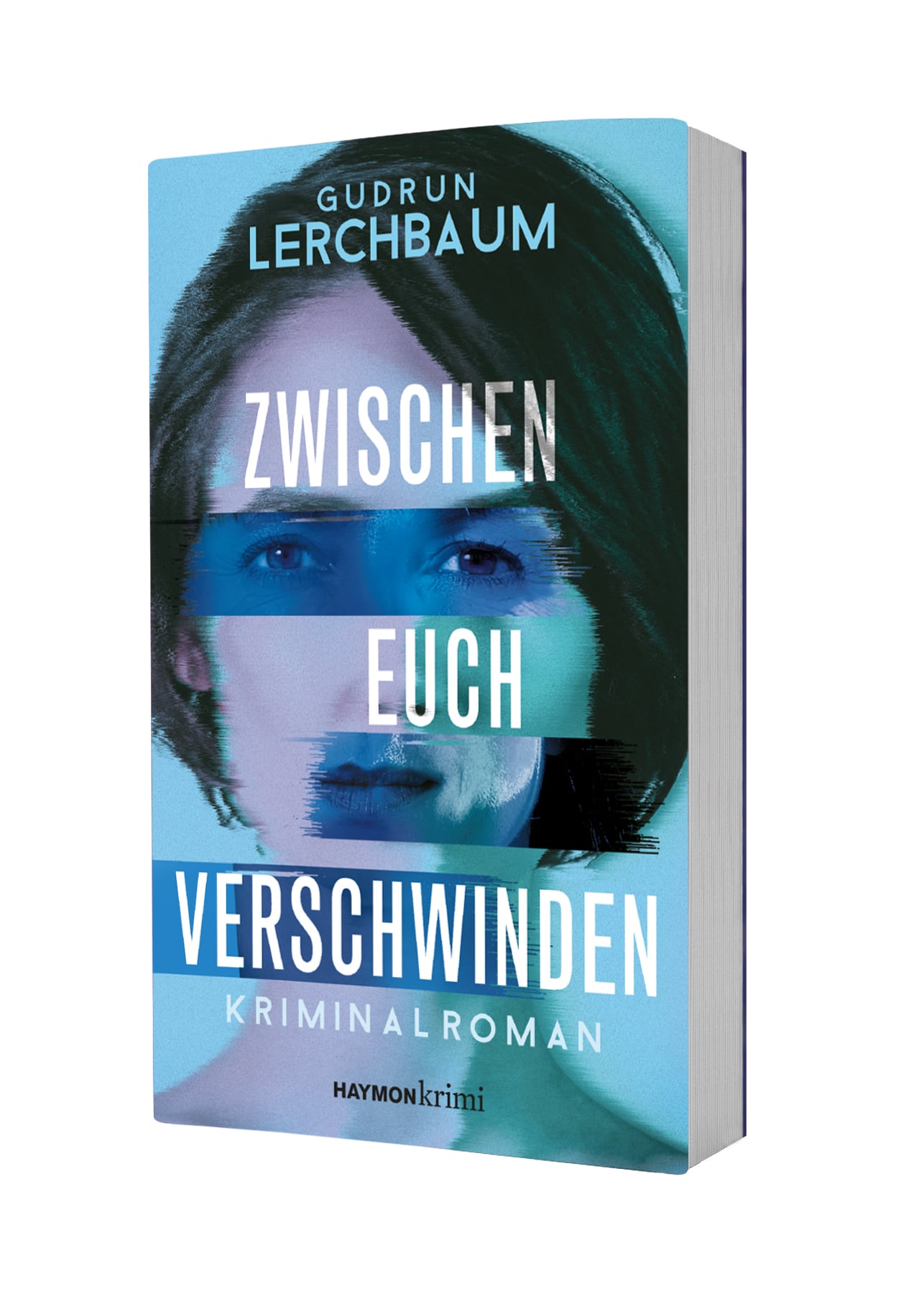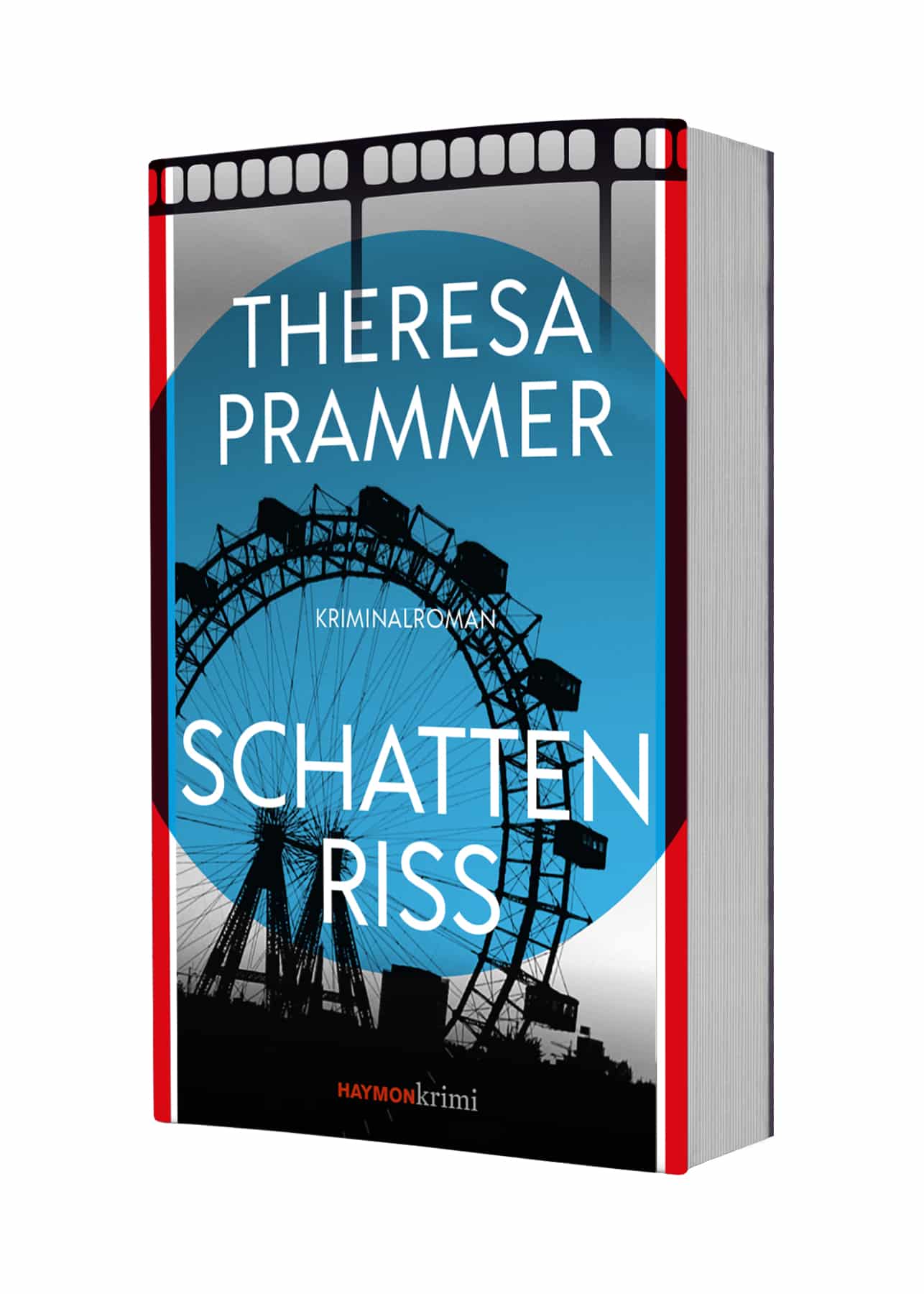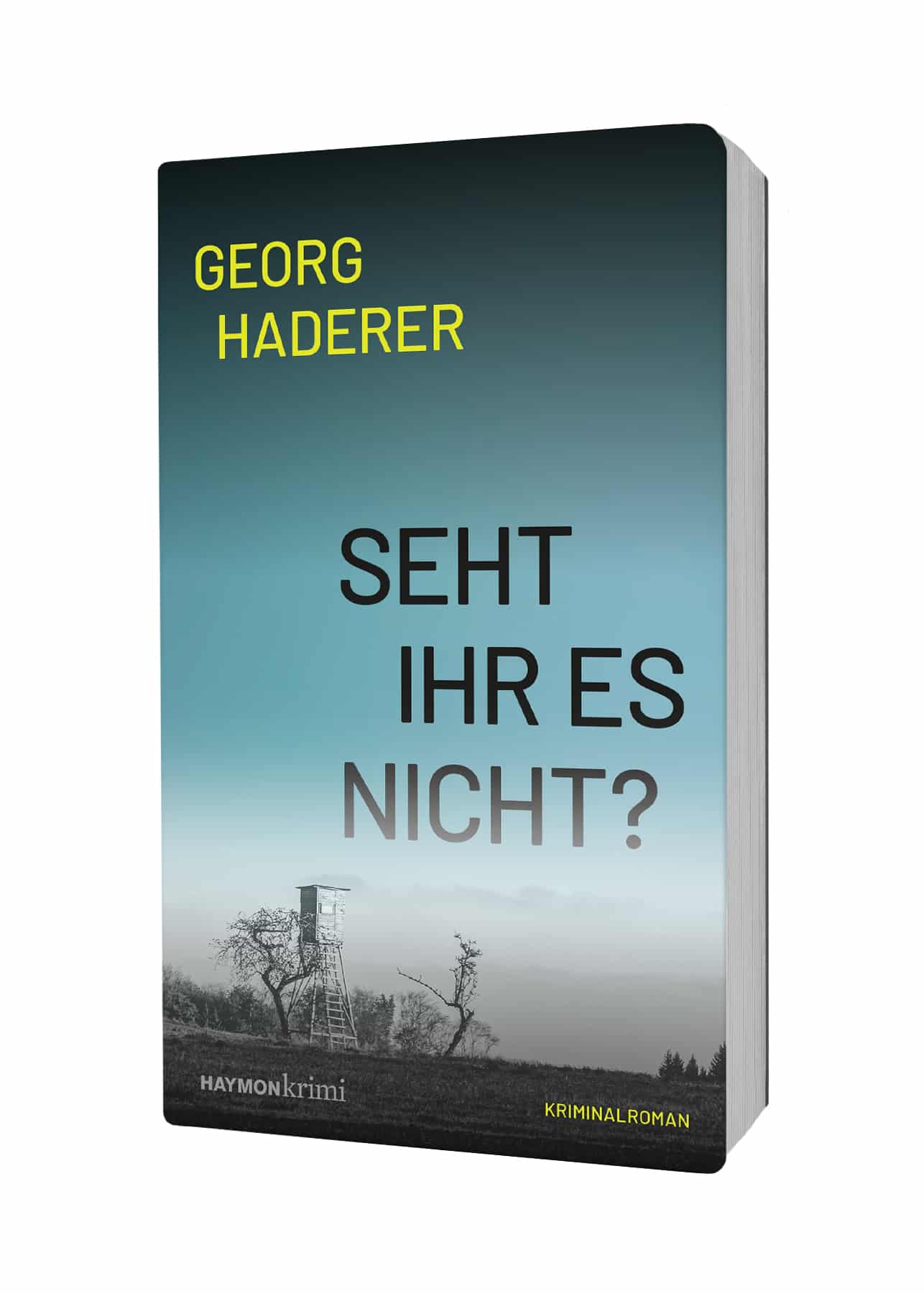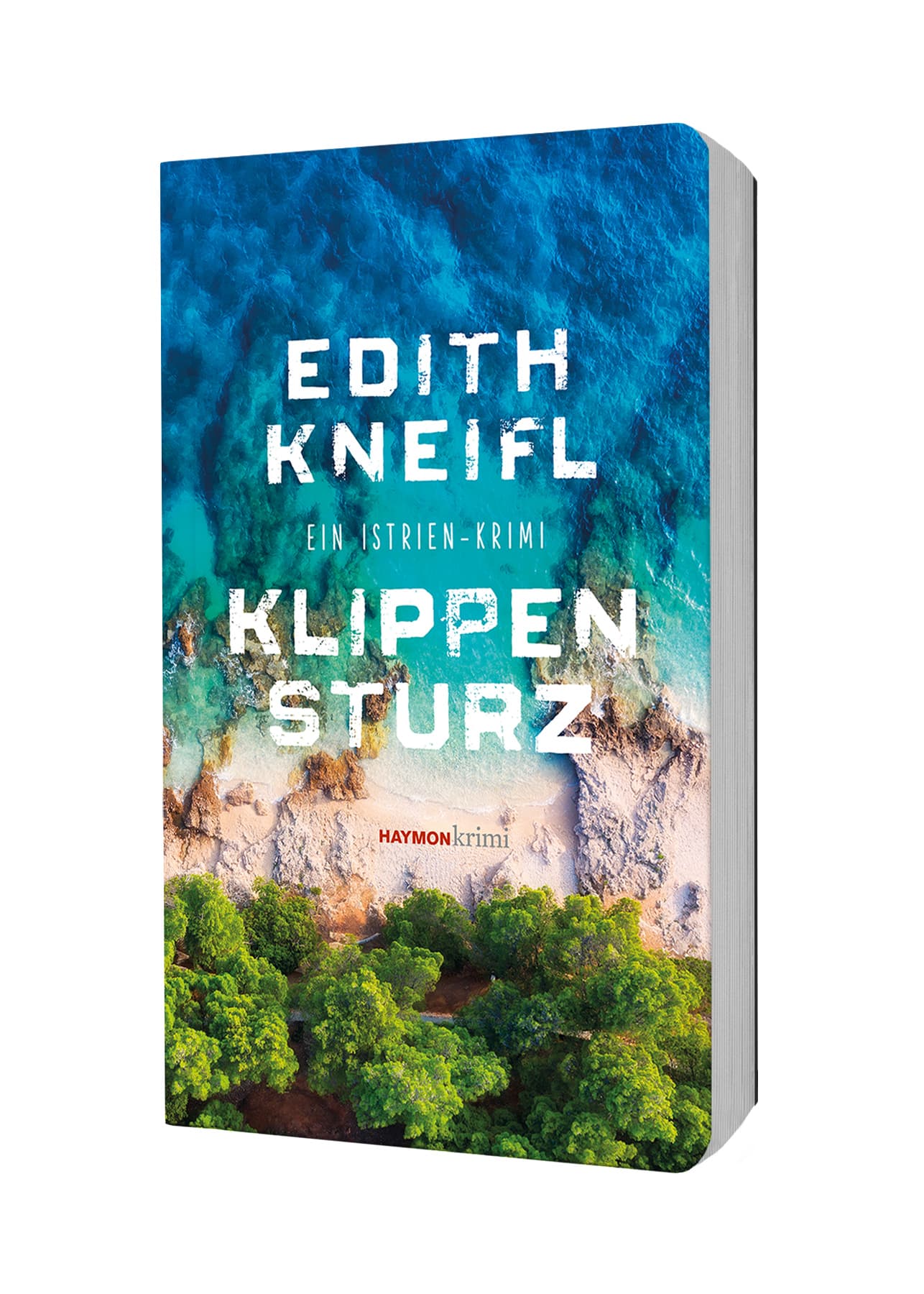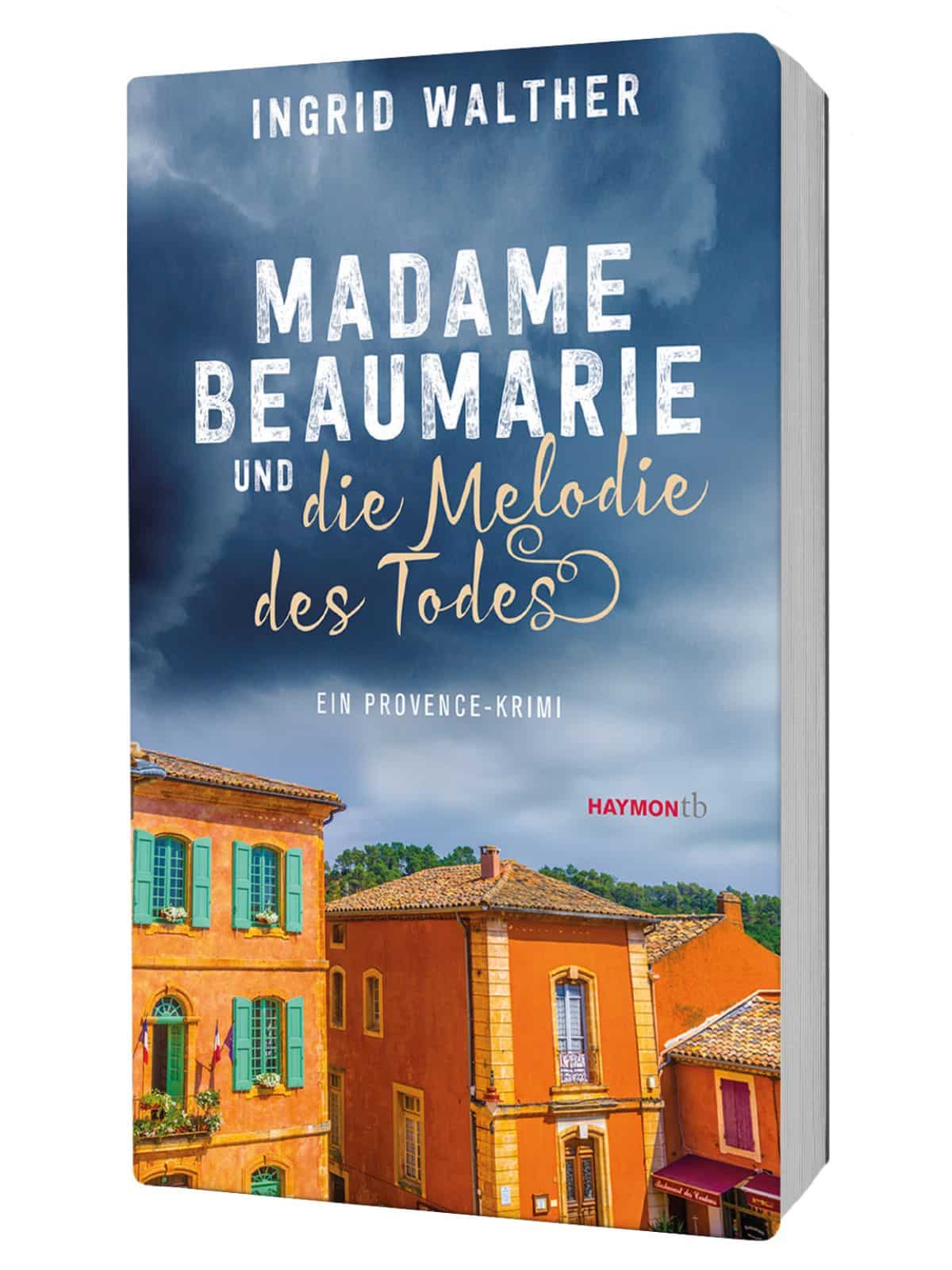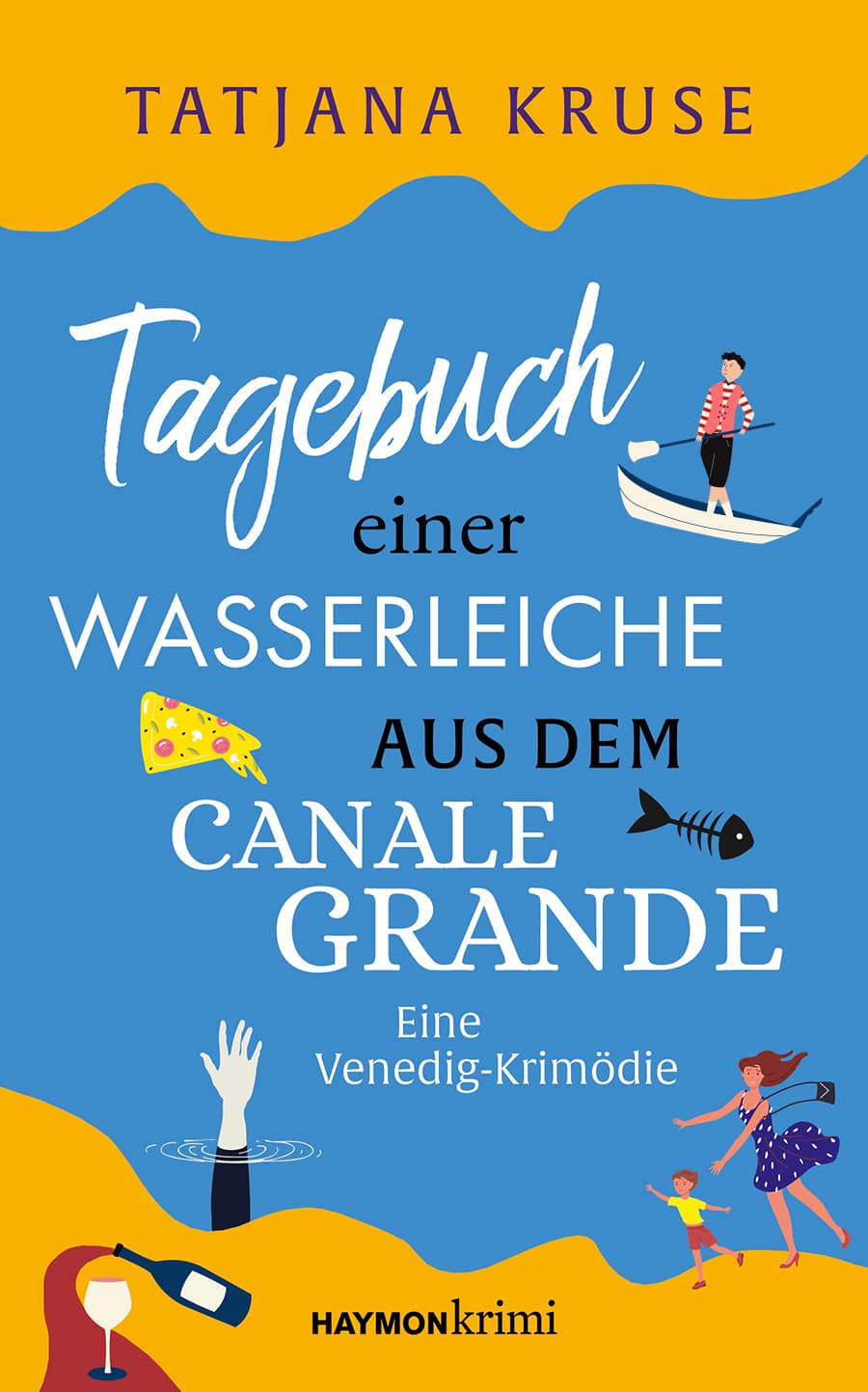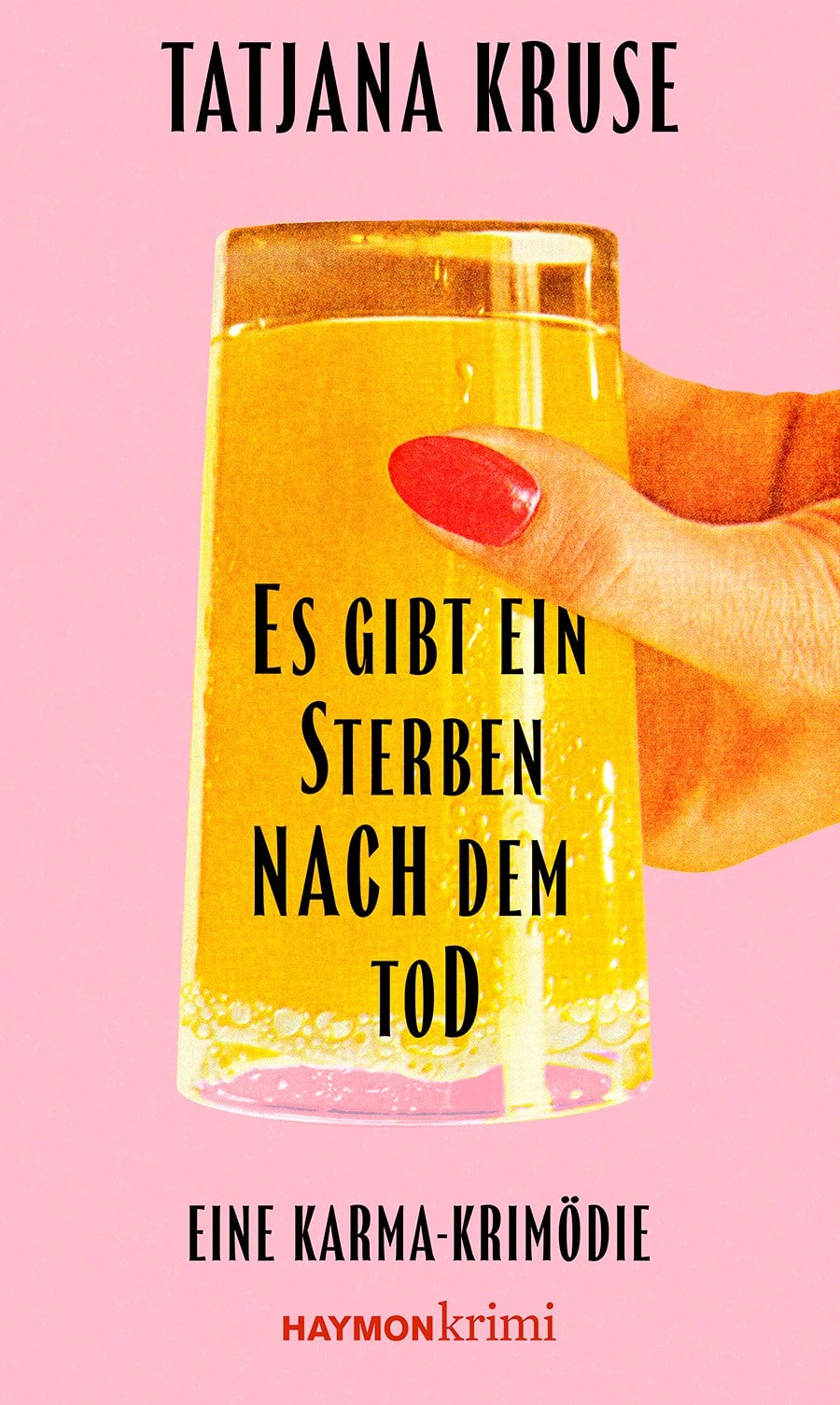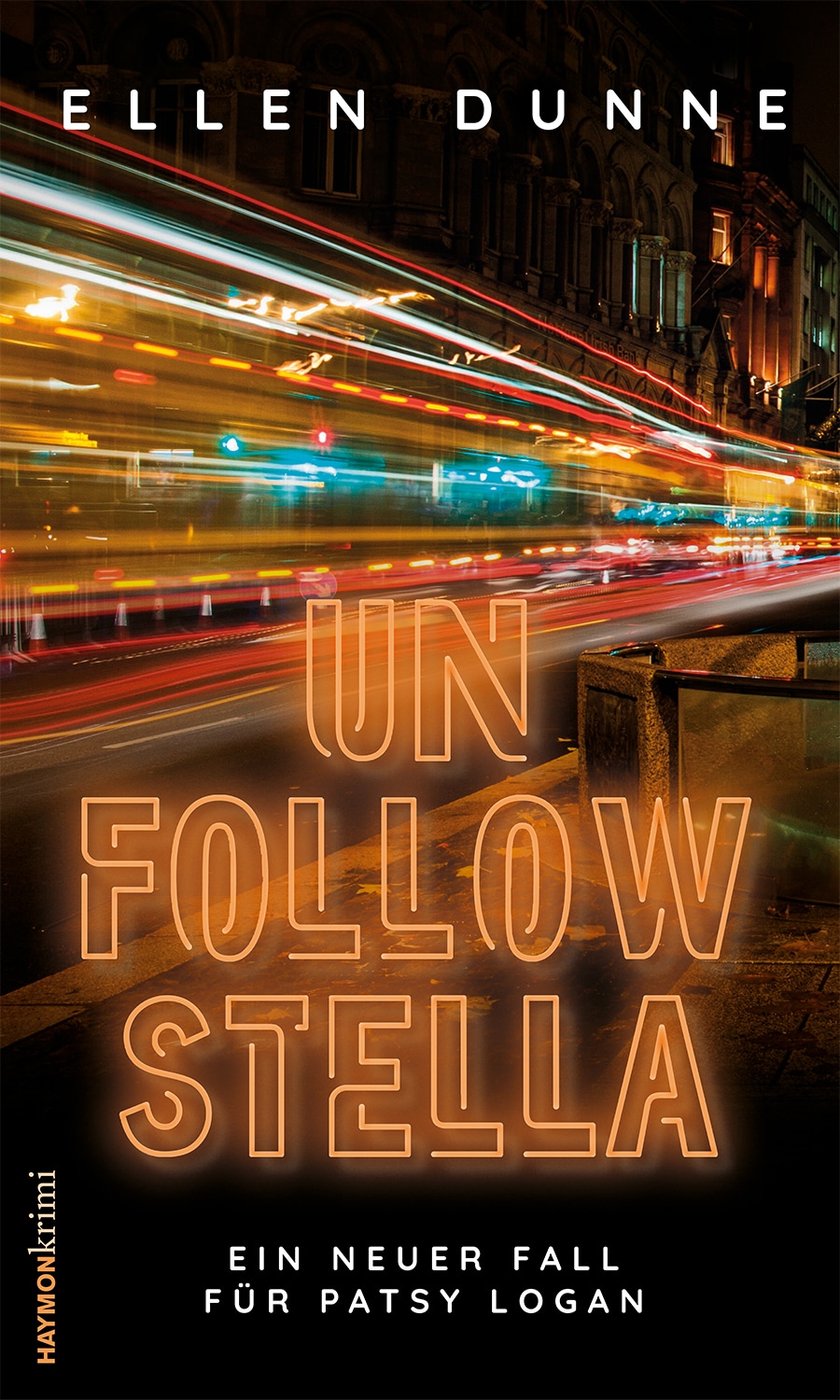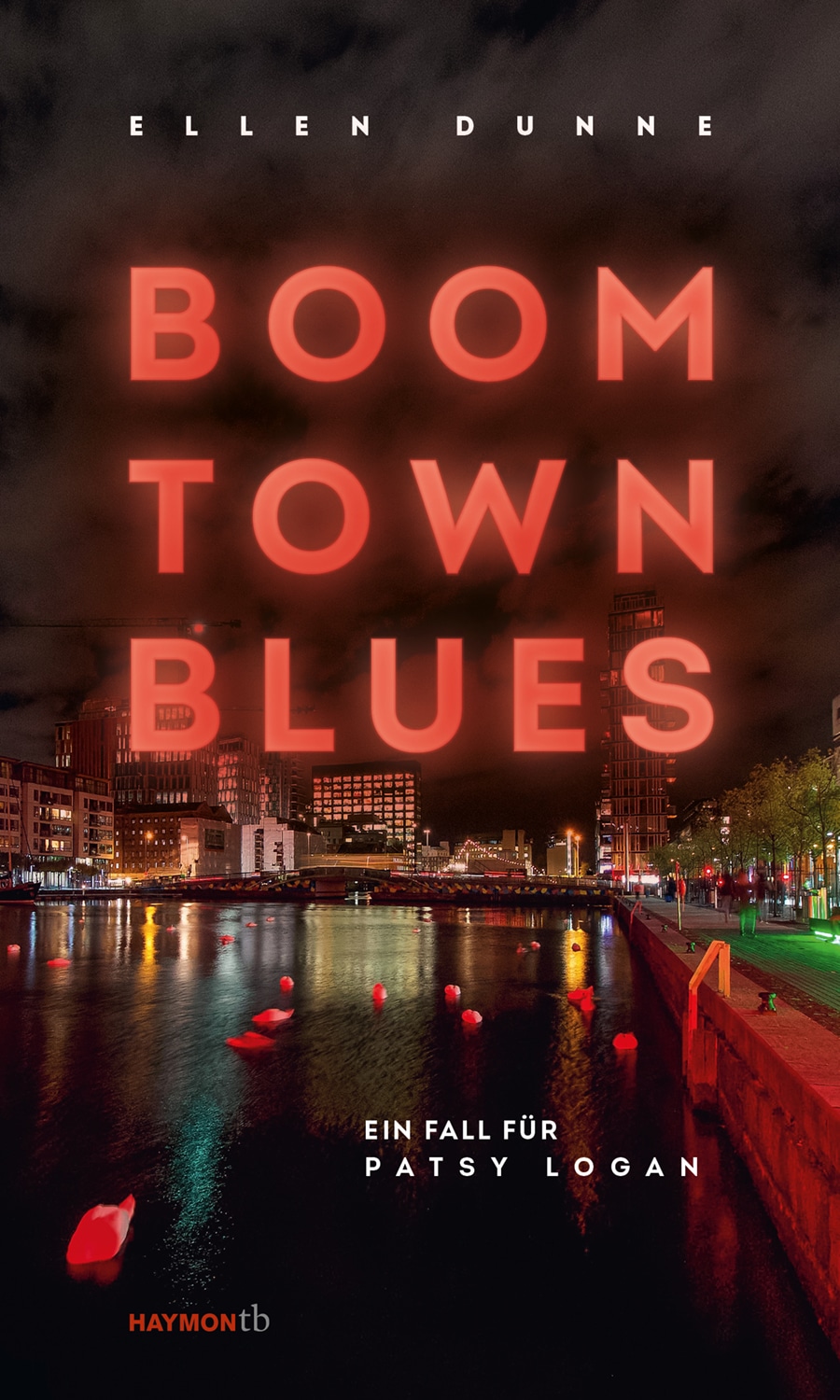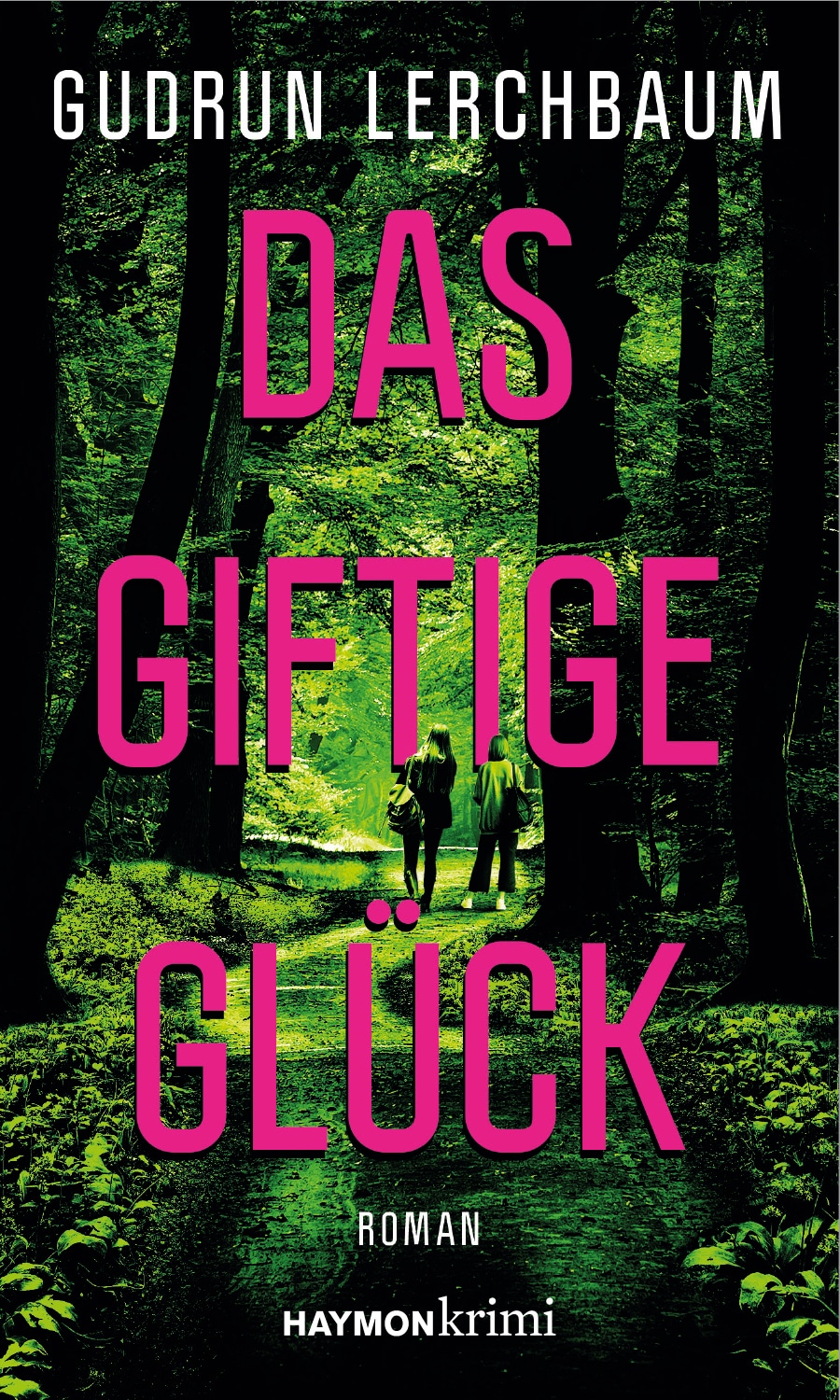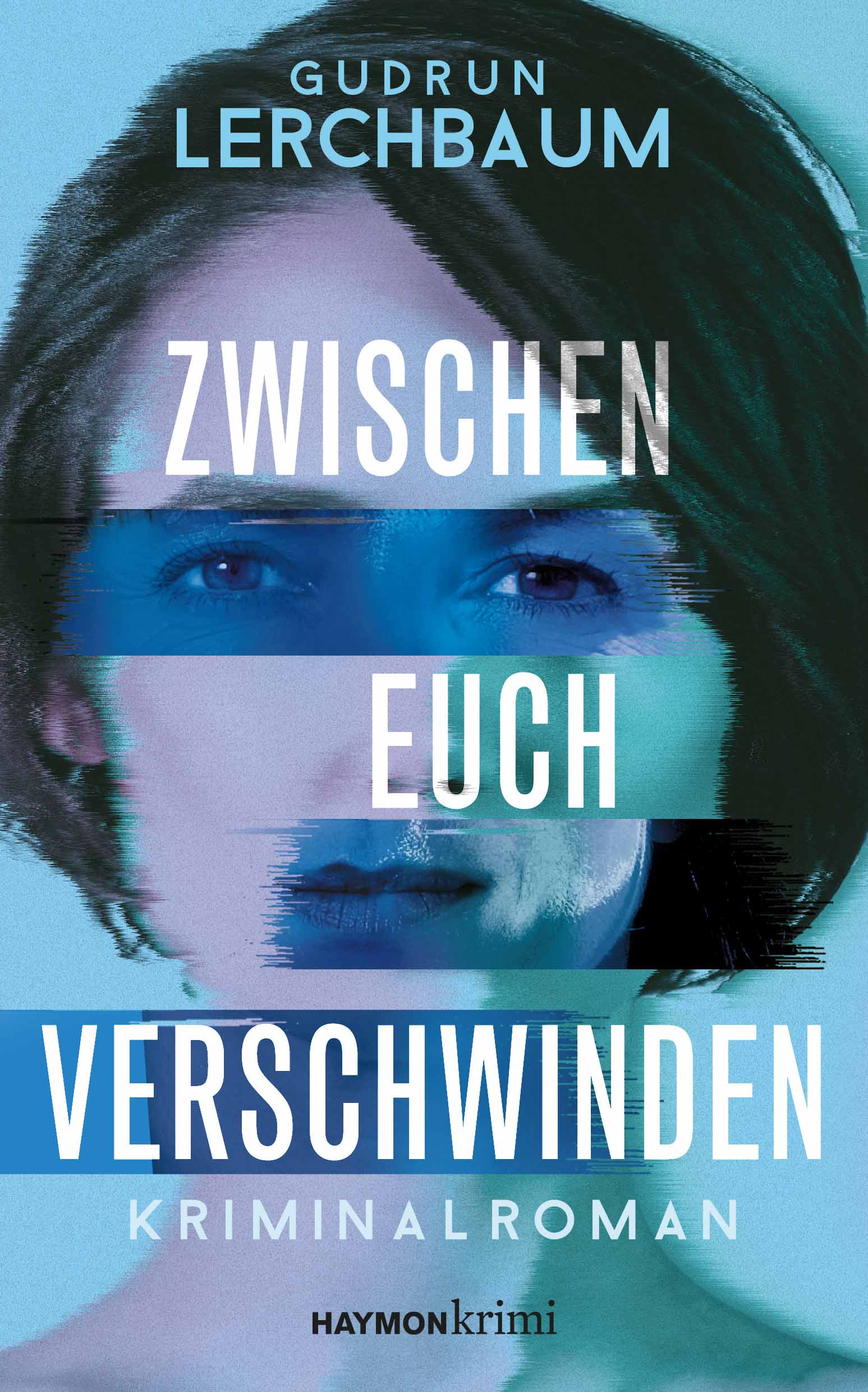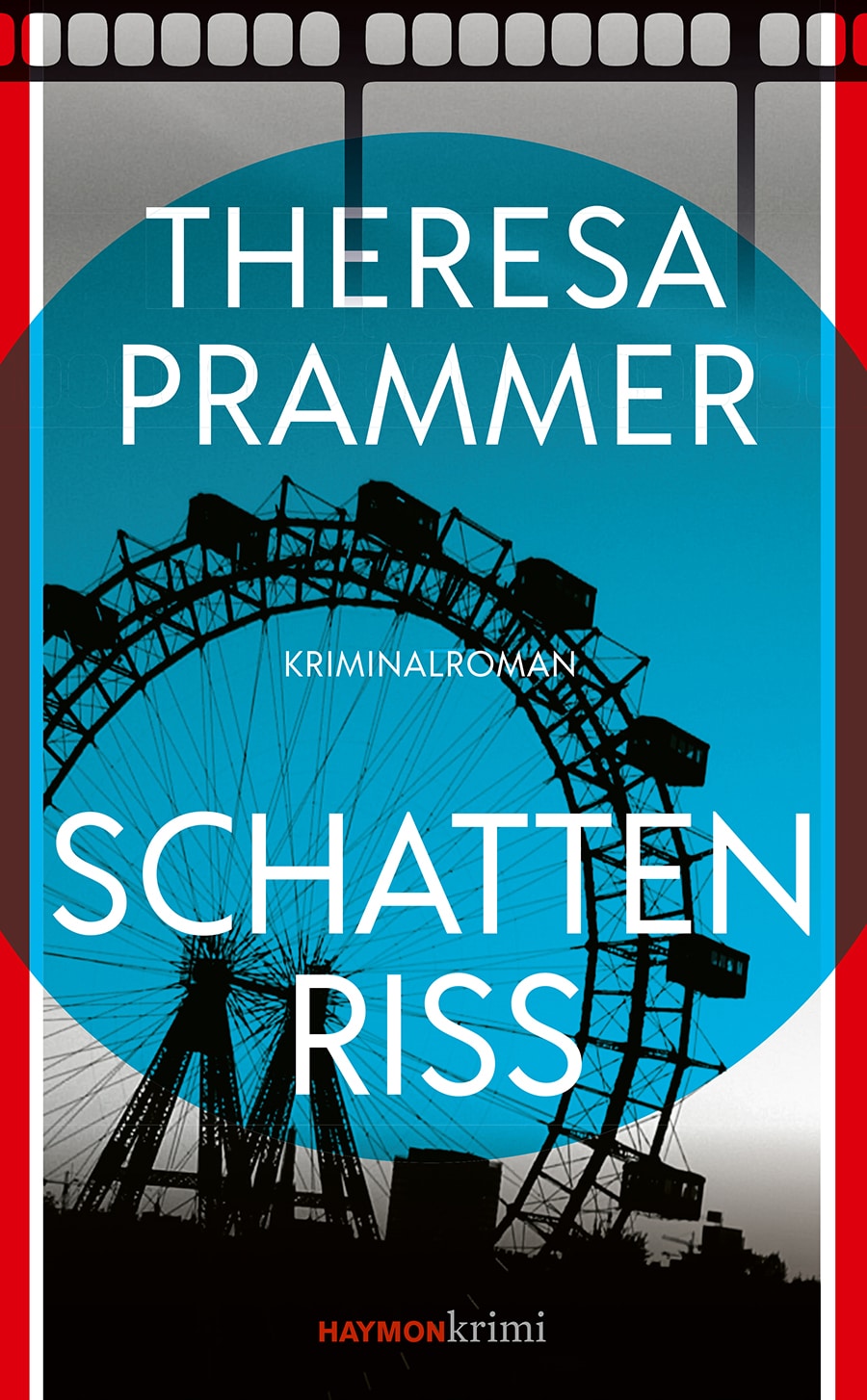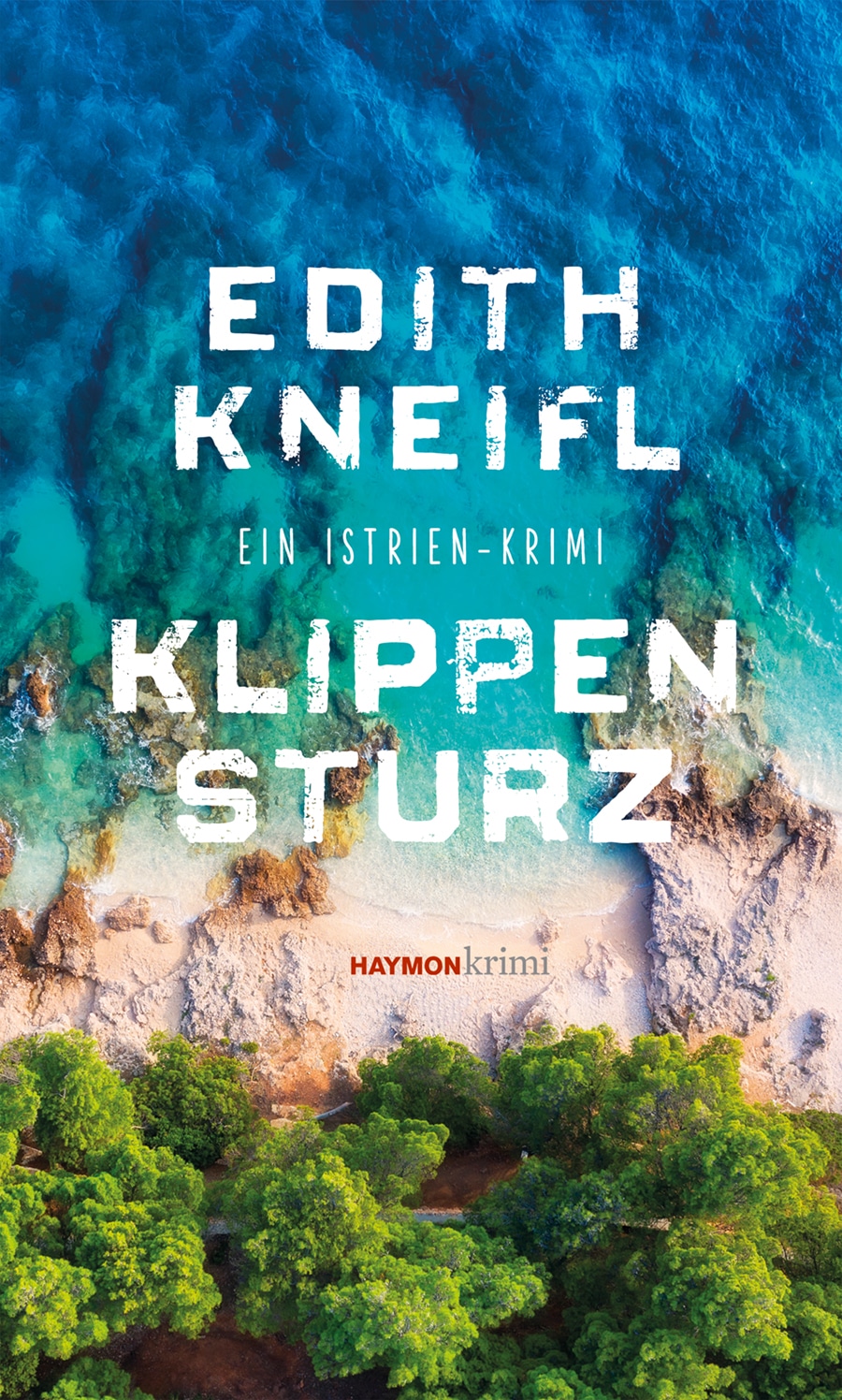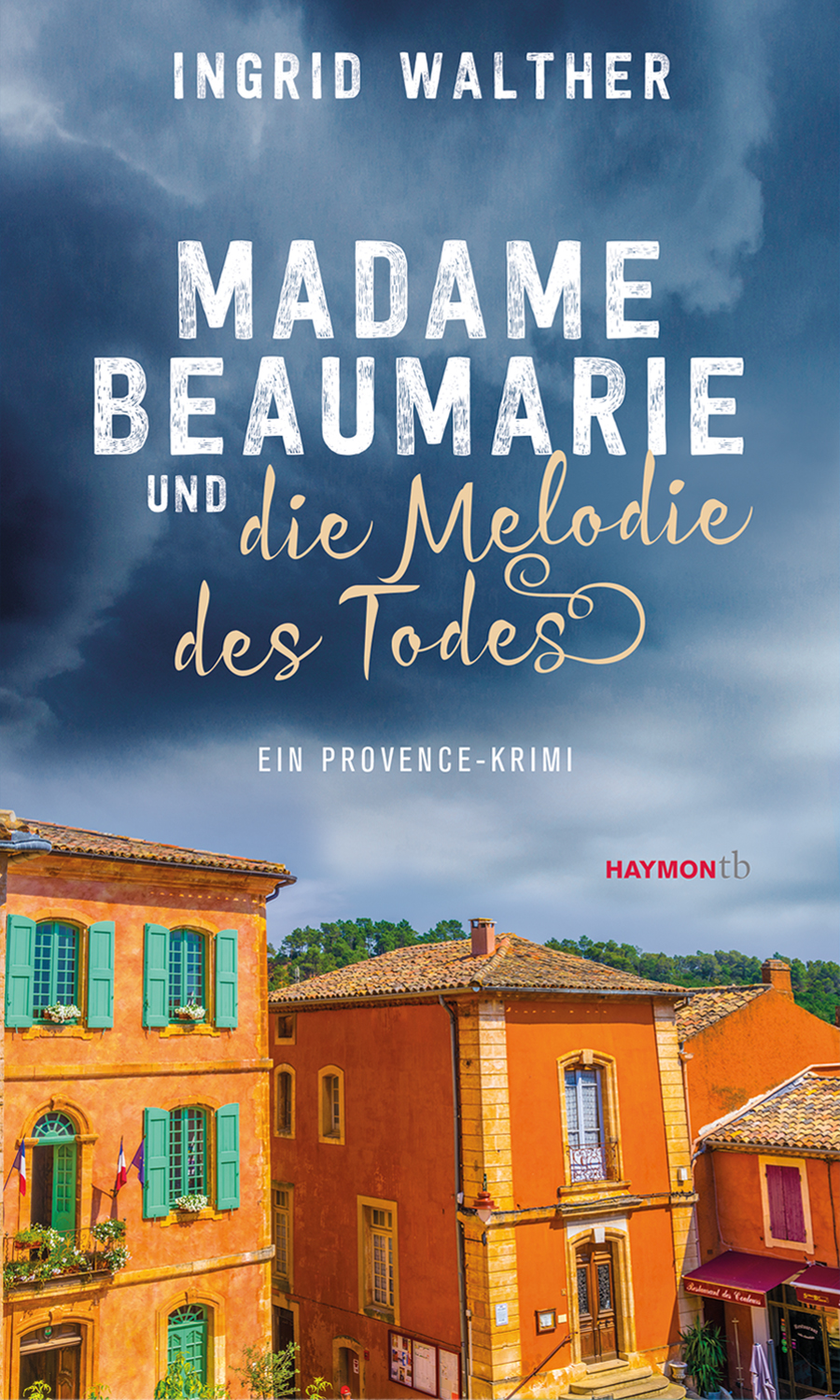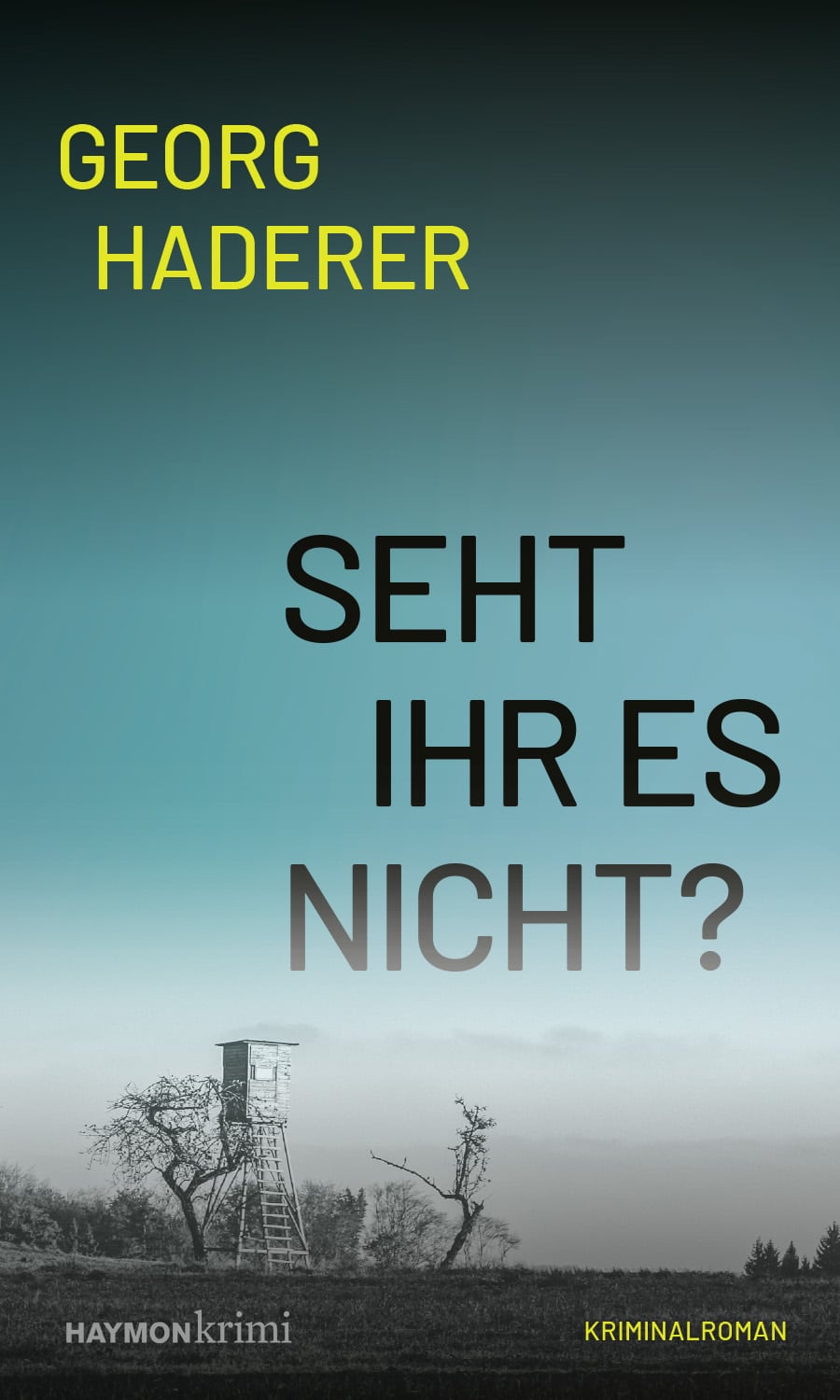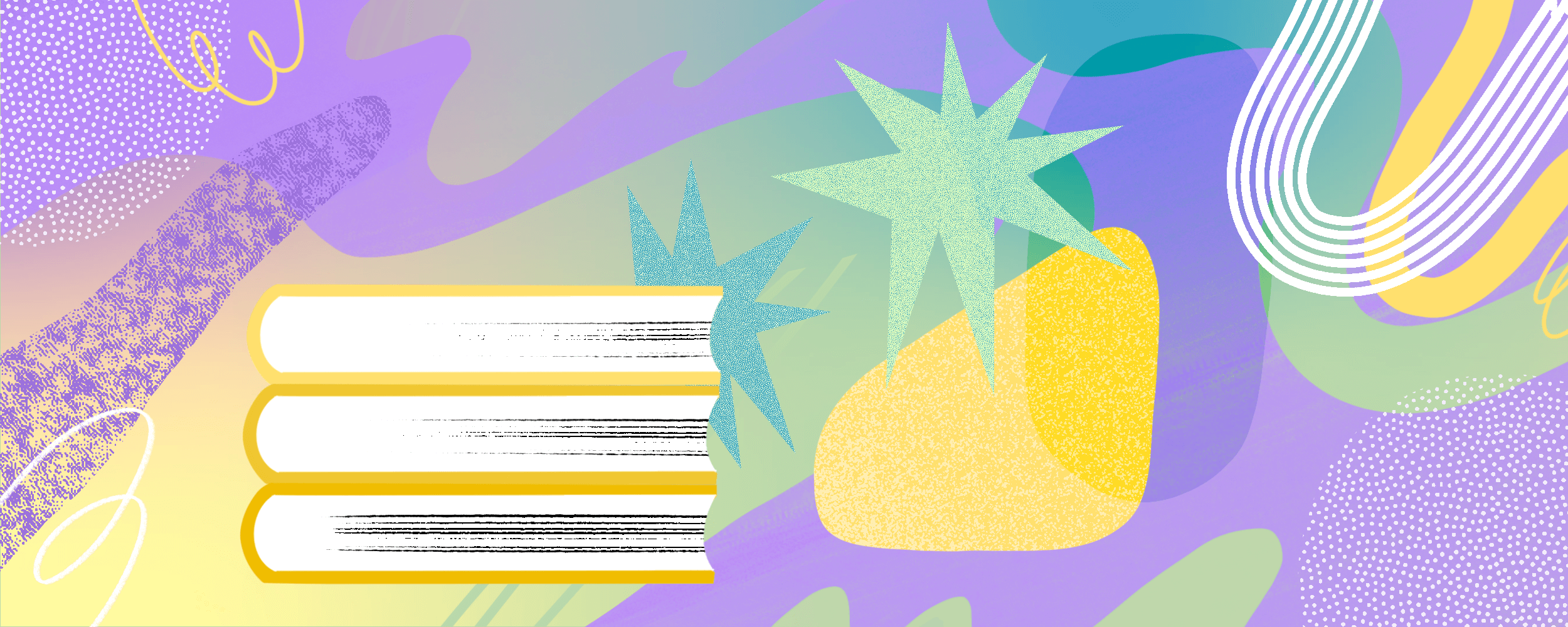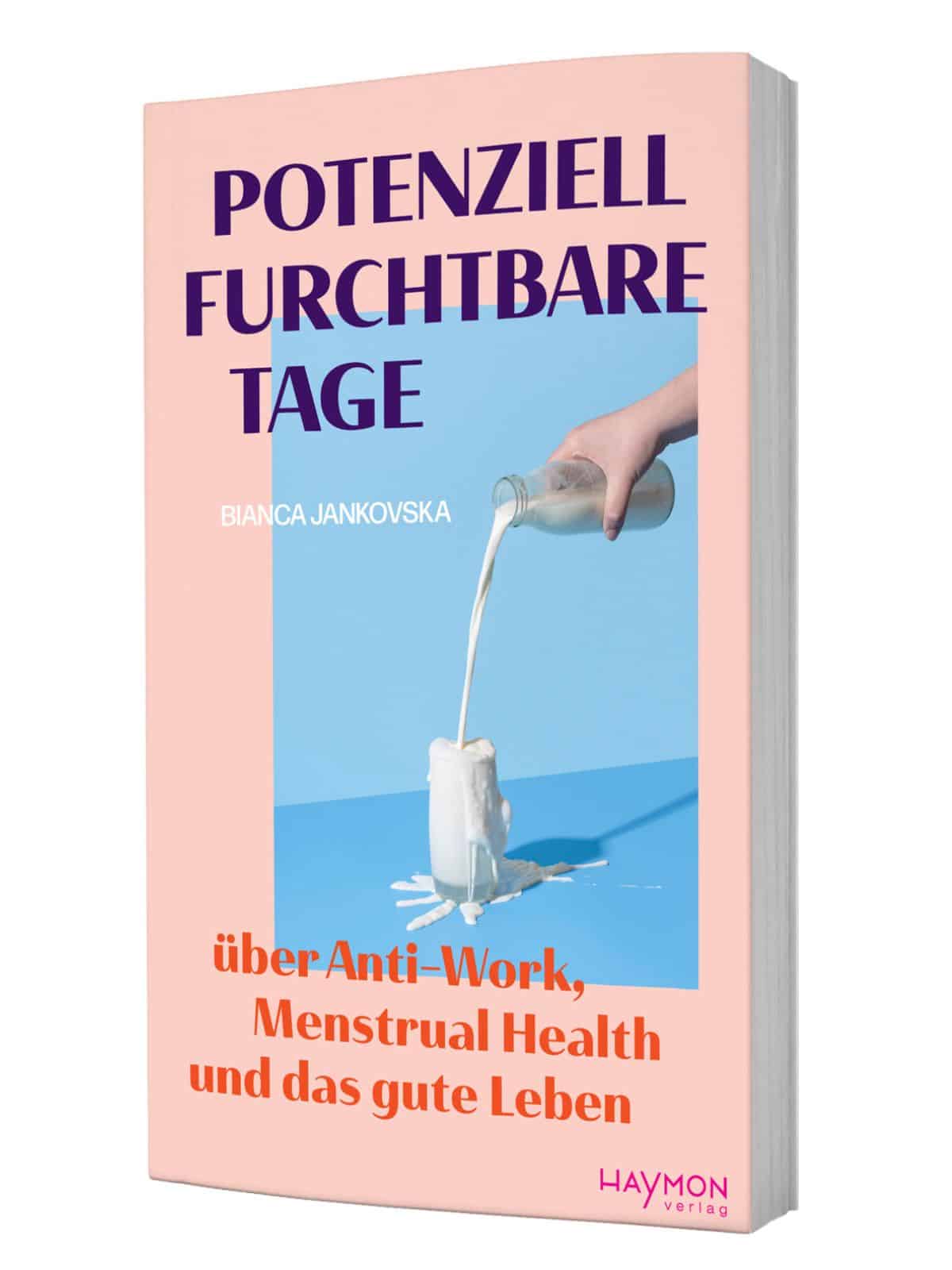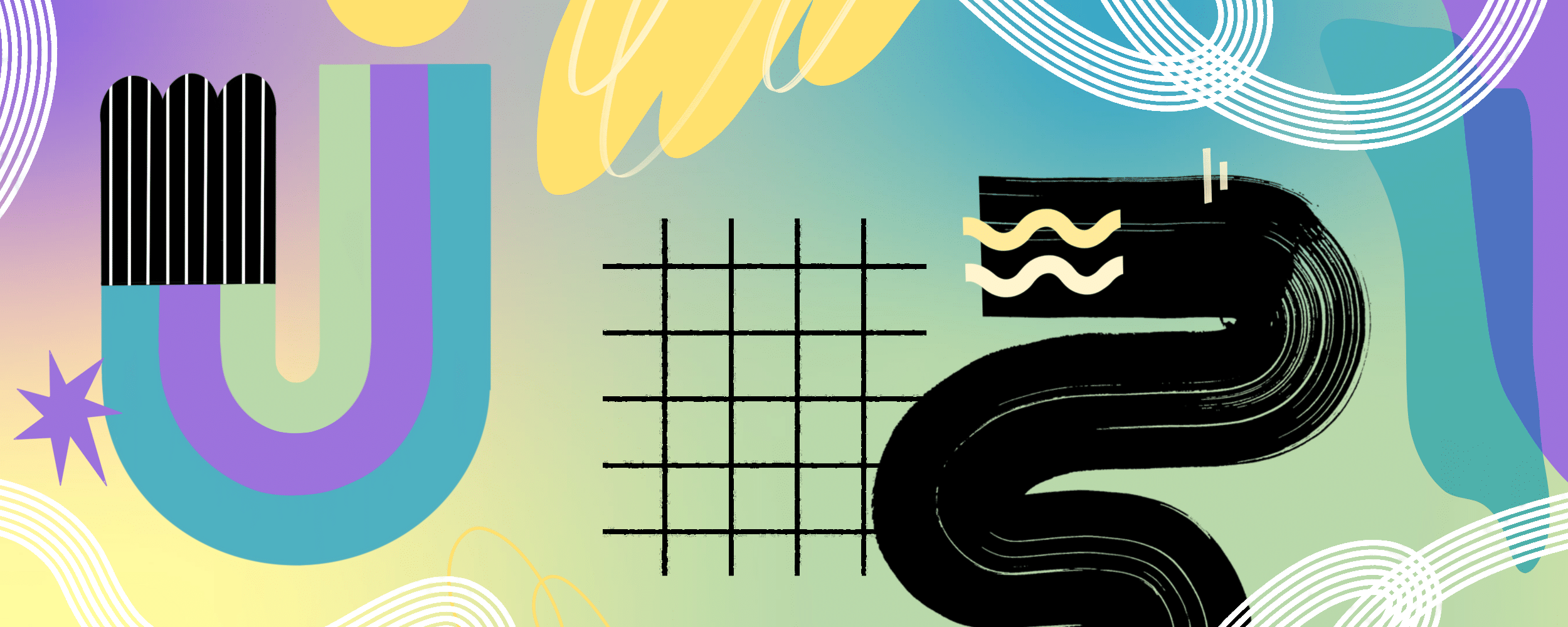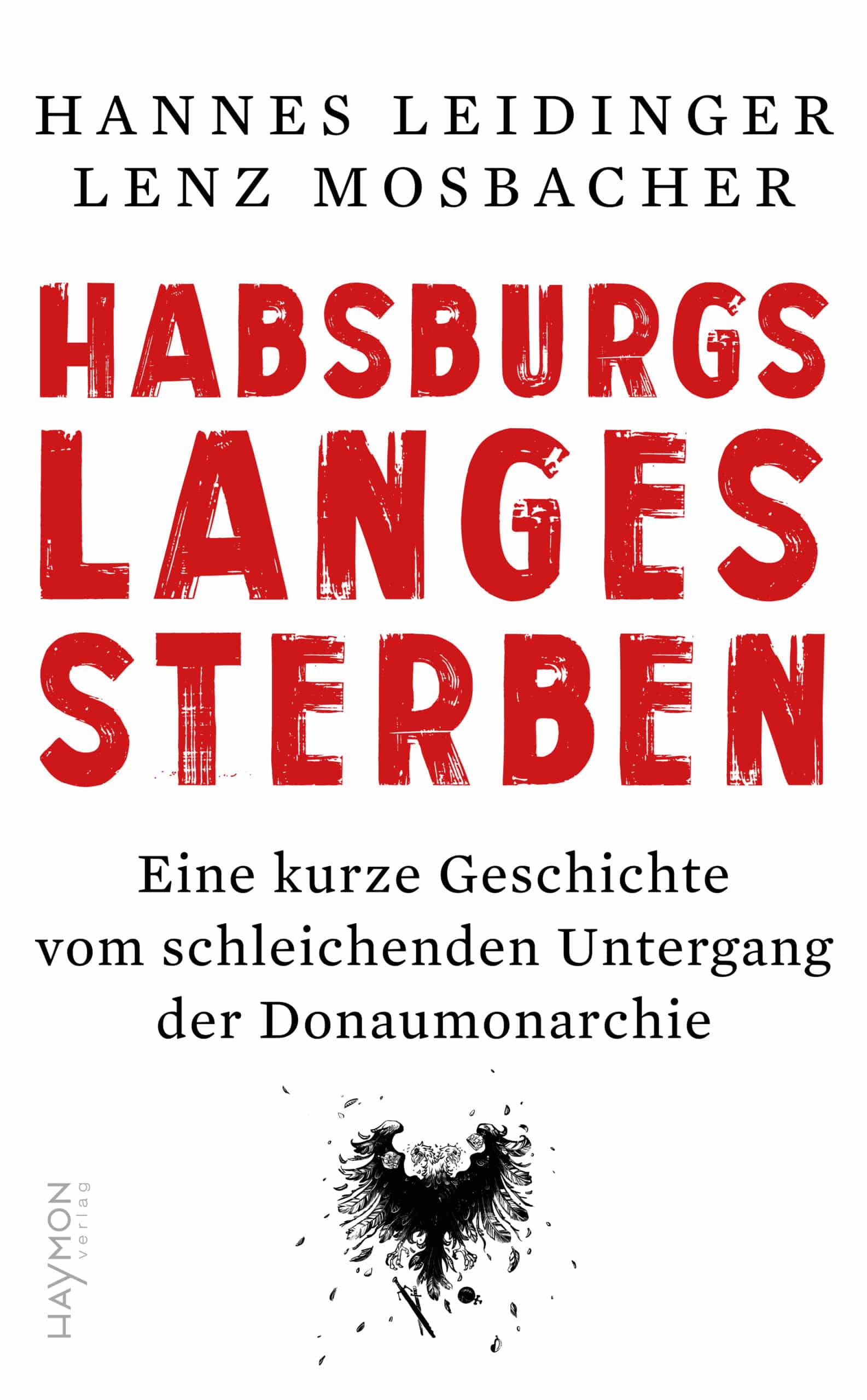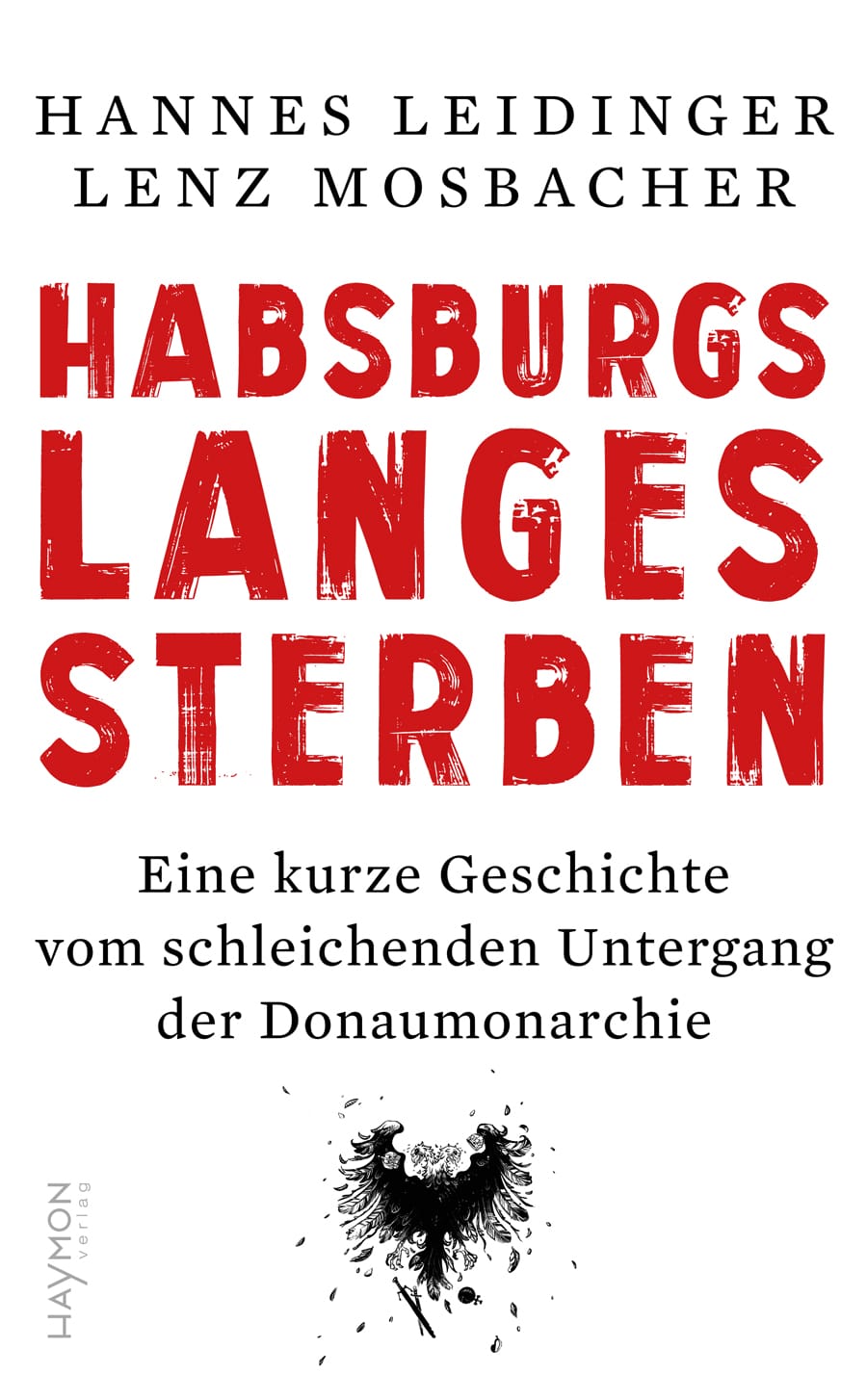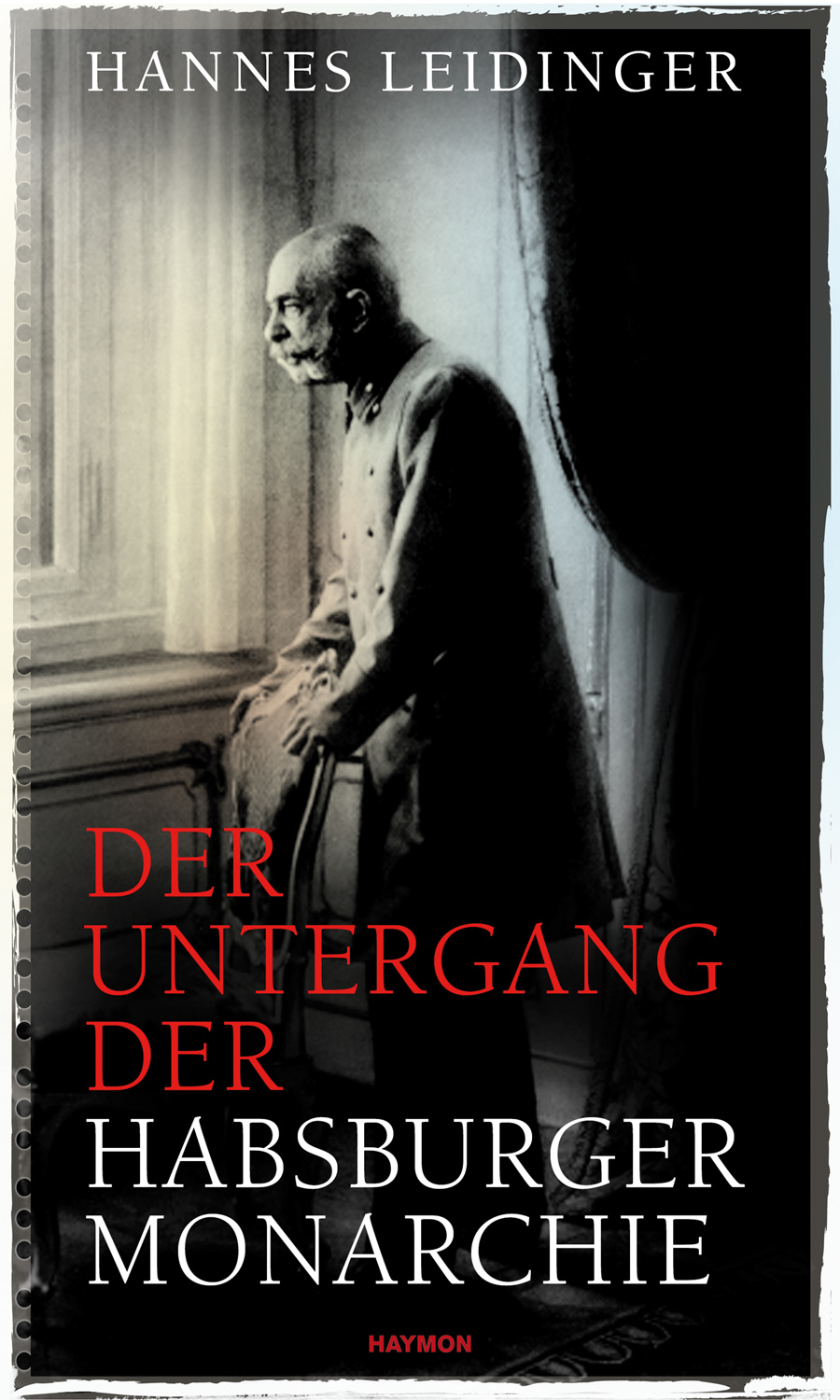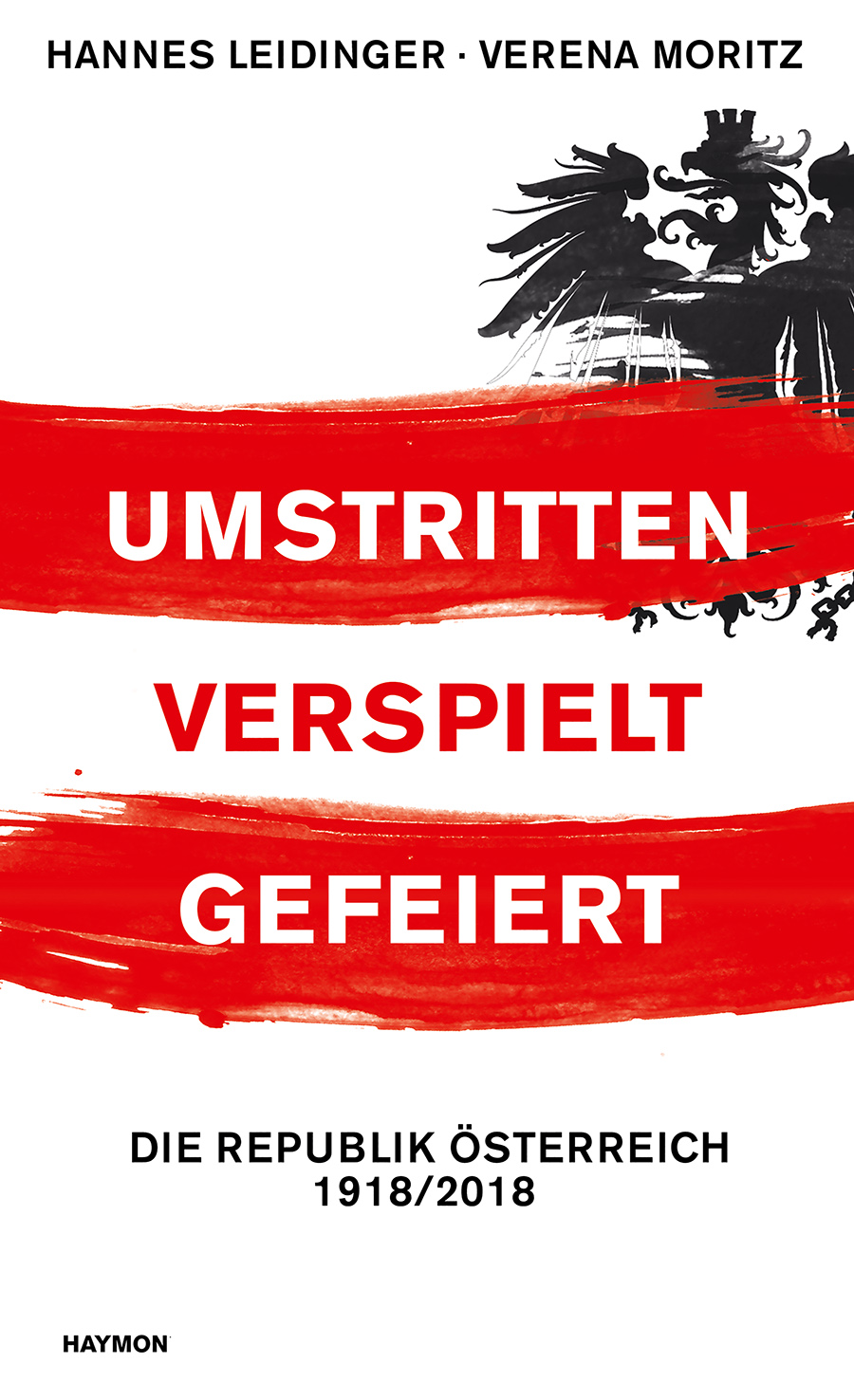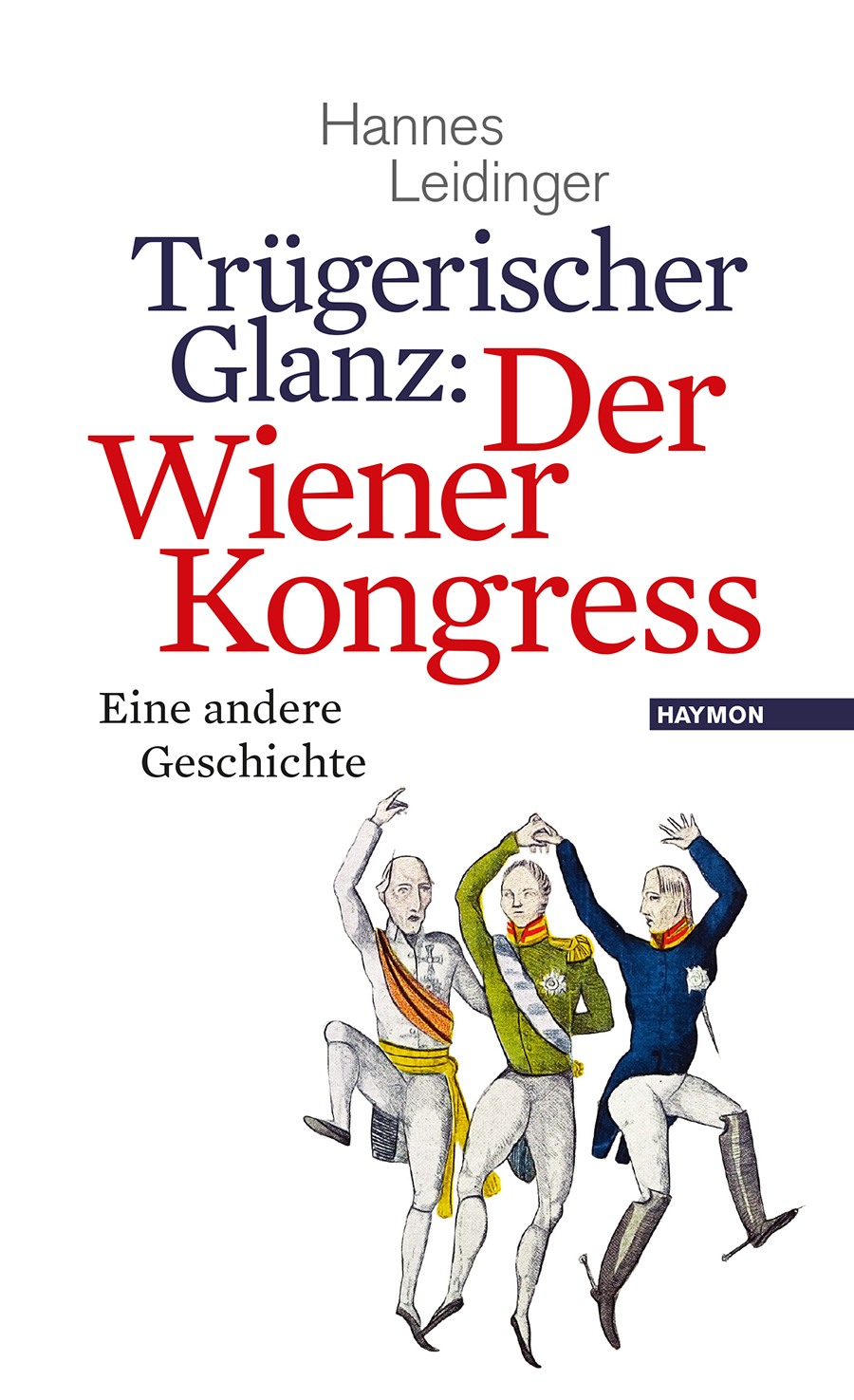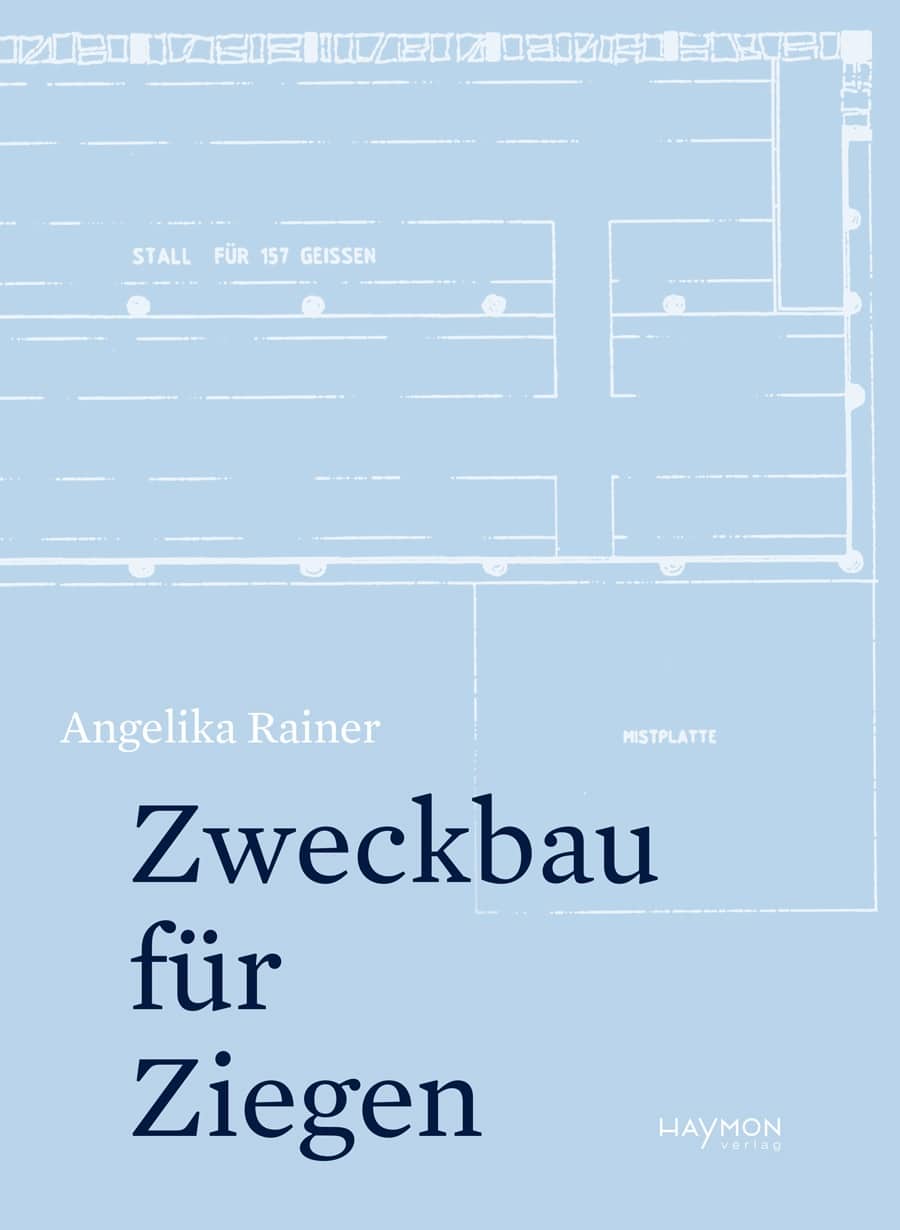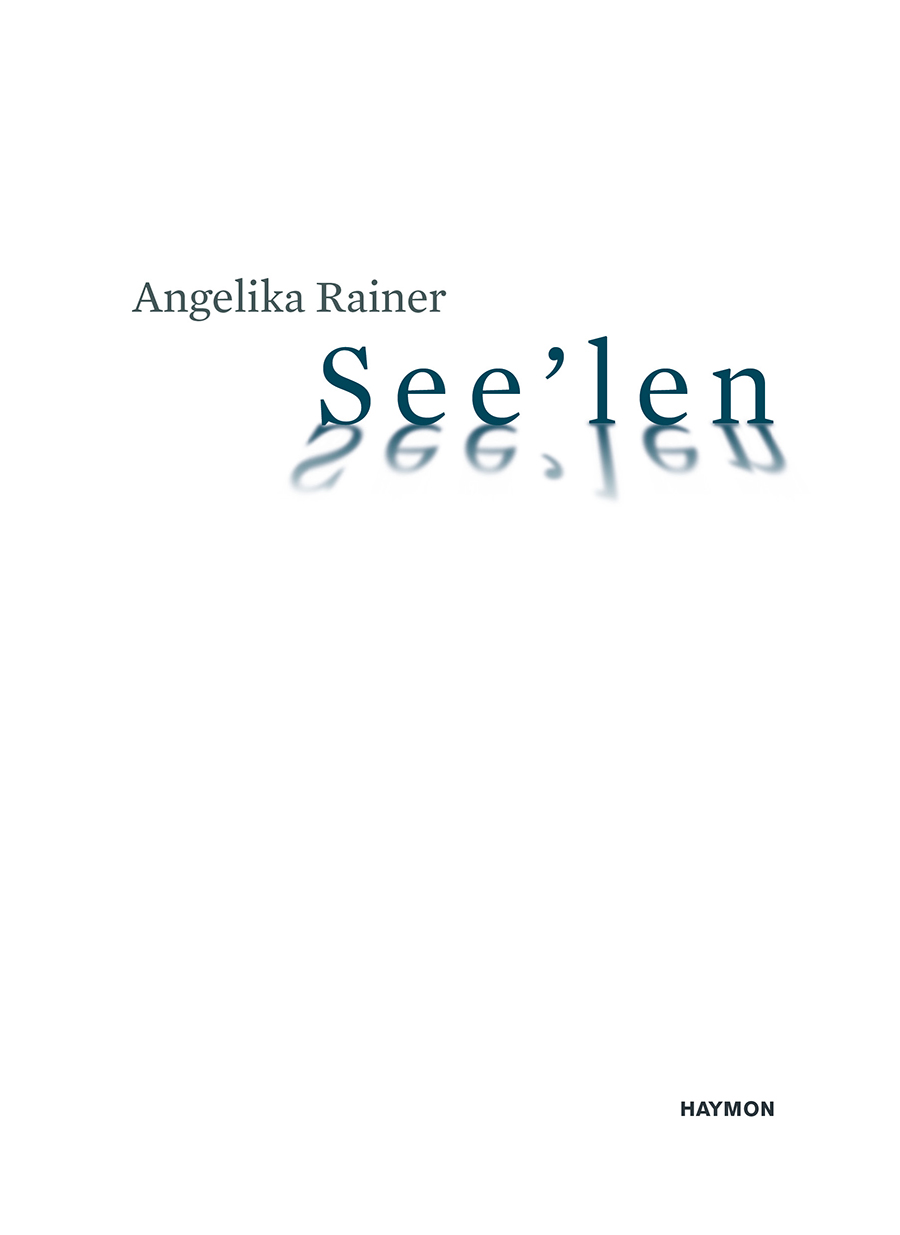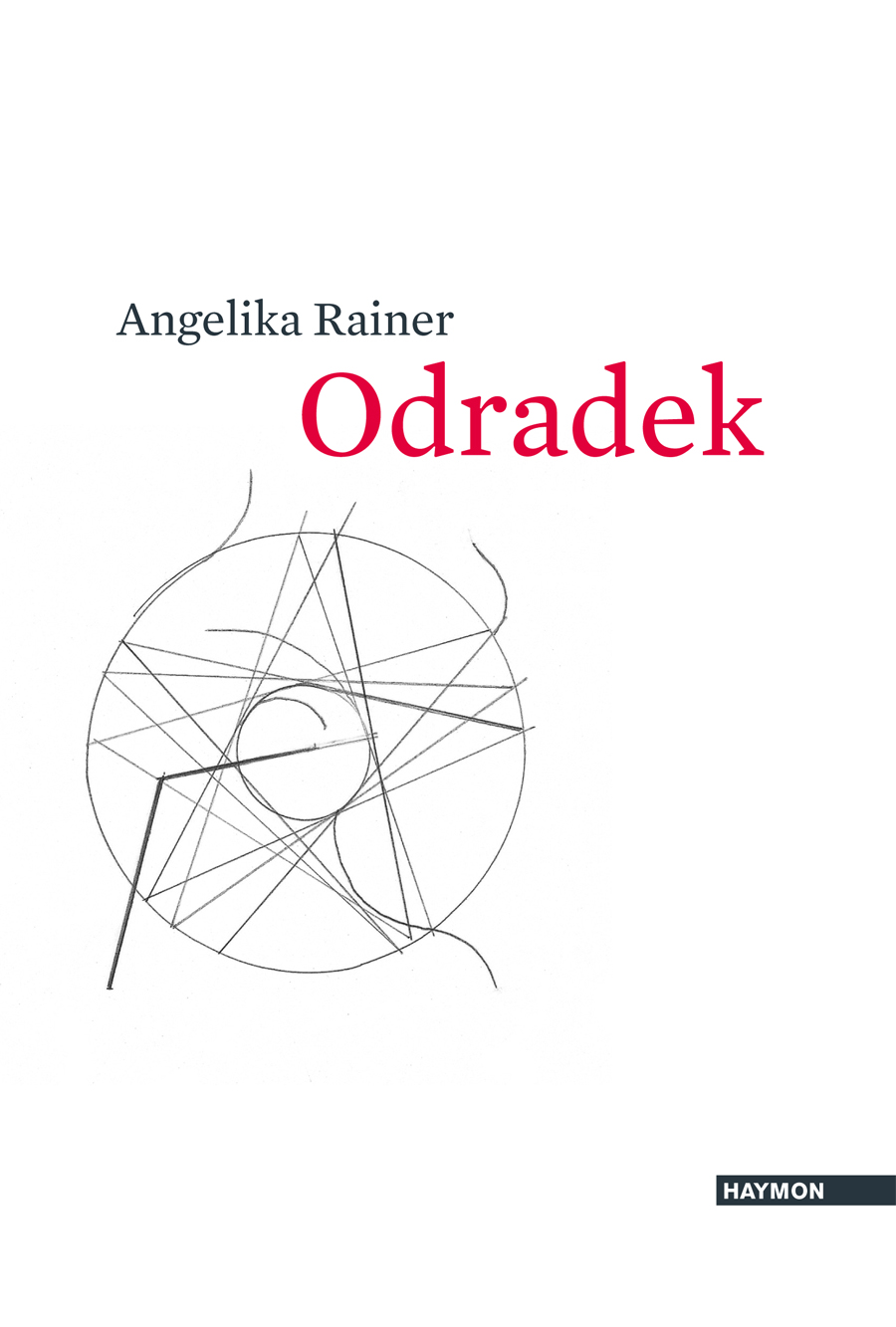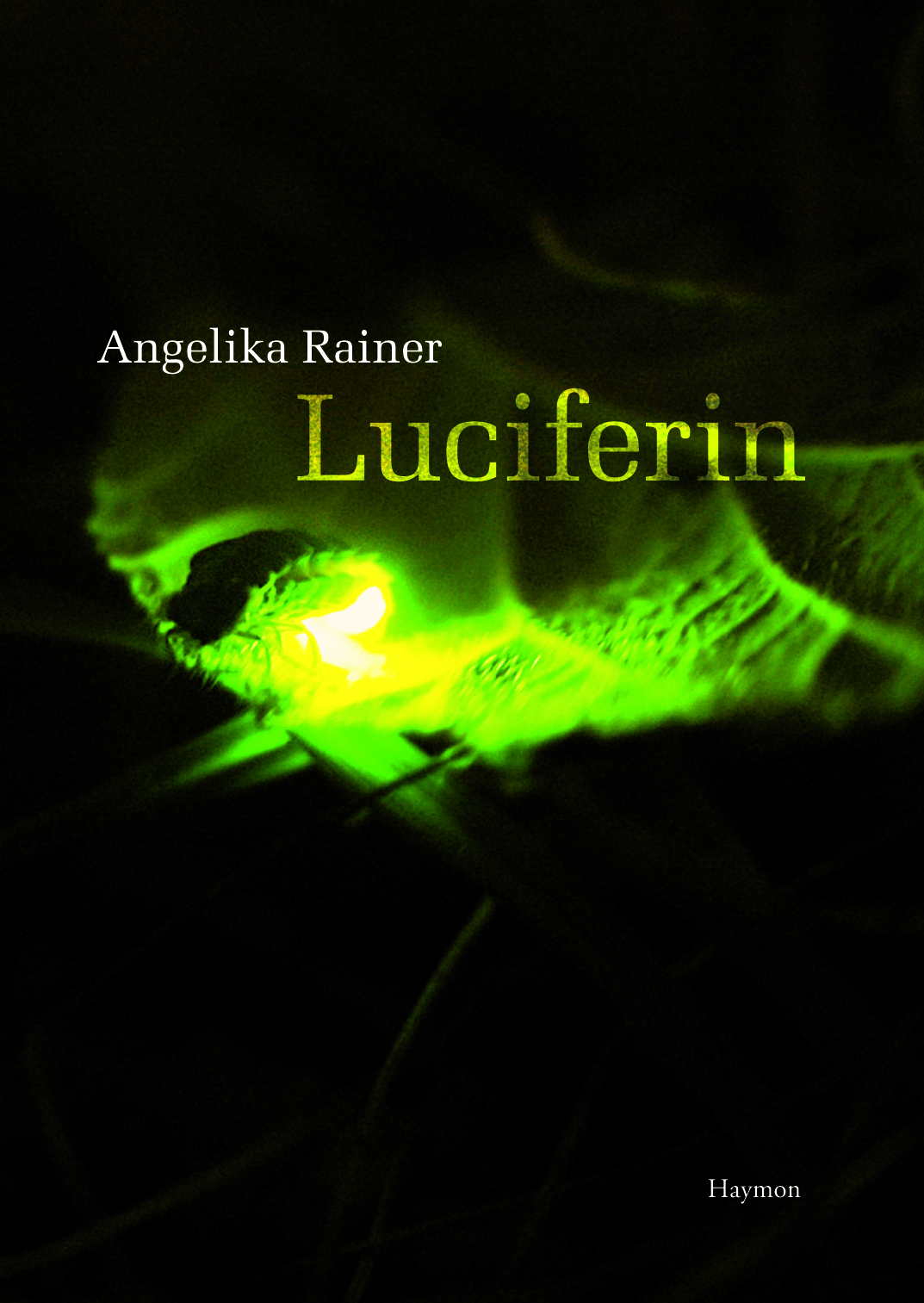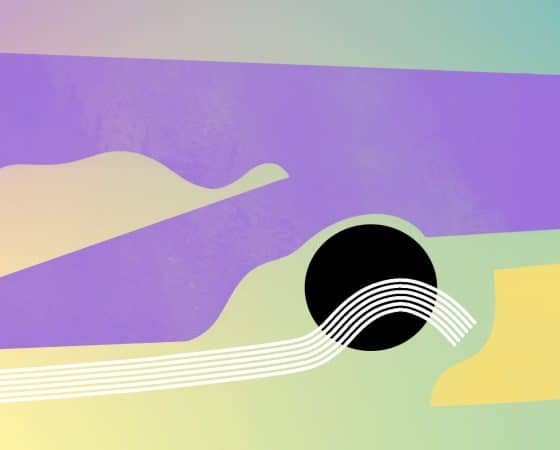Im Oktober 2021 veröffentlichte die Universität Rostock die Fortschrittsstudie „Sichtbarkeit und Vielfalt“. Die Leiterin der Studie, Prof. Dr. Elizabeth Prommer, bilanzierte: „Die Ergebnisse zeigen, dass unser Fernsehprogramm noch nicht die Vielfalt der Bevölkerung abbildet.“ Bei queerer Repräsentation wird festgestellt, dass „nur rund 2 Prozent der im Beobachtungszeitraum erfassten Personen nicht heterosexuell waren.“ Sichtbar wurden nur homosexuelle (0,9%) und bisexuelle (1,3%) Charaktere. Bei 27,4% war die sexuelle Orientierung „nicht erkennbar“.
Weiterführende Erhebungen und repräsentative Zahlen für alle anderen Medienbereiche im deutschsprachigen Raum gibt es bisher nicht. Das möchte die Queer Media Society unter anderem ändern.
Über die Kontrolle von Emotionen und die Emanzipation unserer Gefühle: Leseprobe aus „Chaos“ von Yassamin-Sophia Boussaoud
Je weniger man in gesellschaftliche Normen passt, desto größer ist es: das äußere und innere Chaos. Als Kind eines tunesischen Vaters und einer deutschen Mutter wird Yassamin-Sophia Boussaoud in Prien am Chiemsee geboren und spürt die Unterschiede der beiden Kulturen bereits früh auf sich einwirken. Yassamin-Sophia wird aufgrund des Aussehens anders behandelt, sieht sich mit Erwartungen und Konventionen konfrontiert, denen man kaum gerecht werden kann. Was folgt: Elternschaft im Teenageralter, ein von Ablehnung geprägtes Körperbild, das Unterdrücken der eigenen Gefühle. In „Chaos“ wird deutlich, welches Machtgefüge unserem System zugrunde liegt – und dass die Kontrolle von Emotionen ein Teil davon ist. Doch was geschieht, wenn wir uns diese Emotionen zurückholen? Mit dieser Leseprobe bekommst du einen Einblick in Yassamin-Sophia Boussaouds Buch, das mit einer literarischen und eindringlichen Stimme genau dort ansetzt, wo es wehtut, und uns aufhorchen lässt – Essays, die wir brauchen!
Epilog
Eine meiner merkwürdigsten Eigenschaften ist sicherlich die, dass ich bei jedem Buch das Ende zuerst lese. Ich kann einfach nicht anders. Schlage ich ein Buch auf, so überkommt mich die unbändige Sehnsucht, das Ende zu kennen.
Manch eine*r würde dies auf meine Ängste und meinen Hang zur Kontrolle schieben.
Ich hege diese Eigenschaft aber lieber als Besonderheit. Als wesentlichen Teil meiner Eigenheiten, von denen ich eine ganze Menge habe.
Das hier, das ist mein Buch.
Und ich wäre nicht ich, würde dieses Buch, diese Geschichte nicht mit dem Ende beginnen.
Ich schrieb dieses Buch im Frühling 2024 zu Ende – in einem für mich sehr aufregenden Jahr. Es ist das erste Jahr in meinem Leben, in dem die Sicherheit überwiegt. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, lebe in finanziell einigermaßen sicheren Umständen und erwarte mein drittes Kind. Mein Leben ist gerade sehr simpel. Ich habe Armut und Wohnungslosigkeit überstanden, bin darüber hinweg, dass ich mein Studium abbrechen musste, und Heilung ist mittlerweile mehr als ein Ziel in weiter, weiter Ferne. Ich glaube, es ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mit meinen vielen Gefühlen nicht mehr überfordert bin. Dass ich weiß, warum ich so fühle, so viel fühle. Und warum das in Ordnung ist.
Vor vielen Jahren, als ich ganz frisch begann, mich von meiner Herkunftsfamilie zu lösen und meine Traumata aufzuarbeiten, schrieb ich folgende Sätze:
“Ich bin zuweilen eine wirklich unmögliche Person! Ich halte mich selber für etwas ‚Besonderes‘, gehe davon aus, die Gefühlswelt anderer genau erfassen zu können und bade nur allzu gerne in Selbstmitleid und Melancholie. Von Kindesbeinen an hatte ich das Gefühl ‚Ich bin anders‘. Ich war neidisch, ohne es zu bemerken. Ich war eine Träumerin. Das Abwesende erschien mir so viel angenehmer als die Realität. Ich bin kleiner als diese Welt, ich verneige mich in Demut vor ihr und ihrer vollkommenen Schöpfung. Vollkommen bin ich wahrlich nicht. Davon war ich überzeugt.”
Wenn ich das heute lese, dann muss ich einerseits schmunzeln, andererseits habe ich Mitleid mit meiner jüngeren Version. Ich war früher schier besessen davon, mein Leben und meine Gefühle zu ordnen und „ein guter Mensch“ zu sein. Ich dachte, ich müsse meine Existenz rechtfertigen und „wieder gutmachen“.
Dabei war ich einfach ein sehr junger Mensch, dem in der Kindheit und im Jugendalter Gewalt angetan wurde. Der mit 16 plötzlich erwachsen werden musste.
Über die Jahre habe ich gelernt, dass meine Gefühle valide sind – die daraus folgenden Handlungen jedoch nicht immer.
Ich habe gelernt, dass der Schlüssel nicht darin liegt, das Chaos in mir aufzulösen, sondern es zu verstehen. Mich verstehen zu lernen. Und dass Selbstliebe keine Bedingung ist.
Ich würde heute nicht mehr behaupten, dass ich mich selbst liebe. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob dies jemals so sein wird. Aber ich bin mir heutzutage ein*e Freund*in. Was bedeutet, dass ich manchmal sanft zu mir bin und manchmal hart zu mir sein muss. Dass ich keine Ausreden wie „Nicht alle müssen mich mögen“ oder „Solange ich selbst weiß, was richtig ist“ nutze, sondern mich mitunter auch zwinge, zuzuhören, zu lernen und Veränderung zuzulassen. Denn ich bin nur ein einziger, letztendlich unbedeutender Mensch in diesem unendlich großen Universum. Und ich glaube, dass es mehr als genug Menschen gibt, die auf sich schauen. Ich möchte mich bewusst dazu entscheiden, auf andere zu schauen. Zusammenhalt, Care Arbeit und der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen den höchsten Stellenwert in meinem Leben zu geben. Ich möchte eine*r von Vielen sein. Mich selbst nicht zu wichtig nehmen und mir gleichzeitig meinen Raum nehmen und zugestehen. Das ist nicht einfach, und es ist nichts, was man einmal lernt und dann kann.
Ich glaube, es ist meine größte Erkenntnis, dass es kein Ende, kein Ankommen, keinen Zustand gibt, in dem wir als Menschen fertig sind. Dass unsere Gefühle keinen Anfang und kein Ende haben. Dass wir nicht allgemeingültig lernen können, wie wir zu welchem Zeitpunkt mit unseren Gefühlen umgehen. Dass Gefühle nicht linear sind, keine Einbahnstraße.
Ich und wir sind Wesen aus Sternenstaub. Wir sind alles, was gewesen ist, ist und sein wird. Wir sind besonders und gewöhnlich zugleich. Wir sind Menschen. Nicht mehr und nicht weniger.
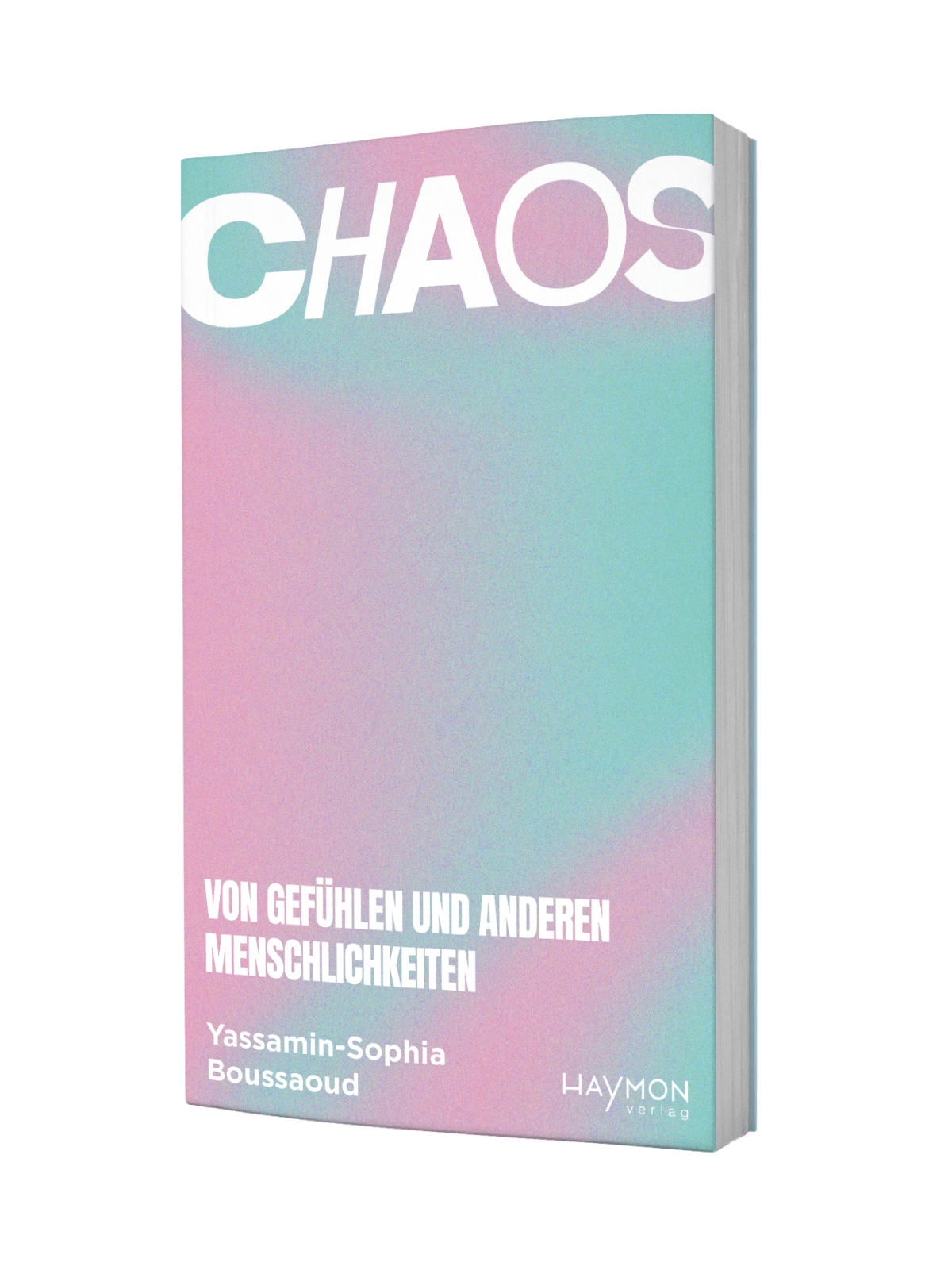
Von der Unruhe
Als ich noch nicht wusste, wie diese Welt sein kann,
da war es so viel einfacher zu sein.
Ohne nachzudenken.
Nur ich selbst. Getragen von Füßen,
die keine Angst davor hatten, Unbegangenes zu begehen.
Geleitet von Gedanken, die nicht davor zurückscheuen,
meine zu sein.
Als ich noch nicht wusste, wie viel Schmerz möglich ist,
da war es so viel einfacher zu lieben.
Ohne nachzudenken.
Einfach zu fühlen.
Geleitet von einem Herzen, das keine Angst kennt,
das zu erkunden, was man* Leben nennt.
Als ich noch nicht wusste, wie unschön es sein kann,
sich zu erinnern, da war es noch wichtig,
immer alles zu erleben. Nichts auszulassen.
Um jeden Preis dabei zu sein.
Als ich noch nicht wusste, wer ich bin, war ich traurig.
Ich wusste nicht, dass der Kummer die Freude umarmen kann.
Und dass sie für immer verbunden meinen Weg mir weisen.
Vielleicht weiß ich manches.
Vielleicht weiß ich nichts.
Aber doch, dass meine Füße mich auch tragen, wenn die Angst mich überkommt.
Dass mein Herz so vieles verstehen und vergeben kann, aber nicht muss.
Ich weiß, dass all meine Fehler mir zeigen, dass es das ist, was wir Leben nennen.
Dieses Chaos aus Versuchen, Fehlern und Gefühlen.
Unter dem Begriff Unruhe verstehen wir einen Zustand, in dem Ruhe fehlt oder auch ein Zustand ständiger Bewegung. Unruhe kann innerlich stattfinden oder äußerlich sichtbar sein.
Die Unruhe, die ich meine, ist jene, die sicherlich viele Menschen mit Migrationshintergrund kennen und ebenso wie viele marginalisierte Menschen, Menschen, die in der Gesellschaft Diskriminierung erfahren, sie kennen. Die unruhige Suche nach Antworten, nach einem Zuhause. Die Sehnsucht danach, Boden unter den Füßen spüren zu können.
Kantaoui, Osttunesien, 1. August 2022
Die Sonne ist vor wenigen Minuten erst aufgegangen, die Hitze jedoch bereits deutlich zu spüren. Ich laufe die wenigen Meter von meinem Zimmer zum Strand. Da liegt es vor mir. Das glänzende Mittelmeer: sanft, regelmäßig atmend. Der salzige Duft neckt mich.
Ich schlüpfe aus meiner Jibba, lege meine Chleka ab und gehe ins Wasser. Es empfängt mich, umhüllt mich, trägt mich. Ich muss aufpassen, denn hier in der Bucht gibt es jede Menge dieser kleinen, durchsichtigen, harmlos wirkenden Quallen, deren Stiche so brennen. Seit ich hier bin, hat mich die ein oder andere schon erwischt. Ich schwimme ein Stück weiter hinaus, wo es weniger werden. Wie lange ich nicht mehr hier war, kann ich kaum fassen. Mehr als 15 Jahre. So viele heimatlose Jahre. Ich versuche, nicht so viel nachzudenken. Nur zu fühlen. Das salzige Wasser auf meinen Lippen, den angenehmen Druck auf meiner Haut, die Morgensonne auf meinen raspelkurzen Haaren. Mein Atem in meinen Lungen. Meine Schwimmbewegungen. Das hier, ja, das ist der Ort, an dem ich gerade sein soll.
Das letzte halbe Jahr war ein Auf und Ab, wie ich es noch nie erlebt habe.
Ich musste mein Studium abbrechen. Meine Kinder mussten zu ihrem Vater ziehen. Ich war wohnungslos.
Wir hören sehr häufig, dass wir alles schaffen können – wenn wir es nur wirklich wollen. Und daran habe ich geglaubt. An dieses grausame Märchen. Ich war sehr ehrgeizig, machte mit 25 mein Abi nach und wollte mit zwei Kindern, alleinerziehend, in eine neue Stadt ziehen und studieren. Zu Beginn schien alles gut zu funktionieren. Wir hatten eine bezahlbare, kleine Wohnung in einem Studierendenwohnheim, mein Studium lief gut an, wir fanden schnell Anschluss. Nach einigen Monaten begannen die Schwierigkeiten. Ein BAföG-Antrag, dessen Bearbeitung sich über acht Monate zog und nicht voran ging, keine Unterstützung von meiner Herkunftsfamilie, keine Ersparnisse. Ich musste während des Studiums bis zu 35 Stunden die Woche in meinem alten Beruf als Kinderpfleger*in arbeiten, wenig später die Pandemie. Ich wollte all das schaffen. Denn weder wollte ich den Rest meines Lebens unter den schlechten Bedingungen und unterbezahlt als pädagogische Hilfskraft arbeiten, noch wollte ich die Person sein, die so früh Kinder bekommen hatte und es dann nicht geschafft hat. Ich wollte es unbedingt schaffen.
Aber in dieser Gesellschaft schaffen es nur jene mit ausreichenden und vor allem den richtigen Privilegien. Dazu gehörte ich auf jeden Fall nicht.
Ich will nicht zu viel darüber nachdenken. Die Angst nicht zu viel Raum einnehmen lassen. Denn diese Gedanken machen mich unruhig, rufen die Rastlosigkeit in mir hervor, der ich versuche zu entkommen. Nicht zu viel darüber nachdenken. Einfach schwimmen. Hier, an diesem Ort, den ich nicht kenne, der aber meine Heimat ist. Mehr als jeder andere Ort auf der Welt vielleicht. Langsam füllt sich der Strand. Menschen nutzen hier die Morgen- und Abendstunden zum Schwimmen, tagsüber ist es zu heiß. Daran lassen sich Tourist*innen erkennen. Wenn sie in der Tageshitze am Strand liegen, dann gehören sie eigentlich nicht hierher.
Ich schwimme zurück, gehe aus dem Wasser und ziehe meine Jibba wieder an, schlüpfe in meine Chleka und wünsche ein paar bekannten Gesichtern einen guten Morgen: „Sbeh el – khair“.
Diese Sprache, die irgendwo in meinem Kopf wohnt. Ich konnte sie sprechen, sie ist Teil von mir, aber ich kann sie nicht greifen. Alles was ich heute noch hinbekomme, sind ein paar einfache Floskeln, simple Sätze. Wie ein kleines Kind, das gerade sprechen lernt. Ich hasse das. Zurück am Haus wasche ich meine Füße in den Eimern, die hier vor jedem Eingang stehen. So halten sich die Menschen den Sand aus ihren Häusern. Ich bin darin aber ziemlich schlecht. In meinem Bett findet sich stets Sand. Nach einer kurzen, kalten Dusche hänge ich meine Sachen zum Trocknen auf, ziehe mir ein Kleid über und mache mir etwas zu essen. Ich röste Baguette über der Gasflamme, dazu gibt es Chamia – eine Paste aus Sesam, Zucker, Mandeln und Pistazien – und Feigenmarmelade. Es gibt hier noch keinen Kaffee in dieser Ferienwohnung. Ich schenke mir ein Glas Birnensaft ein und nehme eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank. Als Kind habe ich Wasser aus der Leitung getrunken. Nun geht das hier nicht mehr. Ich setze mich auf die hölzerne Couch, ziehe den Fliesentisch zu mir hin und frühstücke. Die Süße macht mich glücklich. Es schmeckt besser als in meiner Erinnerung. Erinnerungen. Sie schießen hier aus dem Boden wie kleine Pilze. Und ich kann sie nicht alle einordnen. Zu lange ist es her. Zu viel ist geschehen. Ich versuche mich auf mein Frühstück zu konzentrieren. Aber es geht nicht. Meine Gedanken wandern in eine Welt, die ich so lange verdrängt habe…
Der Duft von heißen Steinen und Brot umhüllt das kleine Haus, in dem meine Familie lebt. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eines für die Kinder, ein spärlich ausgestattetes Bad und eine Küche. Im Hinterhof steht eine Tabouna. Dort wird das Brot gebacken, das ich so gerne zum Frühstück esse. Meine Tante nimmt dicke Teigkugeln aus einer metallenen Schüssel, zieht sie in gleichmäßigen Bewegungen auseinander und wirft sie gegen die Wände des rundlichen Lehmofens. Es duftet so gut – nach Zuhause.
Wir Kinder sitzen alle um den weißen Plastiktisch in der Küche. Es gibt Saft, Fladenbrot, Chamia und Feigenmarmelade. Abends liegen wir alle zusammen im Wohnzimmer auf dünnen Matten, in bunte Decken gekuschelt. Ich darf neben meiner Ommi schlafen. Sie riecht nach Henna und Weihrauch, Knoblauch und Tomaten. Niemand muss alleine schlafen. Die Nächte sind kalt, aber hier in diesem Zimmer ist es warm. Ich kenne viele der Familienmitglieder nicht gut. Die meisten über Jahre nur vom Telefon. Meine Ommi kenne ich einerseits so gut und andererseits kaum. Mein Baba hat mir von klein auf all die Geschichten aus seiner Familie erzählt. Sie alle lebten, bis ich sie dann besuchen konnte, in dieser Utopie in meinem Kopf. Eine Familie, in der alle so aussehen wie ich. Mit brauner Haut, dunklen Augen und Locken. Eine Familie, in der ich einfach nur ich sein kann.
Mein Baba holt mich ab. Wir fahren nach Sidi Bou Saïd. Das ist die Stadt mit den blauen Fenstern und dem Café, das meinen Namen trägt. Yassamin. Überall blüht Jasmin. Die kleinen weißen Blüten zieren die Gassen und Gehwege. Die salzige Meeresluft kitzelt meine Nase. Ich war das Kind, das mein Baba immer in Cafés mitgenommen hat. Vielleicht, weil er meine Gesellschaft genoss. Vielleicht, weil ich in der Hinsicht recht unkompliziert war. In meiner Kindheit verbrachte ich viele Stunden mit meinem Baba in Cafés, lauschte seinen Gesprächen mit Freunden, beobachtete Menschen um uns herum und trank Pago Säfte aus kleinen, grünen Flaschen oder aß ein Mickey-Maus-Eis mit zwei kreisrunden Waffelblättern als Mäuseohren. Ich mag diese Erinnerungen. In Sidi Bou Saïd saßen wir in diesem Café, in das man nur über viele Treppen kam und von dem aus man das Meer sehen konnte. Ich trank dort Citronnade, die typisch tunesische Zitronenlimonade und Minztee mit Mandeln. Mein Baba trank wie immer Espresso. Manchmal rauchte er. Manchmal nicht. Manchmal redeten wir. Manchmal war die Stille zwischen uns der sicherste Ort auf dieser Welt.
Ich nehme einen kräftigen Schluck kalten Birnensaft.
Diese Erinnerungen schmerzen.
Sie erinnern mich an das, was ich so lange vermisste. Wärme. Diese Art von Wärme, die mir in Deutschland stets verwehrt blieb.