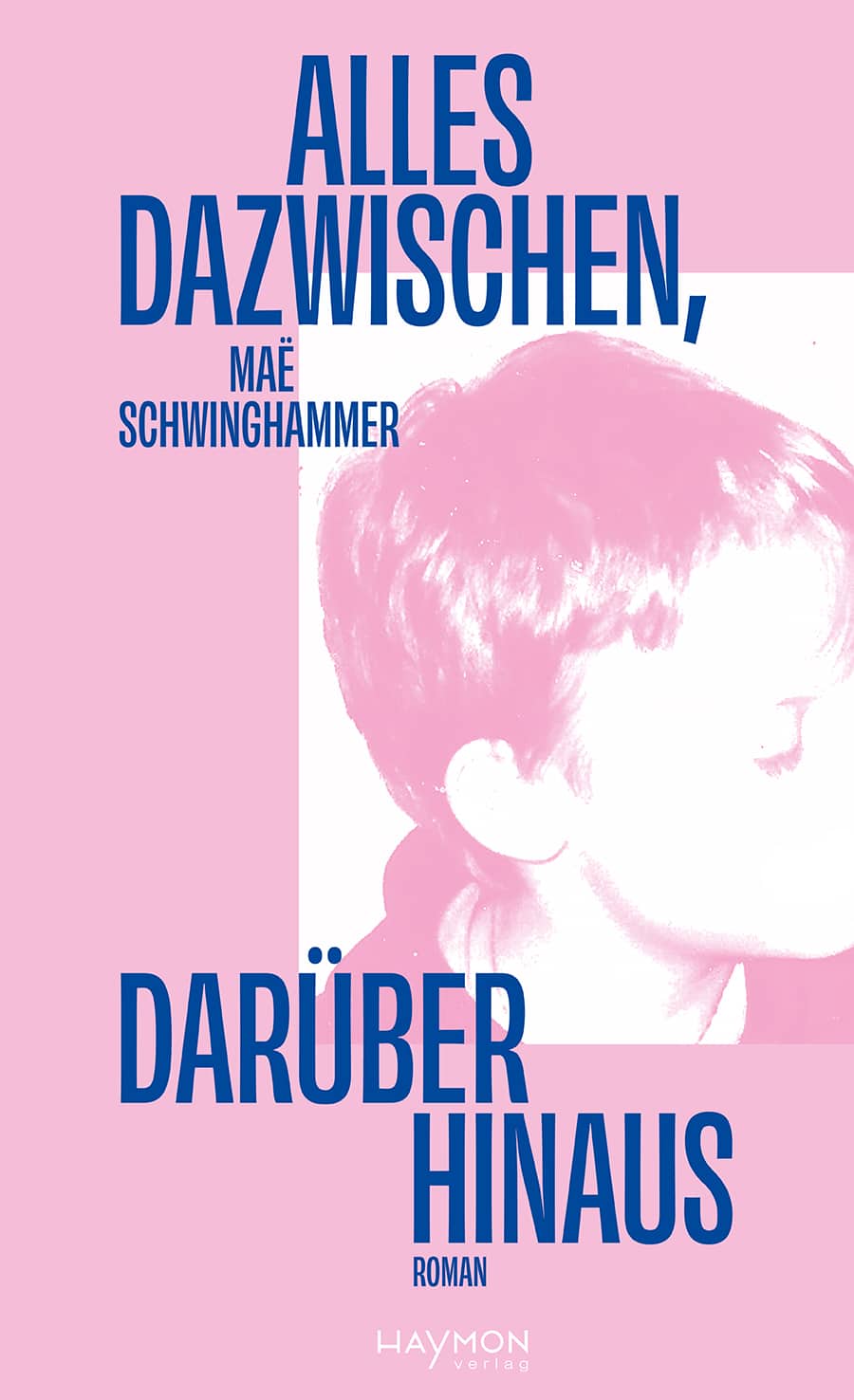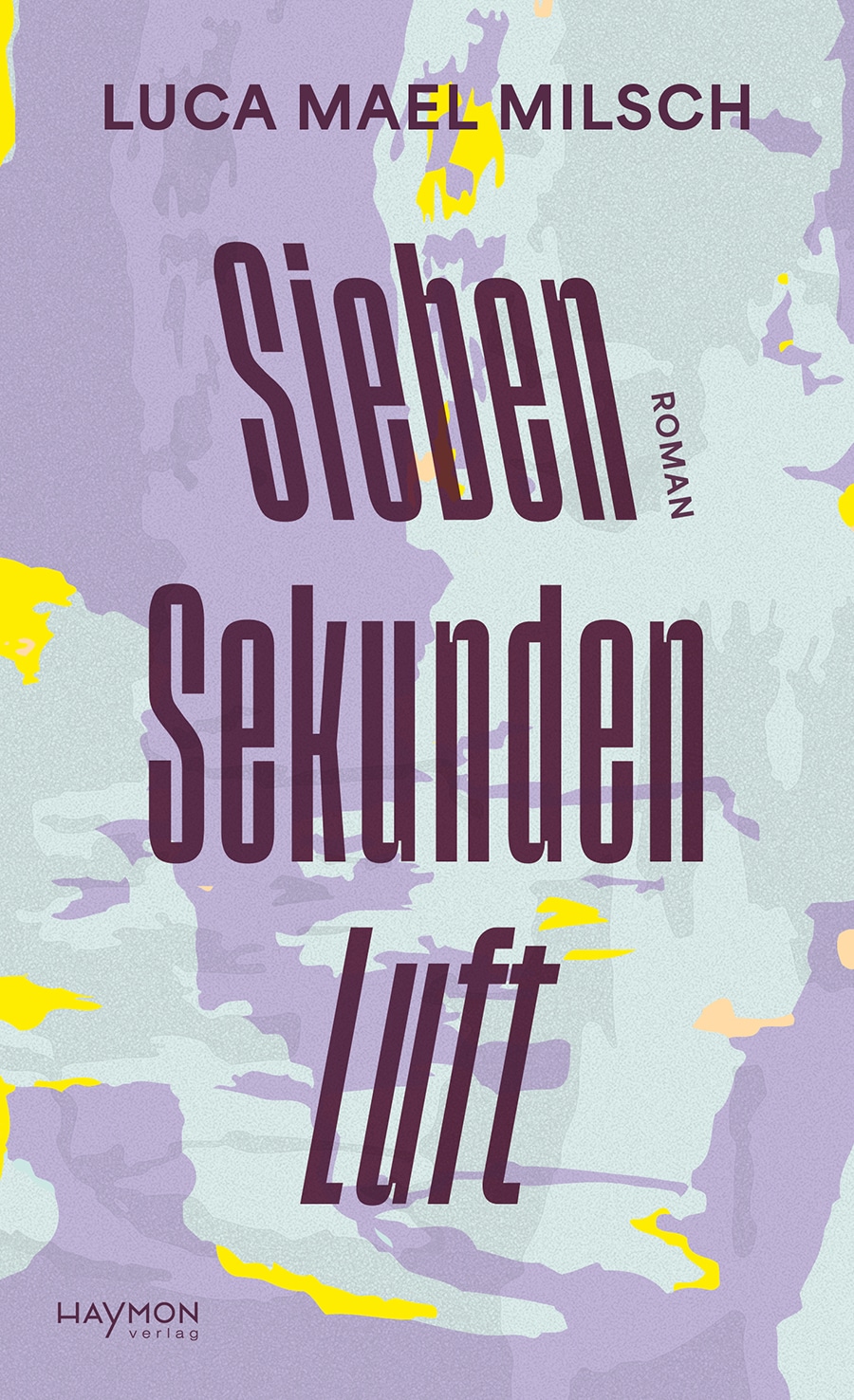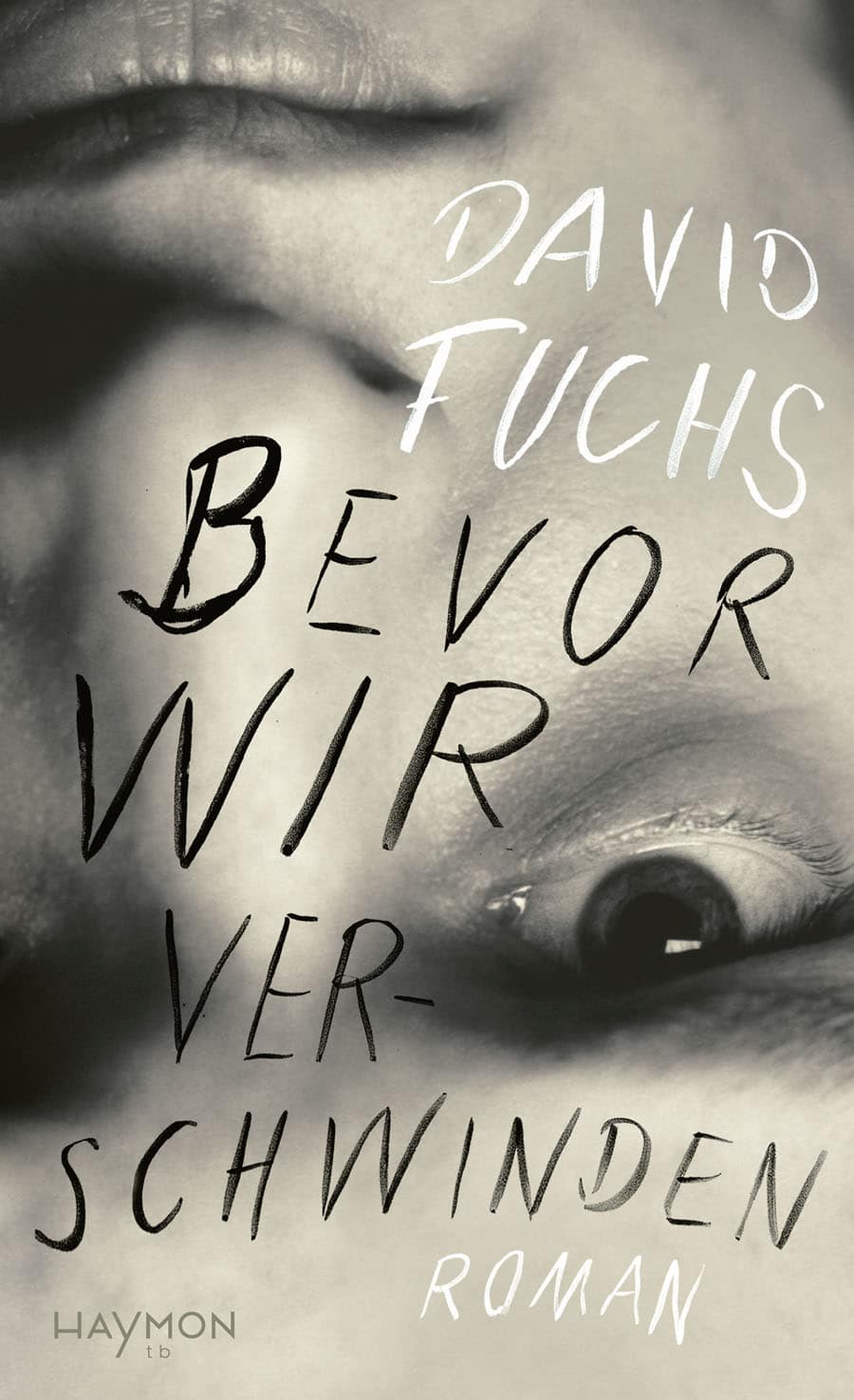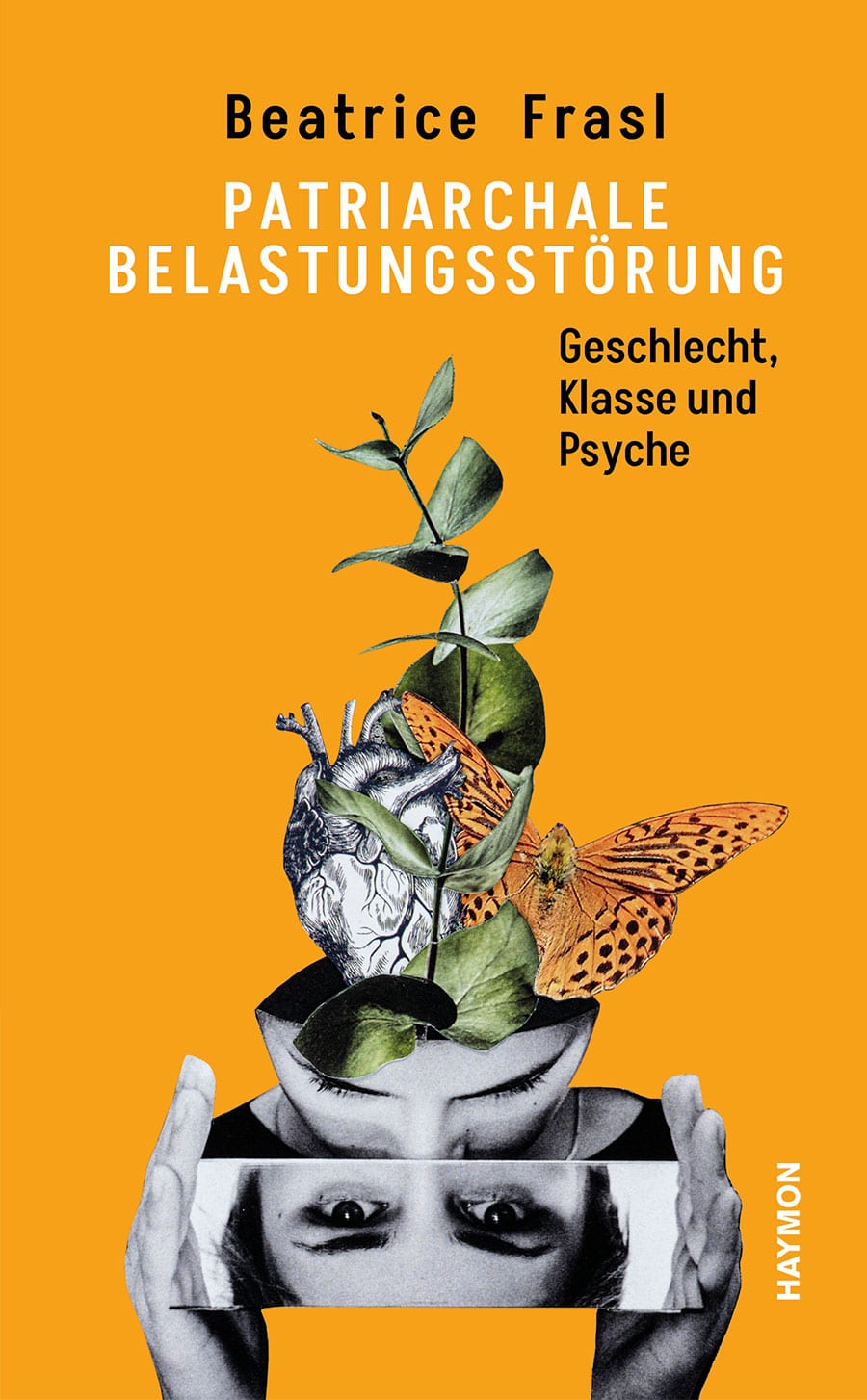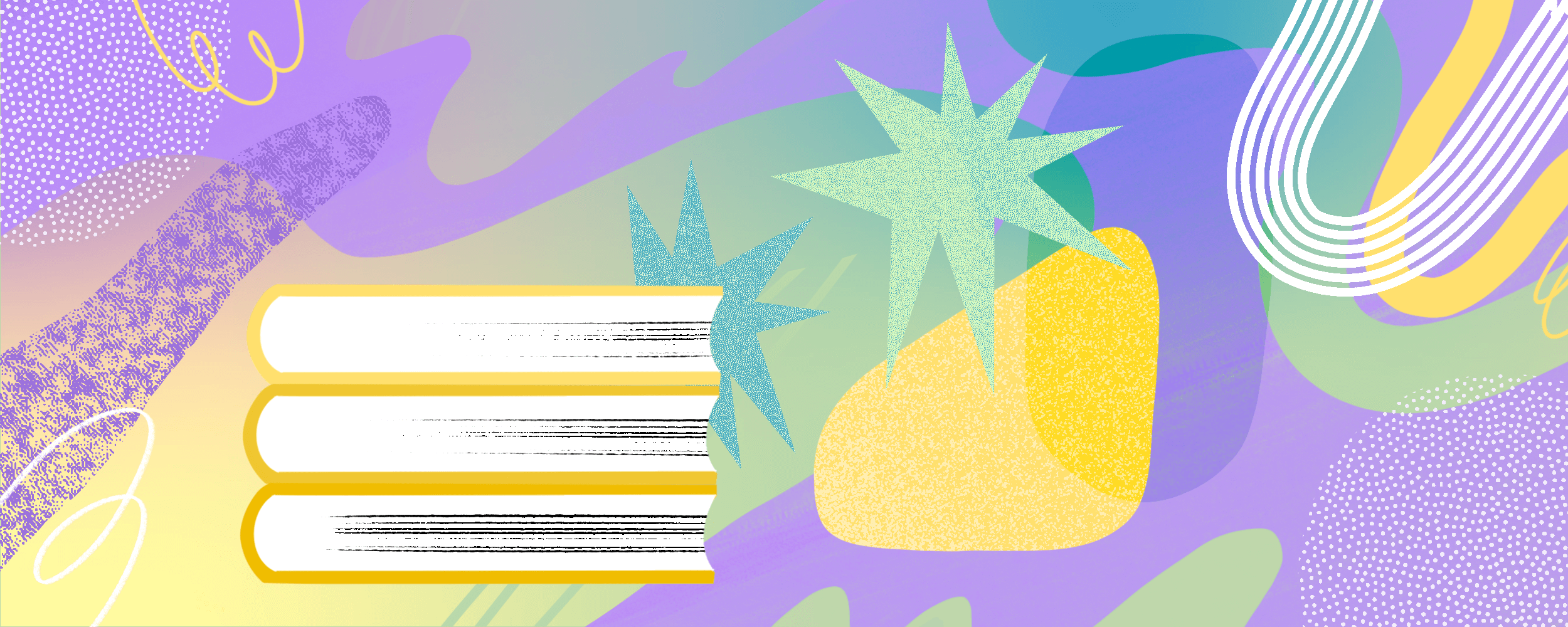
„Die Sprachlosigkeit hat sich in den Roman eingeschrieben” – ein Interview mit Michèle Yves Pauty
„Familienkörper” ist ein Debütroman mit erzählerischer Wucht über das Geflecht einer Familie, drei Generationen von Frauen, Medical Gaslighting und Gender Medizin:
Das Ich wächst im Tirol der 80er-Jahre auf, zwischen schneebedeckten Bergspitzen und dem schlammgrünen Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt, lebt im Olympischen Dorf. Wächst als gesunder Körper zwischen kranken auf. Großmutter, Mutter, Schwestern – Krankheit trifft alle. Nieren, Schilddrüse, Allergien, Erschöpfung, jede Geburt eine Opfergabe, Gebärmutterentfernung beinahe Tradition. Die Ärzt*innen reagieren nicht, wiegeln ab. Um sich selbst zu schützen, entfremdet die Ich-Figur sich immer mehr. Und beginnt dann doch, alles zusammenzusetzen, verwebt einen Familienkörper.
Wir haben uns mit Michèle Yves Pauty über das Debüt unterhalten.
Medical Gaslighting und Gender Medizin sind zwei zentrale Themen in deinem Roman, die eng miteinander verbunden sind. Dabei handelt es sich um strukturelle, kontinuierliche Problematiken, die doch immer noch sehr wenig thematisiert werden. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, genau diese Themen in einem Roman zu verarbeiten? Hat dich die Familiengeschichte dazu bewegt oder konntest du erst durch den Schreibprozess einordnen, dass diese Themen eng mit der Familie verknüpft sind?
Am Beginn des Schreibprozesses waren diese beiden Themen noch nicht bewusst als Schlagwörter in meinen Überlegungen vorhanden. Es war mehr ein Nachtasten, was diesen Familienkörper umtreibt, warum manche Episoden sich zu wiederholen scheinen, warum es so wenige Orte gab, zu denen Mitglieder meiner Familie gehen konnten. Ich wollte verstehen. Medical Gaslighting und Gender Medizin haben sich erst im Laufe des Schreibens als Themen herauskristallisiert, die inhärent mit der Gesundheit von Frauen im allgemeinen und besonders mit der meiner Familie zusammenhängen.
In deinem Roman erzählst du über drei Generationen von Frauen. Das Buch setzt bei allen drei Perspektiven in der Kindheit ein und berichtet über lange Spannen hinweg auch über ganze, unterschiedliche Jahrzehnte. Wie war es für dich, in diese verschiedenen Figuren, Leben und auch Zeiten einzutauchen, die du selbst nicht erlebt hast? Welche Herausforderungen gab es dabei?
Die erste Version waren elf Seiten, in denen eine Erzählstimme das Geschehen von außen beobachtet hat. Inhaltlich ging es damals ausschließlich um meine ältere Schwester, den Super-GAU in Tschernobyl und ihre Hashimoto-Diagnose. Als der Text länger wurde, war es nicht mehr möglich, mich aus den Erzählungen herauszuhalten. Die Stimme des Kindlichen wurde zum roten Faden für die Geschichte, sie bietet eine gewisse Chronologie in den Zeitsprüngen. An einem Punkt war alles von meiner Erinnerung dominiert, das war nicht, wie ich schreiben wollte. Zusätzlich gibt es die Erzählungen im Roman, die vor meiner Geburt stattgefunden haben. Um diese Episoden nah an den Personen zu gestalten, habe ich viel recherchiert und Interviews mit meinen Familienmitgliedern begonnen. Zuerst waren es nur gelegentliche Anrufe, „Wie war das damals mit Tschernobyl?“, aber irgendwann habe ich die Interviews in das Manuskript mit aufgenommen. Ich fand den Blick der anderen spannend, die Unsicherheit von Erinnerung. Immer wieder kamen vollkommen unterschiedliche Erzählungen über dasselbe Ereignis. Erinnerung ist wie Wahrheit, es gibt nicht eine, sondern viele subjektive.
Medical Gaslighting beschreibt eine Praxis, in der Krankheiten oder Symptome von medizinischem Fachpersonal nicht ernst genommen und heruntergespielt werden. Dabei wird Patient*innen nicht geglaubt und auch nicht zugehört und die Krankheiten oder Symptome werden als eingebildet oder (bei körperlichen Beschwerden) psychosomatisch abgesprochen. Wenn eine Diagnose nicht sofort feststellbar ist, werden auch oft keine weiteren Verfahren wie beispielsweise eine Überweisung oder eine Laboruntersuchung angeordnet. Davon sind vor allem Frauen und weiblich gelesene Personen betroffen, aber auch Menschen mit Mehrgewicht oder chronischen Erkrankungen und Menschen mit Rassismuserfahrungen.
Gender Medizin heißt, dass Krankheiten sowohl geschlechtssensibel als auch geschlechtsspezifisch untersucht, erforscht und behandelt werden. Gender Medizin beinhaltet die Auswirkungen von sex und gender auf Krankheit und Gesundheit. Das bedeutet, dass soziale und psychologische Unterschiede in der Medizin berücksichtigt werden, ebenso wie der Faktor, dass Symptome und Krankheiten aufgrund unterschiedlicher biologischer Voraussetzungen verschieden ausgeprägt sein können.
Das Ich im Roman wächst als gesunder Mensch zwischen und mit Kranken auf. Es entfremdet sich zum Schutz immer mehr von der Familie und dem Geschehen, um dann alles zusammenzusetzen. Wie war es für dich, diesen Familienkörper zu verweben, die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten?
Herausfordernd. Alle möglichen Emotionen sind aufgekommen. Zu Beginn war es spielerisch, bis mir aufgefallen ist, dass ich nur die angenehmen Episoden erzähle oder Stellen, die wenig mit mir zu tun haben. Dann bin ich chronologisch alles abgegangen, habe in einem halben Jahr das Grundgerüst des jetzigen Romans geschrieben. Mit dem Text habe ich zu diesem Zeitpunkt am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Eine Studienkollegin, Oliwia Hälterlein, hat damals in einer Textwerkstatt gesagt, „sie liest den Schmerz dieses Ich“. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass mir das bewusst wurde. Danach hat sich das Ende einfach gefunden. Ursprünglich war es nicht mein Plan, über die Entfremdung zu schreiben. Aber als es sich in das Manuskript hineingeschrieben hat, dachte ich mir, das will der Text.
Krankheit und gerade chronisches Kranksein sind auch heute oft noch eine Art Tabuthema. In unserer Gesellschaft gilt es, zu funktionieren. Das spiegelt sich auch in deinem Roman wider. Was muss sich diesbezüglich ändern und was können wir individuell für eine Entstigmatisierung und Enttabuisierung tun?
Ein Problem sehe ich in dem schulmedizinischen Zugang, der sich oft nur der Beseitigung der Symptome widmet und nicht den Ursachen. Ich hatte eine Zeit lang chronische Rückenschmerzen, worauf mir die Ärzte Schmerzspritzen angeboten haben. Damals war ich Anfang dreißig. Ich dachte mir, ich kann nicht jetzt schon mit Schmerzmitteln anfangen. Ich war schockiert, wie wenig die Ärzte daran interessiert waren, die Ursache zu finden. Unserer Medizin fehlt ein ganzheitlicher Zugang. Viele Erkrankungen haben multifaktorielle Ursachen. Und der Kapitalismus ist generell kein gesundes System, wie sollen wir darin gesund bleiben? Viele Dinge, die wir in der Vergangenheit als normal angesehen haben, brechen auf und zeigen, wie schädlich sie für uns sind/waren. Es ist eine Zeit der Wandlung.
In deinem Roman fragst du einmal: „Bin ich mein Körper, oder habe ich einen Köper?“. Der Roman lässt die Frage einfach stehen – kann man darauf überhaupt eine Antwort finden, wenn die Körperlichkeit und die Entscheidungen über den eigenen Körper gerade auch in einem medizinischen Kontext immer noch gesellschaftlich und politisch so fremdbestimmt sind?
Deine Frage beantwortet die meine bereits perfekt.
Im Roman wird immer wieder thematisiert, dass der Ich-Figur Erinnerungen fehlen, aber auch das Nichtvorhandensein von Sprache in der Familie ist ein zentrales Motiv. Durch deinen Roman gestaltest du sozusagen Sprachlosigkeit mit Sprache. Wie bist du hinsichtlich einer literarischen Form dafür vorgegangen?
Die Sprachlosigkeit hat sich in den Roman eingeschrieben. Bei der Form war ich konzentriert auf einen multiperspektivischen Blick, das Verhandeln des Ich mit der Mutter ist erst später dazugekommen. Hier wollte ich trotz der ungleichen Machtverteilung eine Art von Waagschale schaffen, wo beide Teile – aus unterschiedlichen Gründen – dasselbe Gewicht tragen.
Du bist Schriftsteller*in, aber auch Fotograf*in. In „Familienkörper“ hast du dich für eine bildhafte Sprache entschieden, beim Lesen wird deutlich, wie intensiv optische Reize, Licht, Räumliches auf die Ich-Figur wirken. Wie stark beeinflusst das Visuelle dein literarisches Schaffen, sind die beiden Bereiche für dich stark miteinander verknüpft?
Ich höre öfters, dass ich so schreibe, weil ich Fotograf*in bin. Aber wahrscheinlich bin ich Fotograf*in geworden, weil ich so wahrnehme. Und dasselbe gilt für das Schreiben, nur, dass ich dort tiefer gehen kann, als es mir mit der Fotografie möglich ist. Fotografie ist trügerisch. Wir interpretieren aufgrund eines Bildes, dabei kann die Bildunterschrift den gesamten Kontext ändern.

© Ian Ehm Iowres
Autor*in
Michèle Yves Pauty (*1982) hat Fotografie und Deutsche Philologie in Wien und Literarisches Schreiben in Hildesheim und Leipzig studiert. Pauty hat in diversen Magazinen und Anthologien veröffentlicht, 2021 folgte die Auszeichnung mit dem Hilde-Zach-Literaturförderstipendium. Pauty lebt in Wien und Leipzig und ist Teil des Künstler*innen-Kollektivs sy:rup. Im Februar 2025 erscheint das Debüt „Familienkörper“ im Haymon Verlag.
„Familienkörper” erzählt von der Geschichte mehrerer Frauenleben und von den Zusammenhängen zwischen Geschlecht, Herkunft, Klasse, Bildung und Gesundheit; ein großer, ein traurig-schöner Roman. Überall erhältlich, wo es Bücher gibt!