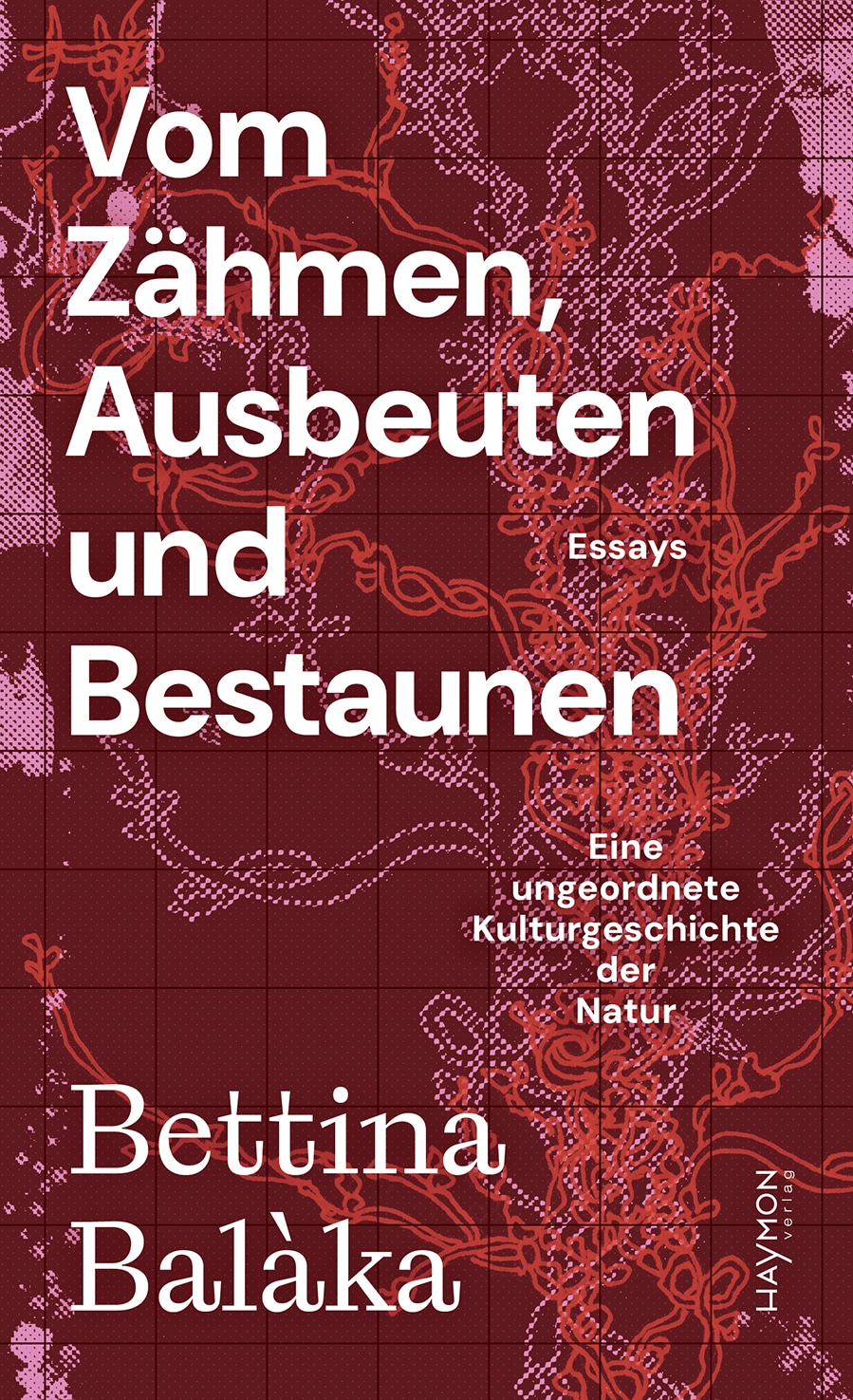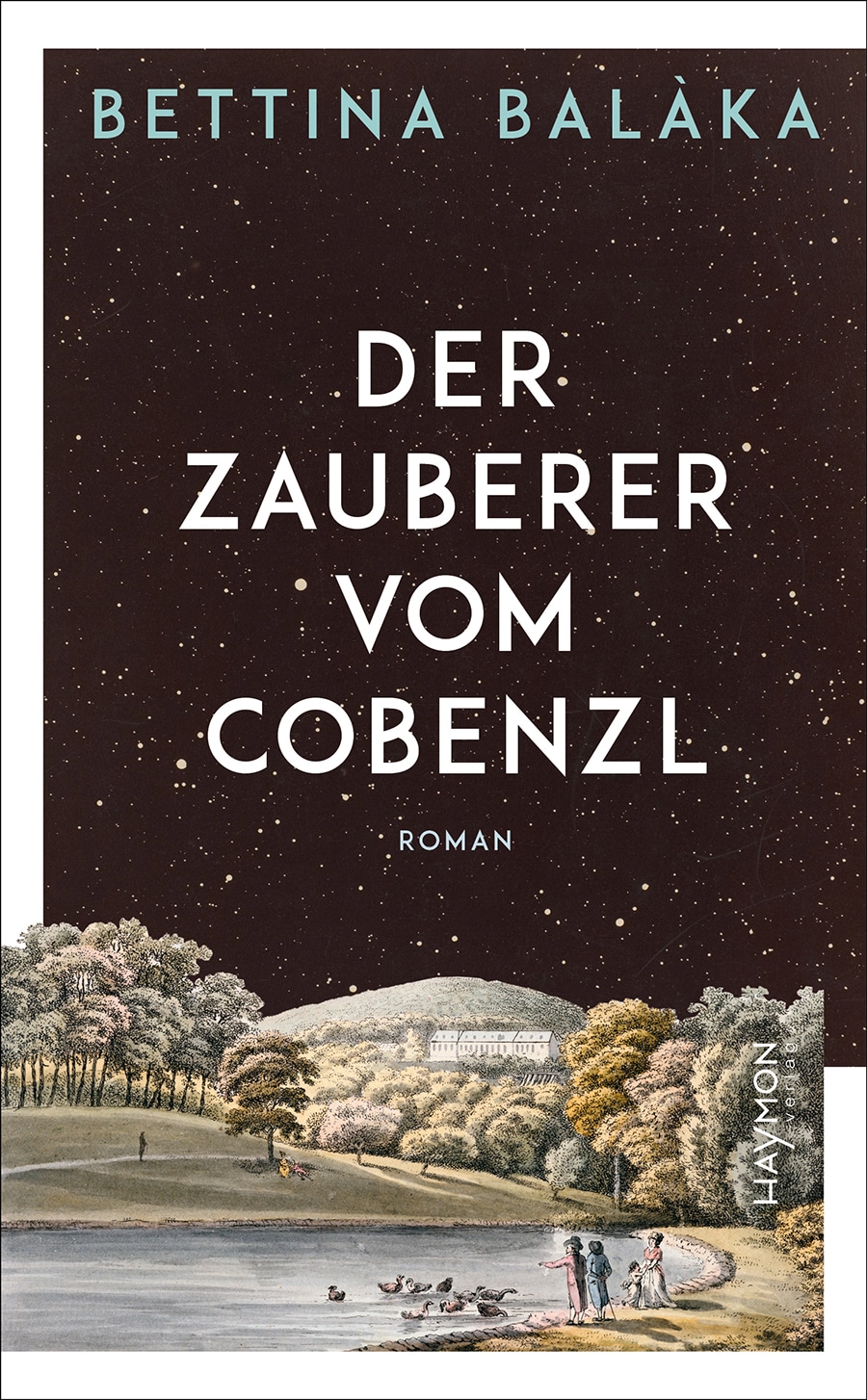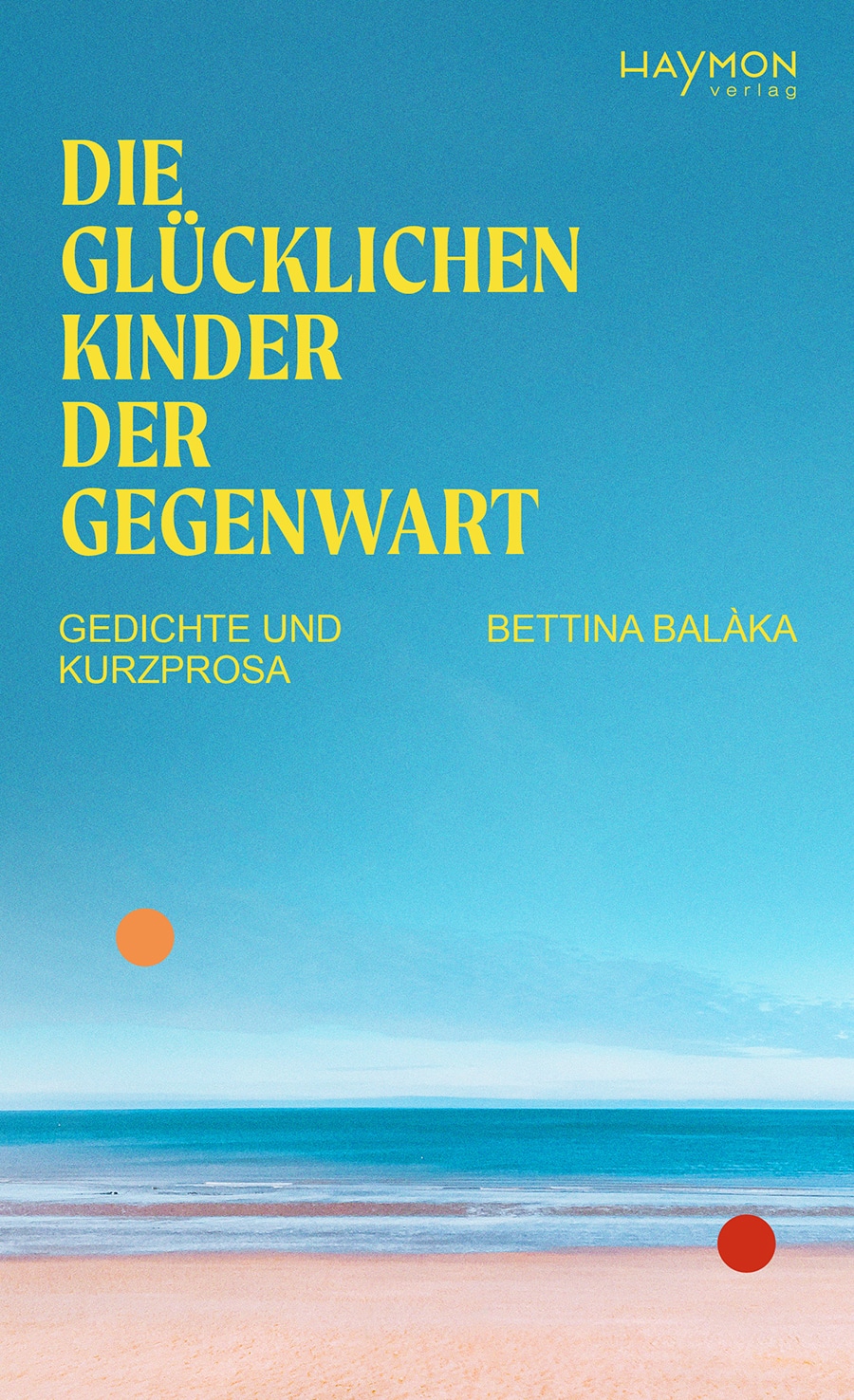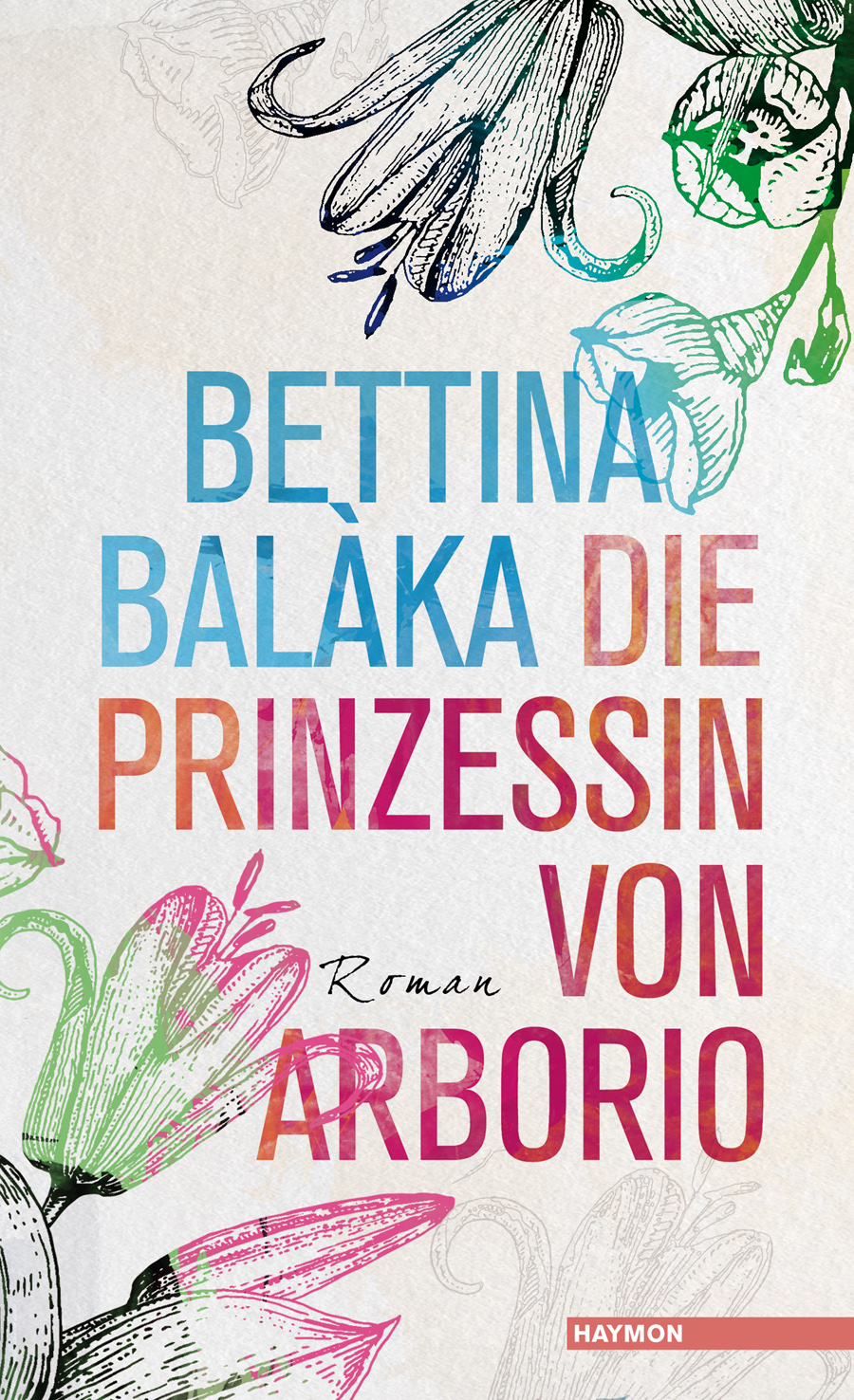Von Biber-Fieber und Naturzerstörung: Leseprobe aus Bettina Balàkas Essayband „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seinen eigenen Lebensraum zerstört. In unserer Gesellschaft kontrastiert das permanente Bedürfnis, Tiere, Pflanzen, Ökosysteme unter Kontrolle zu bringen und nutzbar zu machen, mit dem mittlerweile ebenso großen Bedürfnis, die Wildnis zu sehen, zu bereisen, zu genießen, der Natur nahe zu sein. Wir lieben und vernichten sie zugleich. Die Autorin Bettina Balàka versteht es, Geschichte, Forschung und literarische Erzählung über die Zerstörung der Natur durch den Menschen auf beeindruckende Weise zu vereinen. In einer Reihe von Essays arbeitet sie dieses ambivalente Verhältnis auf.
Beaver believer
Mit dem Biber verbindet mich eine lange Liebesgeschichte. Sie begann mit einem Kinderbuch. Es war Anfang der 1970er-Jahre, als die schlaue Bilderbuchserie „Meine erste Bücherei“ im Verlag Brönner Kinderbücher erschien, der ich auch Informationen über Piraten (besonders liebte ich die Doppelseite „Piratinnen“) oder Sauriern verdankte. Aus einem der Bände ist mir die Zeichnung von der Wohnstatt der Biber noch eindrücklich im Gedächtnis: von außen ein riesiger Ästehaufen mitten in einem Teich. Im Querschnitt aber, vom durchdringenden Auge des Illustrators gleichsam geöffnet, sah man die geschickte Anlage der Burg. Ihr Eingang lag unter Wasser, vor Raubtieren geschützt. Die Wohnhöhle selbst befand sich über dem Wasserspiegel im Trockenen. Das Biberelternpaar brachte Nahrung zu den dort in gemütlicher Sicherheit kuschelnden Babys.
Was mir das Büchlein nicht verriet und was ich erst gute vierzig Jahre später erfahren sollte, war, dass Biber ihre Jungen nach zwei Jahren rauswerfen. Auf die Straße setzen beziehungsweise auf den Fluss. Das hat seine biologische Sinnhaftigkeit. Da jedes Frühjahr neuer Nachwuchs kommt, muss der halbwüchsige ausziehen und sein eigenes Revier suchen. Da sitzt so ein heimatloser Biberjugendlicher dann tagsüber zitternd im Schilf und arbeitet sich nachts Flussläufe hinauf oder hinunter, durch fremde Biberreviere hindurch, wo er nicht gerade freundlich empfangen wird.
Während des ersten Lockdowns ist einem solchen Wiener Jungbiber ein besonderes Meisterstück gelungen: Nachts marschierte er durch dicht verbautes Wohngebiet sowie über eine normalerweise stark befahrene Durchzugsstraße, um die Wienerbergteiche, die er wohl von der Ferne gewittert hatte, als Erster zu besiedeln. Nun ist so ein Biber zwar ein Nagetier, aber alles andere als ein Mäuschen. Etwa einen Meter lang und bis zu dreißig Kilogramm schwer ist er im Wasser sehr wendig, an Land jedoch gemächlich unterwegs. Ich habe mir oft vorgestellt, wie dieser Biber nachts durch die Stadt schlurfte, ohne Wasser und ohne Nahrung (oder vielleicht fand er eine Pfütze, eine Grünflächenweide?), wahrscheinlich irgendwo in einem Loch oder Gebüsch übertagte, dank der Ausgangssperre unbemerkt und unversehrt.
Als ich die ersten leibhaftigen Biber sah, war ich selbst gerade von zu Hause ausgezogen. Es war in Kanada, wo Castor canadensis lebt, der nordamerikanische Verwandte des europäischen Castor fiber. Er sieht genau gleich aus, hat aber acht Chromosomen weniger, die er offenbar vor tausenden von Jahren auf der langen Reise über die Beringstraße verloren hat – man weiß nicht warum. Einen interessanten Unterschied im Verhalten hat man herausgefunden: Biberpaare bleiben, was für Säugetiere außergewöhnlich ist, ein Leben lang zusammen. Europäische Biberpaare sind dabei, wie DNA-Analysen der Jungen ergaben, einander bedingungslos treu, wohingegen ihre kanadischen Verwandten recht gerne fremdgehen. So mancher kleine Biber ist dort ein Kuckuckskind.
Ein weiterer Unterschied ist der Besiedelungsgeschichte geschuldet. Der amerikanische Biber hat viel mehr unberührte Natur zur Verfügung als der europäische und kann sie großflächig gestalten. Der größte Biberdamm der Welt wurde mit Hilfe von Bildern aus dem Weltall entdeckt. Er befindet sich im Wood-Buffalo-Nationalpark in Alberta, wurde über Jahrzehnte hinweg von vielen Generationen gebaut und ist achthundertfünfzig Meter lang. In ganz Nordamerika gibt es Anlagen, die über Jahrhunderte genutzt und immer weitergebaut wurden. Dabei ist es verblüffend, was diese Nagetier-Architekten ganz ohne Baumaschinen schaffen. Mit ihren Vorderpfötchen holen sie Schlamm vom Teichgrund, um ihren Bau immer wieder zu verputzen und damit regelrecht zu betonieren. Alte Burgen können so massiv sein, dass man sie sprengen muss, sollten sie einem menschlichen Bauvorhaben im Wege stehen.
An einem sonnigen Tag Mitte der 1980er-Jahre also begannen die Zeichnungen aus meinem Kinderbuch dreidimensional zu werden, von Wind, Lauten und Gerüchen belebt. Ich stand an einem riesigen Stauteich, eine Burg in der Mitte, und Biber werkelten geschäftig herum. Bei jeder späteren Begegnung sollte sich dieses Bild wiederholen. Biber sind fleißig. Sie arbeiten, tüfteln, bauen, reparieren, schleppen, nagen. Nie habe ich einen Biber faulenzen gesehen.
Eine Besonderheit gab es hier, die mir neu war. Ich hatte immer gehört, Biber seien nachtaktiv, doch diese waren im hellen Sonnenschein zugange. Tatsächlich, erfuhr ich, sind Biber genauso tagaktiv wie wir, sofern sie in Ruhe gelassen und nicht gejagt werden, wie etwa in dem Nationalpark, in dem ich mich befand. Bis heute tut es mir leid für die Biber in Wien, die im Dunklen leben müssen, weil tagsüber alle Ufergebiete voll sind von Spaziergängern, Hunden, Radfahrern und im Sommer natürlich Badenden. Hier, wo die Fließgewässer tief genug sind, bauen die Biber keine Dämme und in der Wassermitte stehenden Burgen. Sie graben ihre Baue einfach in die Uferböschung. Da sitzen sie dann direkt unter dem Trubel und warten, bis spät nachts das Kreischen, Plantschen, Bellen und die Techno-Musik aus Lautsprechern verklingen und sie endlich herauskommen können.
Der erste Wiener Biber, den ich sehen sollte, war allerdings ebenfalls tagaktiv. Er hieß Flumy, lebte in einem großen Gehege mitten im Nationalpark Donau-Auen, war praktisch zahm und sehr dick. Auch wenn ich bereits von politisch korrekten Personen des Fatshamings bezichtigt wurde: Alle Biber sind dick. Sie haben eine zwei (Sommer) bis drei (Winter) Zentimeter dicke Fettschicht, die sie brauchen, um sich im Wasser warm zu halten. Flumy jedoch war besonders dick, er wurde nämlich von manchen Besuchern trotz entsprechender Verbotsschilder mit Karotten gefüttert. Da er handaufgezogen war, hatte er sich an den Menschen gewöhnt und konnte nicht mehr ausgewildert werden.
Natürlich kann man einen Biber nicht so einfach einsperren. Der Architekt unterirdischer Tunnelsysteme ist ein Ausbrecherkönig. Deshalb sieht man ihn auch selten in Zoos. Auch Flumy grub sich unter allen Barrieren hindurch und erkundete das umliegende Gelände. Im Winter konnten die Tierpfleger gut erkennen, wo er sich gerade befand. Schwebte im benachbarten Damhirschgehege ein Atemwölkchen, kam es aus einem von ihm angelegten Belüftungsschacht. Er kehrte jedoch immer wieder in sein Gehege zurück – warum sollte er sich in der Wildnis plagen, wenn dort Karotten gereicht wurden.
Flumy, der das stattliche Alter von fünfundzwanzig Jahren erreichte, ist mittlerweile in die ewigen Weidenauen eingegangen. Dafür gab es für mich andere denkwürdige Biberbegegnungen. Mit meinem Hund Bubi gehe ich häufig in den Donauauen spazieren. Bubi ist ein Dackel-Mischling und das bedeutet, auch er ist zum Graben geboren. Eines Tages saß ich am Ufer der Neuen Donau, während Bubi neben mir grub. Plötzlich bemerkte ich, dass er in den „Jagdmodus“ geriet, sein Scharren war angespannt, durch die konkrete Anwesenheit eines Wildtieres motiviert. Als das Loch schon ziemlich tief war, fiel mir ein durchdringender Geruch auf. Er erinnerte an penetrantes Herrenparfum mit Moder, Harz, Vanille, Leder, einem Hauch Achselschweiß und Gammelfisch. Es ist der Geruch des Castoreums, auch Bibergeil genannt, mit dem der Biber sein Revier markiert. Früher wurde er gejagt, weil man es für eine hochwirksame Medizin hielt. Etwas Wahres dürfte dran sein. Da der Biber Weidenrinde frisst, die Salicylsäure enthält, die dadurch wiederum im Bibergeil enthalten ist, könnte es wie schwaches Aspirin wirken. Man hätte allerdings auch direkt Weidenrinde auskochen können.
Kaum hatte ich versucht, diesen Geruch einzuordnen, machte es „Platsch“. Ein Biber tauchte aus dem Wasser auf. Bubi hatte seinen Bau von oben angegraben, die Situation war ihm zu heikel geworden und er war durch seinen Unterwassereingang geflohen, wollte sich aber durchaus bemerkbar machen. Vor uns patrouillierte er auf und ab und schlug immer wieder mit der Kelle laut klatschend auf das Wasser, um uns zu vertreiben. Da wir uns nicht von der Stelle rührten, kletterte er irgendwann auf einen Stein und begann sich ausgiebig zu putzen. Denn auch das gehört zu den Tätigkeiten der fleißigen Biber: Fellpflege. Schließlich müssen sie sich permanent mit ihrem öligen Analsekret einreiben, damit ihr Pelz wasserabweisend bleibt.

Seit ruchbar wurde, dass ich das bin, was man im Englischen einen „beaver believer“ nennt, wurde ich so etwas wie eine Biberbeschwerdeanlaufstelle. Immer wieder schicken mir Menschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Fotos von Bäumen, die der Biber angenagt oder gar gefällt hat, und garnieren diese mit mehr oder weniger subtilen Verwünschungen des Übeltäters.
Jemand, der noch weitaus mehr solcher Beschwerden entgegennimmt, ist Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz. Bei ihm läuft alles zusammen: begeisterte Berichte von Biberspurensichtungen in neu erschlossenen Revieren, ernstzunehmende Meldungen von angenagten Bäumen, die beim Fallen Fußgänger gefährden könnten (sodass sie von den Stadtförstern gefällt werden müssen), ebenso wie alltägliche Klagen über die generelle Unordnung, die dieses Wildtier macht.
„Als Förster freut es mich grundsätzlich sehr, dass die Menschen sich so große Sorgen um Bäume machen“, sagt Januskovecz.
Der Mensch liebt Bäume, und das ist gut so. Wie aber kommt es, dass er an einem gefällten Baum, an dem der klare Schnitt einer Motorsäge zu erkennen ist, ohne das geringste Unruhegefühl vorbeigehen kann, aber bei den Spuren eines Wildtieres, das seit Jahrmillionen erfolgreich mit seinem Lebensraum interagiert, den Eindruck hat, dass hier etwas ganz Fürchterliches passiert?
Zwar gibt es auch bei menschlichen Eingriffen vereinzelt Proteste oder gar Bürgerinitiativen, vor allem wenn ein geliebter alter Baum einem Bauvorhaben weichen soll, aber grundsätzlich können die meisten selbst an einem größeren Kahlschlag mit dem Gefühl vorübergehen, hier sei von rationalen Mächten mit gutem Grund der Wald abgeholzt worden. Millionen Festmeter Holz werden für unsere eigene Nutzung gefällt? Tausende Hektar Wald werden für Schilifte, Kraftwerke, Industriegebiete, Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Straßen vernichtet? Nun, das muss halt so sein, da wird schon jemand ausgiebig darüber nachgedacht haben und nach sorgfältiger Abwägung zu einem Entschluss gekommen sein. Aber der Biber denkt nicht nach, er handelt wüst, instinktiv und chaotisch. Oder?
Tatsächlich besiedelt und benagt der Biber nur einen sehr schmalen Uferstreifen, zwischen zehn und zwanzig Meter vom Wasser entfernt. Allein dieses Wissen hilft schon, um einen guten Teil der Ängste auszuräumen. Wird er am Ende den ganzen Wienerwald abholzen? Nein, auf gar keinen Fall. Wirkliche Schäden, erklärt Forstdirektor Januskovecz, kommen in Wien, wo es im unmittelbaren Wirkungsfeld des Bibers keine landwirtschaftlichen Flächen und auch kaum Obstbäume gibt, praktisch nicht vor. An einen einzigen Fall kann er sich erinnern, wo ein Biber sich ungewöhnlicherweise über hundert Meter vom schützenden Wasser entfernte, um – sozusagen im Fruchtrausch – einen Obstgarten zu zerstören. Hier würde er gerne eine finanzielle Entschädigung auszahlen, die aktuelle Rechtslage ermöglicht dies jedoch nicht.
Warum aber ist es kein Schaden, was der Biber macht? Zum einen würde man viele der Bäume und Sträucher, die unmittelbar an der Uferböschung stehen, aus Gründen des Hochwasserschutzes ohnehin fällen. Steigt nämlich der Wasserpegel an, verhindern sie, dass das Wasser möglichst schnell wieder abfließen kann. Auf der Donauinsel etwa kann man an manchen Stellen ein durchaus verwirrendes (oder harmonisches) Nebeneinander von Biberbiss und Menschenschnitt sehen. Nur große, schattengebende Bäume werden stehen gelassen und gegebenenfalls mit Ummantelungen aus Eisengitter vor dem Biber geschützt. Andere Bäume überlässt man ihm bewusst, schließlich kann man ihn im Winter, wo er sich von Rinde ernährt, ja nicht verhungern lassen. Hat er sie so angenagt, dass ihr Fall Menschen gefährden würde, fällt man sie und lässt sie dann liegen, damit er sie abnagen, zerlegen und stückweise ins Wasser ziehen kann. Erst im Frühjahr, wenn es wieder andere Nahrungsquellen gibt, räumt man die Reste fort.